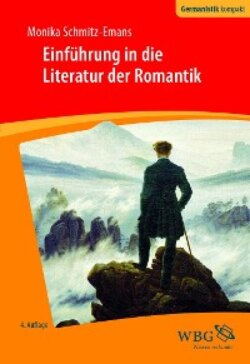Читать книгу Einführung in die Literatur der Romantik - Monika Schmitz-Emans - Страница 18
3. Kultur und Literatur zwischen Revolution und Restauration
ОглавлениеKunst, Bürgertum und „Kaufpublikum“
In der frühromantischen Phase wird das kulturelle Leben in Deutschland noch erheblich durch die fortbestehenden Feudalstrukturen geprägt, wenngleich das Bürgertum auch vor seiner politischen Emanzipation bereits an Selbstbewusstsein gewinnt. Maßgeblich für das kulturelle Leben der Restaurationszeit ist dann das sich etablierende Bildungsbürgertum. Theater und Museen, Opernhäuser und Konzertsäle sowie private Zirkel spiegeln seine geistigen Bedürfnisse wider. Während Kunst und Literatur in der Feudalgesellschaft primär dem Repräsentationsbedürfnis des Adels entsprochen hatten, besitzen sie für das Bürgertum komplexere Funktionen. Unter anderem dienen sie der Reflexion über die eigene gesellschaftliche Identität. Die gesellschaftliche Rolle des Künstlers und Dichters unterliegt einem tiefgreifenden Wandel. Er ist an keinen festen Auftraggeber mehr gebunden und damit, was seine gesellschaftliche Einbindung betrifft, im positiven wie im negativen Sinn in seine Freiheit entlassen. Diese bedeutet keineswegs Unabhängigkeit, denn wirtschaftlich ist der Künstler ja mehr denn je von denen abhängig, die Jean Paul das „Kaufpublikum“ nennt. Sofern er nicht auf ein interessiertes und aufgeschlossenes Publikum stößt, droht wirtschaftliche Not.
Aufwertung von Wort und Rede
Eine wichtige Begleiterscheinung der durch die Revolution geprägten neuen politischen Kultur liegt in der Aufwertung von Wort und Rede. Immerhin sind die revolutionären Ereignisse mit Mitteln der Rhetorik ausgelöst worden. Die Wirklichkeit ist in einem bisher unvertrauten Maß zum Produkt von Begriffen geworden. Und mehr denn je wird ihre ökonomische und gesellschaftliche Gestaltung im Medium der Sprache, der Schriften und Diskurse verhandelt und vorweggenommen. Wie Sprache „Geschichte machen“ kann, beschreibt exemplarisch Heinrich von Kleist in seiner Abhandlung Von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Mit einer für Kleist charakteristischen paradoxalen Wendung erscheint das sprechende Ich allerdings nicht als autonomes Subjekt, das mit Worten planvoll umgeht, sondern als eines, das von Einfällen überrascht wird und dabei manchmal Ungeplantes, ja Unkontrolliertes von sich gibt.
Politische Publizistik und romantische Utopien
Die Revolutionszeit, aber auch die anschließende Phase der napoleonischen Kriege, der Krisenzeit Preußens und der tiefgreifenden politisch-gesellschaftlichen Umwälzungen bringen eine Fülle von politischen Pamphleten, historischen und staatsphilosophischen Abhandlungen hervor, welche die zeitgeschichtliche Situation direkt oder indirekt spiegeln. Schon 1790 erscheinen Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France, die bald ins Deutsche übersetzt werden. Immanuel Kants Schrift Zum ewigen Frieden, publiziert 1795/96, nimmt auf die zeitgeschichtliche Situation gleichfalls Bezug. Joseph Görres veröffentlicht 1798 seine Programmschrift Der allgemeine Friede, ein Ideal. Der den Jenaer Romantikern nahestehende Johann Gottlieb Fichte spricht sich zunächst nachdrücklich für die Ideen der Revolution aus, bevor er später zum Nationalisten wird. Novalis nimmt mit zwei politisch-visionären Schriften indirekt Bezug auf die zeitgeschichtliche Situation. In Die Christenheit oder Europa projiziert er seine Wunschvorstellung eines politisch und ideell geeinten Europas auf das Mittelalter – auf eine andere Zeit, die der Leser allerdings nicht mit dem realen Mittelalter verwechseln sollte. Auch Novalis’ Aphorismen-Sammlung Glauben und Liebe von 1798 ist politischen Visionen gewidmet und umreißt eine Staatsidee im Geist der Romantik. Idealisiert wird zum einen das preußische Königspaar Friedrich Wilhelm III. und Luise, zum anderen das gesamte Staatswesen, das Novalis gemäß dem organologischen Modell einer psycho-physischen Ganzheit interpretiert. Glauben und Liebe ist keine im engeren Sinne politische Abhandlung, sondern geprägt durch eine Ästhetisierung politischer Begriffe. Diese erfahren durch ihre Versetzung in neue, aus der Sicht realpolitischen Denkens widersinnige Kontexte eine radikale Umwertung. So etwa setzt Novalis den „ächten König“ mit der „ächten Republik“ gleich, hebt also die für den politischen Diskurs entscheidende Differenz zwischen Monarchie und Republik in einer die Gegensätze synthetisierenden Denkbewegung auf (vgl. dazu Kremer 2001, 25). Einem Grenzbereich zwischen politischem Manifest und literarischer Vision gehören die publizistischen Schriften Jean Pauls an, so die Friedenspredigt an Deutschland. Wie auch Goethe steht Jean Paul dem patriotischen Enthusiasmus der Deutschen skeptisch gegenüber.
Satiren
Komplementär zur politischen Vision verhält sich die Satire. Ein beliebter Gegenstand der satirischen Darstellung sind die sogenannten Duodezfürstentümer, ihre kleinen Residenzen ohne Macht, ihr Provinzialismus und ihr leerer Repräsentationsgeist. E. T. A. Hoffmann karikiert die Atmosphäre dieser Höfe etwa im Kater Murr sowie in Nußknacker und Mausekönig. Auch Jean Paul siedelt Teile seiner Romanhandlungen gern an solchen Höfen an, um sie durch Kontrastierung mit anderen Lebenssphären und insbesondere mit der Innerlichkeit empfindsamer Individuen bloßzustellen. Der typische Höfling der romantischen Literatur ist ein gefühlloser Imitator menschlicher Empfindungen, ein zynischer Intrigant; er hat einen Hang zur Ausschweifung und dient seinem Duodezfürsten wie eine Marionette. Die literarisch porträtierten Fürsten selbst sind oft schwach und gehirnlos oder werden von überspannten Ideen umgetrieben. Ergänzt werden die männlichen Scheinexistenzen der Höfe durch weibliche Pendants, die eitel und sittenlos unschuldigen Jünglingen nachstellen oder sich durch Intrigen Macht zu sichern versuchen. Die durch Künstlichkeit und Falschheit geprägte Hofgesellschaft, wo Eltern ihre Kinder herzlos aus politischem Kalkül verkaufen und verkuppeln, wird vielfach mit der bürgerlichen Familie kontrastiert, wo natürliche Empfindungen die Beziehungen der Mitglieder bestimmen. Ein nicht minder beliebtes Objekt der Satire sind jedoch die Bürger selbst. Die von der Vorromantik an die Romantik vererbte Tendenz zu Kritik an trivialem Rationalismus, Autoritätsgläubigkeit und Nützlichkeitsdenken mündet in eine phantasievoll-boshafte Philisterkritik ein, die eine Reihe von Stereotypen hervorbringt. Der typische Philister zeichnet sich insbesondere durch seine Ignoranz gegenüber Schönheit, Kunst und Künstlern aus. Sein Interesse gilt dem eigenen ökonomischen Nutzen und der Bequemlichkeit; er denkt (wenn überhaupt) in starren Ordnungsmustern und vertritt eine verknöcherte, lebensfeindliche Moral. Im günstigsten Fall geht sein Leben darin auf, Kaffee und Tabak zu konsumieren und aus vermeintlich gesicherter Sitzposition heraus über den Weltlauf zu räsonieren. Brisanter wird es, wenn er den Künstler bevormunden möchte. Der satirisch porträtierte Gelehrte und Magister ist ein naturferner, verknöcherter und egoistischer Besserwisser.
Zwischen emanzipatorischen und konservativen Tendenzen
Eine Differenzierung zwischen Früh- und Spätromantik liegt am ehesten mit Blick auf die gesellschaftspolitische Orientierung ihrer Vertreter nahe. Die Ideenwelt der Frühromantiker ist geprägt durch die Ideen der Entgrenzung, der Progression und der Öffnung geschlossener Denk- und Handlungszusammenhänge für neue Anstöße, ja für Widerspruch und Paradox, ferner durch eine kosmopolitische Haltung und durch gesellschaftlichen Liberalismus. So tragen gerade die frühen Romantiker zu einer Entwicklung bei, in deren Folge auch solche gesellschaftliche Gruppen ins kulturelle Leben und in den öffentlichen Diskurs einbezogen werden, die bisher weitgehend ausgeschlossen oder als Minorität diskriminiert worden waren: die Frauen und die Juden. Die späte Romantik ist demgegenüber weitgehend (nicht pauschal) durch konservatives Denken charakterisiert. Charakteristisch für die literarischen und publizistischen, aber auch für die wissenschaftlichen Tendenzen der mittleren und späteren romantischen Zeit ist eine Tendenz zur Verklärung der Vergangenheit und ihrer angeblichen Institutionen und Gebräuche. Hier artikuliert sich indirekt oft der Wunsch, die in ihrer Radikalität irritierenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen zum Stillstand zu bringen, wenn nicht sogar rückgängig zu machen. Wichtige Vertreter der späteren Romantik denken restaurativ. Die Kontinuität ist, bezogen auf die revolutionär gesinnten frühromantischen Kreise, jedoch größer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn so wie die Frühromantiker die Revolution auf intellektuellem Gebiet für maßgeblicher halten als äußere politische Ereignisse, so zielt auch das Geschichtsdenken der Spätromantiker weniger auf die Darstellung äußerer Daten oder gar auf konkrete politische Einflussnahme ab als auf die Modellierung von Ideen. Bei den romantisch-verklärten Bildern der Vergangenheit handelt es sich um durch und durch artifizielle Konstrukte.
Mythisierung des „Ursprünglichen“ und „Natürlichen“
Diskursbeherrschend wird die Leitdifferenz von Natur und Zivilisation, die man tendenziell auf den Antagonismus zwischen Deutschland und Frankreich projiziert. Die deutsche Idealisierung des (angeblich) Gewachsenen geht einher mit der Kritik am Gemachten, wobei letztere sich spezifisch auf den aus Frankreich per Oktroi eingeführten Code civil bezieht, dem das traditionelle und angeblich organische deutsche Rechtswesen polemisch gegenübergestellt wird. Erfunden wird gleichsam eine kohärente großdeutsche Vergangenheit, die es allerdings in dieser Form gar nicht gegeben hat, und zu deren Helden die Germanen, Karl der Große, Friedrich Barbarossa und andere Gestalten der ‚deutschen‘ Geschichte avancieren. Indirekten Anteil an dieser Verklärung der deutschen Vergangenheit haben auch die literarischen Bearbeitungen volkstümlicher Stoffe, vor allem die Sammlungen von Volksbüchern, Märchen und Mythen durch Görres und die Brüder Grimm sowie Brentanos und Arnims Sammeltätigkeit für Des Knaben Wunderhorn (1806/08). Wiederum ist allerdings auch auf Kontinuitäten hinzuweisen: Auch die frühromantische Literatur besitzt Affinitäten zu volkstümlichen Motiven und Fabeln, wie etwa die Märchennovellen und Märchenkomödien Tiecks belegen. Während allerdings die Frühromantiker diese – wie alle anderen – Stoffe zum Anlass spielerischer Umgestaltungen nehmen, dokumentiert sich in der Sammlertätigkeit der genannten Kompilatoren das Bestreben, Überliefertes zu sichten und zu konservieren. Dies wiederum hindert allerdings die Brüder Grimm nicht an Eingriffen in das gesammelte Märchenmaterial. Und Dichter wie der konservative Arnim, der sich dem Katholizismus zuwendende Brentano oder der in Regierungsdiensten stehende Jurist Hoffmann unterwerfen Märchenund Sagenmotive tiefgreifenden Metamorphosen, die mit volkstümlicher Naivität nicht das geringste zu tun haben. Kontrovers diskutiert wird in romantischen Kreisen, ob die mythopoetischen Potentiale der vergangenen Zeitalter in der Gegenwart neu belebt oder nur mehr deren Produkte herbeizitiert werden können.
Patriotismus und Nationalismus
Als Folge der napoleonischen Kriege entsteht in Deutschland eine nationale Bewegung, die vor allem durch ihre antifranzösischen Ressentiments geprägt ist und verschiedene Autoren der romantischen Zeit erfasst. Das aufkommende national-patriotische Bewusstsein spiegelt sich unter anderem in einer Vorliebe für Stoffe und Gestalten aus der Nordischen Sagenwelt oder der Geschichte Germaniens. Ernst Moritz Arndt etwa idealisiert die deutsche Vergangenheit und die deutsche Kunst in Verbindung mit polemischen Ausfällen gegen die romanischen Nachbarn. Antifranzösische sowie antisemitische Gesinnungen verbinden insbesondere die Mitglieder der 1811 gegründeten Deutschen Tischgesellschaft, der unter anderem Achim von Arnim angehört. Auch Fichte tritt als Verfechter einer nationalen Ideologie auf, nachdem er zunächst republikanisch gedacht und die französische Revolution begrüßt hatte. In den Reden an die Deutsche Nation (1807–1808) greift er zwar die Idee einer kosmopolitischen Gesellschaft auf, fordert jedoch für die Deutschen die Führungsrolle bei deren Realisierung ein. Die Befreiungskriege gegen Napoleon werden zum Gegenstand diverser erzählerischer und lyrischer Texte, so bei Eichendorff und bei Theodor Körner (1791–1813), dessen emphatische Kriegslieder weite Verbreitung finden. Die zeitgeschichtliche Situation spiegelt sich aber auch in Werken wider, welche die Befreiungskriege indirekt thematisieren, so in Heinrich von Kleists Hermannsschlacht (1808), in welcher das Aufbegehren der von den Römern bedrängten Germanen an aktuelle Widerstände der Deutschen gegen die Romanen erinnert.
Buchproduktion, Zeitschriftenwesen, Leserschaft und ‚arme Poeten‘
Die Kommunikationsstrukturen der romantischen Zeit entstehen auf der Grundlage von Voraussetzungen, welche die Aufklärung geschaffen hat. Bedingt durch mehrere Faktoren, zu denen auch marktwirtschaftliche Wandlungen im Bereich des Buchhandels gehören, erfährt die Produktion von Büchern und anderen Druckerzeugnissen einen eminenten Aufschwung. Erhebliche Zuwachsraten verzeichnet das Zeitschriftenwesen. In Deutschland werden im Jahr 1790 1225 Titel gezählt, danach kommt es zu Rückgängen, nach 1820 wieder zu Zunahmen, bei denen allerdings die Rekorde von 1790 nicht mehr eingeholt werden. Der Buchmarkt weitet Sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts erheblich aus, entwickelt sich dann zunächst rückläufig, erreicht nach 1820 aber wieder die früheren statistischen Werte. Friedrich Schlegel betreibt eine ganze Reihe von Zeitschriftenprojekten. Arnim und Brentano geben gemeinsam die Zeitschrift für Einsiedler (1808) heraus. Joseph Görres’ Rheinischer Merkur (1814–1816) ist patriotisch und demokratisch orientiert, widmet sich aber ebenfalls der älteren deutschen Literatur, und das deutsche Erbe wird auch in den Altdeutschen Wälder(n) (1813, 1815, 1816) der Gebrüder Grimm verwaltet. Weitere Zeitschriften, welche das Interesse an politischen und an ästhetischen Gegenständen verbinden, sind Fouqués Periodika: Die Jahreszeiten (1811–14), Die Musen (1812–1814), Berlinische Blätter für deutsche Frauen (1829–1830). Kleist verfasst lyrische, narrative und essayistische Beiträge zu den von ihm redigierten Berliner Abendblättern (1810–1811). Schon in den letzten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts setzt ein Prozess der sich vervielfachenden Buchproduktion ein. Auch die Zahl der Buchhandlungen wächst auf ein Mehrfaches an, zumindest in den großen Städten. Das Berufsbild des Schriftstellers befindet sich ebenfalls in einem bereits von der Spätaufklärung initiierten Wandel. Vom Zulieferer einer höfischen Repräsentationskultur hat sich der Schriftsteller zum Lieferanten für ein bürgerliches Kaufpublikum gewandelt. Allerdings wird er damit vom Markt abhängig. Das Berufsbild des freien, oft aber erfolglosen Schriftstellers gewinnt in der Folge Kontur – bis hin zum Klischee. Der von Schriftstellern porträtierte typische arme Poet lebt in bescheidensten Verhältnissen, weil der Wert seiner Dichtung nicht erkannt wird und sich entsprechend nicht in existenzsichernden Verkaufszahlen seiner Bücher niederschlägt. Seine Existenz steht im Zeichen eines Zwiespalts: Je mehr er der Welt an Neuem zu sagen hat, desto weniger ist er dieser Welt verständlich; je origineller seine Ideen, desto gleichgültiger oder ablehnender bleibt das Publikum.