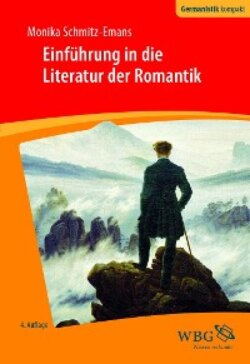Читать книгу Einführung in die Literatur der Romantik - Monika Schmitz-Emans - Страница 22
7. Zeit und Geschichte
ОглавлениеZeit und Zeitlichkeit
Zeit und Zeitlichkeit sind Kernthemen des romantischen Diskurses. Friedrich Schlegel charakterisiert das eigene Zeitalter in seiner Abhandlung Über die Unverständlichkeit (1800) als eine Zeit der Bewegtheit und des Aufbruchs (FS II, 370f.). Schon für das spätere 18. Jahrhundert ist die Erfahrung der Verzeitlichung aller Lebensbereiche und des sich beschleunigenden historischen Wandels zentral. Dies führt zur Ausbreitung der historischen Disziplinen. Früh bereits wird die Beschleunigung der öffentlichen Lebens- und Entwicklungsprozesse in Wirtschaft, Technik und Politik mit Skepsis beobachtet. Ein entsprechendes Unbehagen artikuliert sich auch literarisch. Im Wunderbaren morgenländischen Märchen … Wackenroders (vgl. dazu Kap. V) leidet die Hauptfigur unter dem rasenden Rad der Zeit und sehnt sich nach Erlösung. Diese wird durch die Musik gespendet, eine Kunst, welche durch Organisation der ungegliederten und durch Füllung der ‚leeren‘ Zeit diese aber zugleich in sich aufhebt, sie gestaltet und mit Sinn erfüllt.
Romantik als Diskurs über Zeitlichkeit
Historiker und Literaturwissenschaftler haben dargelegt, welch tiefgreifende Konsequenzen die Zentrierung auf das Thema Zeit für die Terminologie der romantischen Epoche hatte: Wissenschaften, soziale und politische Theorien sind geprägt durch Begriffe, die zeitliche Veränderungskoeffizienen enthalten (Koselleck 1979, 339), und der allgemeine Wortschatz des Deutschen nimmt viele neue Komposita aus dem Wort „Zeit“ auf (Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 31, 550–584). Konzepte der Geschichtlichkeit, des Fortschritts und des Niedergangs sowie Bilder der Beschleunigung hinterlassen vielfältige Spuren. Dass Ich und Welt immer nur im Werden und in einem Prozess der Transformation erfahrbar werden, führt tendenziell zu einem tiefgreifenden Orientierungsverlust. Das romantische Subjekt nimmt sich nicht an einer bestimmten Position, sondern in einem zeitlichen Verlauf wahr, und die äußere Welt droht ihm durch diese Verzeitlichung ebenso zu entgleiten wie das eigene Selbst. Zudem steht die Erfahrung zeitlicher Wirklichkeit eher im Zeichen der Erinnerung von Vergangenem und der Antizipation von Zukünftigem als in dem der Hingabe an die Gegenwart; diese ist zumindest stets von Erinnerungen und Antizipationen durchdrungen.
Triadische Modelle von Geschichte
Das Grundschema des vorromantischen und romantischen Geschichtsdenkens ist triadisch: Auf eine Phase der Einheit folgt ein Zeitalter der Disharmonie, auf das eines der neuerlichen Harmonie folgen soll. Die Frühgeschichte der Menschheit wird – unter dem Einfluss rousseauistischer Ideen und Herderscher Konzepte – idealisiert. Die spätere Zeit und die Gegenwart gelten als Phasen des Abfalls vom Ursprung und der Entwicklung zum Negativen. Dieser Befund kann zivilisationskritisch oder auch politisch akzentuiert sein. Die Zukunft erscheint als Projekt, sie soll auf höherer Stufe die verlorenen Ideale der Vergangenheit restituieren. Schiller verknüpft die triadische präromantische Geschichtskonzeption mit einer ästhetischen Programmatik; die Kunst antizipiert den Zustand der Erlösung und bereitet ihn vor, indem sie den Menschen entsprechend erzieht. Jean Paul erklärt diese utopistische Dimension zum entscheidenden Grundzug romantischer Dichtung, deutet aber auch die Uneinlösbarkeit ihrer Hoffnungen an: „Ist Dichten Weissagen: So ist romantisches das Ahnen einer größeren Zukunft, als hienieden Raum hat“ (JP V, 89).
Insgesamt findet die romantische Geschichtstheorie unterschiedliche Projektionsflächen für ihre Idealvorstellungen. Friedrich Schlegel und Schelling sehen wie Schiller die griechische Antike als Inbegriff des idealen gesellschaftlichen Zustands an. Auch für Hölderlin ist Griechenland Inbegriff einer vollendeten Kultur, einer Zeit der Vertrautheit zwischen Göttern und Menschen. Novalis stilisiert das christliche Mittelalter zum „Goldenen Zeitalter“. Idealisierungen der Vergangenheit prägen Tiecks Leben und Tod der Heiligen Genoveva (1800), Novalis’ Heinrich von Ofterdingen, Brentanos Schauspiel Die Gründung Prags (1812), aber auch Hoffmanns Meister Martin der Küfner und seine Gesellen (1819). Eichendorff, der sich an Novalis orientiert, versucht, romantische und katholisch-religiöse Ideen zur Deckung zu bringen.
Romantische „Ereignisse“
Wo die Empfindung der Zeitlichkeit alle Erfahrung begleitet, da wird zeitlose Gegenwärtigkeit zum Ziel der Sehnsucht. Aber auch Momente erfüllter Gegenwart sind aus dem Fluss der Zeit herausgehobene Momente. Je weniger das Leben sie zu gewähren scheint, desto reizvoller erscheint es, sie zu imaginieren. Ein Schlüsselbegriff der Romantik im Schnittfeld geschichtsphilosophischer und ästhetisch-literarischer Diskurse ist vor diesem Hintergrund der Begriff des „Ereignisses“. Die gleichförmig verlaufende Zeit wird unterbrochen, der gewöhnliche Zeitfluss wird überhöht durch den herausgehobenen Moment. Konstitutiv für das Ereignis ist ein Moment der Plötzlichkeit, des unvermittelten Heraustretens aus der Unsichtbarkeit und der Einzigartigkeit. Das so verstandene Ereignis steht in enger Korrelation zur Idee des Erhabenen: Es bricht das Gewöhnliche auf und erinnert den Menschen an seine höhere Bestimmung. Wahre Natur- und Kunst-Erfahrungen sind ereignishaft.
Leiden an der Zeit
Als leer empfundene Abläufe der Zeit werden durchlitten; und die Kunst übernimmt hier Kompensationsfunktionen, sei es, dass sie die Zeit zum Stillstand bringt, sei es, dass sie ihr eine eigene Ordnung gibt, sei es, dass sie sie durch ästhetische Strukturierung sinnvoll gestaltet und damit zur erfüllten Zeit macht. Die Aufsätze Joseph Berglingers aus Wackenroders und Tiecks Phantasien über die Kunst (1799) artikulieren früh und exemplarisch das Leiden an der Zeit – nicht an einer bestimmten, sondern an der Zeit schlechthin. Romantische Helden werden oft in andere Zeitordnungen entführt oder erhalten ahnungsweise Kenntnis von diesen, so das Mädchen Marie in Tiecks Erzählung Die Elfen. Manche Geschichten variieren das Märchenmotiv vom nach langen Jahren ungealtert zurückgekehrten Helden. Auch die beliebte Geschichte des Bergmanns von Falun, die von Schubert, Hoffmann und Hebel nacherzählt wird, bietet Anlass zur Bespiegelung differenter Zeitordnungen.