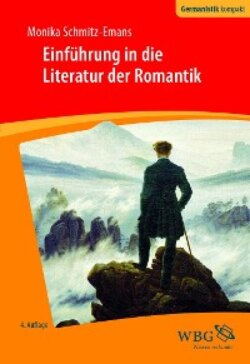Читать книгу Einführung in die Literatur der Romantik - Monika Schmitz-Emans - Страница 21
6. Romantische Naturwissenschaft und Psychologie
ОглавлениеDas Modell des Organismus
In den Naturwissenschaften hatte sich im Zeitalter des Rationalismus eine atomistische und mechanistische Betrachtung natürlicher Phänomene durchgesetzt; vor allem Newtons Mechanik prägte den wissenschaftlichen Diskurs nachhaltig. Sowohl die Gegenstände naturwissenschaftlicher Erkenntnis als auch die Wissenschaften selbst werden in Elemente und Funktionsteile zerlegt, deren Zusammenspiel als Mechanismus erscheint. Bis in die späteren Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts hinein dominiert dieses physikalische Paradigma in der Naturwissenschaft wie in der Anthropologie. Die für Erkenntnistheorie, Psychologie und Ästhetik grundlegende Vermögenslehre zeigt insofern seinen Einfluss, als sie den Menschen als Kräftebündel deutet. Wie materiell-physikalische Objekte, so wird auch die Psyche in Teile und Funktionen zerlegt und auf die Gesetzmäßigkeiten ihrer Funktionsteile hin analysiert. Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts vollzieht sich eine Wende hin zum ganzheitlichen Denken. Philosophen, Naturforscher und Anthropologen bemühen sich nun darum, Materie und Geist als lebendige Einheit zu begreifen. Der Organismus avanciert zum Modell, das herangezogen wird, um natürliche und seelische Prozesse zu erklären. Zugleich werden auch nicht-animalische Bereiche der Natur sowie kulturelle Realitäten wie Sprache und Kunst organologisch interpretiert. Historische Prozesse werden nun ebenfalls in Anlehnung an Modelle beschrieben, welche der Biologie oder einer holistisch konzipierten Chemie entstammen. Parallel zu diesem Paradigmenwechsel und in engem Zusammenhang mit ihm kommt es zu revolutionären naturwissenschaftlichen Entdeckungen, und man formuliert neue Thesen über universale Funktionszusammenhänge in der Natur. Sauerstoff und Elektrizität sind die wohl wichtigsten physikalischen Entdeckungen des 18. Jahrhunderts. Beide stimulieren die Zuversicht, das Ganze der Natur stehe unter einem einheitlichen Gesetz. Das Konzept einer Natur, in der Gegensätzliches dialektisch interagiert und in der sich eine kontinuierliche Entwicklung von Niederem zum Höheren vollzieht, sowie insbesondere die Idee vom Menschen als einem mikrokosmischen Abbild des Makrokosmos und als Wirkungszentrum natürlicher Kräfte bestimmen die romantische Medizin, Anthropologie und Naturspekulation. Von nachhaltigem Einfluss ist das 1796 in deutscher Übersetzung erschienene System der Heilkunde des schottischen Arztes John Brown. Hier wird der menschliche Organismus mit Hilfe eines Polaritätsmodells beschrieben. Krankheiten erscheinen als Folgen von Störungen im inneren Haushalt des Organismus. Bahnbrechend ist vor allem, dass hier die Nerven als mittlere Instanz zwischen Geist und Körper erstmals im Zentrum des medizinisch-organologischen Interesses stehen. Novalis greift Browns Anregung auf und sieht nicht nur die Krankheiten des Körpers, sondern auch die der Seele als Folge nervliche Störungen an, wie sie im Prozess der Höherentwicklung entstehen. Der Dichter in seiner asthenischen Verfasstheit drückt den Entfremdungszustand seines Zeitalters aus. Ähnlich geht auch Schelling von der in ihren Grundzügen noch mechanistischen Naturlehre John Browns aus, transformiert sie und integriert Kernideen in seine Abhandlung Von der Weltseele (1798), wo sie zu einer dialektischen Theorie der Weltgeschichte ausgeweitet sind. Auch Galvanis Entdeckungen elektrischer und magnetischer Phänomene in der organischen Welt scheinen zu beweisen, dass zwischen belebter und unbelebter Natur kein Abgrund liegt, sondern beide einheitlichen Gesetzen unterstehen. Dies wiederum legt die Übertragung organologischer Vorstellungen auf die anorganische Natur nahe.
„Animalischer Magnetismus“
Im Kontext der romantischen Ansätze, Natur und Geist als Einheit zu denken, spielt der Magnetismus eine besonders anregende Rolle. Nachdem Galvani die sogenannte „tierische Elektrizität“ entdeckt hatte und der Zusammenhang zwischen magnetischen und elektrischen Phänomenen bekannt geworden war, schien man den universalen Schlüssel zur anorganischen und animalischen Welt in der Hand zu halten. Nicht allein, dass Ritter und Schelling die Lehren Galvanis aufgreifen und sie in umfassende naturphilosophische Konzepte integrieren, auch in der Medizin, der Psychologie und der paramedizinischen Heilpraxis macht der sogenannte tierische Magnetismus Epoche. Als magnetisch gedeutet werden vor allem psychosomatische Prozesse, bei welchen Psychisches und Körperliches sich als Funktionszusammenhang darstellen. Darüber hinaus scheint den Verfechtern der magnetistischen Lehren die seelisch-körperliche Existenz des Einzelmenschen durch magnetische Rapporte mit dem Ganzen der Natur verbunden zu sein; die besondere Sensitivität mancher Personen für unsichtbare, ferne, vergangene oder künftige Gegebenheiten gilt als Indiz hierfür. Das Interesse am sogenannten animalischen Magnetismus stimuliert die experimentelle Erforschung und spekulative Deutung von Traumerlebnissen, von Spielformen des Somnambulismus und von hypnotischen Praktiken. Franz Anton Mesmer ist der bedeutendste Vertreter magnetistischer Thesen, die nach ihm auch „Mesmerismus“ genannt werden. Er behauptet die Allgegenwart von Kräften, die das Weltall regieren und sich in der Seele des Menschen bündeln können. In ihren Grundzügen besagt Mesmers Lehre, dass ein feines physikalisches Fluidum das Universum durchströmt und eine Verbindung der Menschen untereinander sowie mit den Planeten stiftet. Durch eine ungleiche Verteilung dieses Fluidums im Körper werden Krankheiten hervorgerufen, die entsprechend durch Wiederherstellung des Gleichgewichts zu heilen sind. Viele Anhänger der magnetistisch-mesmeristischen Lehre sind davon überzeugt, dass sich in Traum- und Wahn-Erlebnissen sowie in Zuständen des Somnambulismus und unter Hypnose die Verbindung zwischen unbewussten Regungen der Seele und überindividuellen Kräften bekunde. Auch und gerade hier sucht man nach Indizien für einen inneren Zusammenhang zwischen dem einzelnen Menschen und einer als ganzheitlich konzipierten, durchseelten Natur. Diverse Magnetiseure erzeugen künstlich Zustände des Somnambulismus und versuchen in Kontakt zum Unbewussten zu treten. Auch wenn diese Praktiken rückblickend oft abenteuerlich erscheinen, können sie doch als erste systematische Erkundung seelischer Tiefenschichten gelten. Medizinische und paramedizinische Praktiken, Anthropologie, Naturphilosophie und Psychologie beeinflussen und durchdringen sich wechselseitig. Die mesmeristische Naturphilosophie steht Schellings spekulativem System nahe; der Magnetismus wird zum zentralen Thema in Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808). Auch literarisch findet er großen Widerhall.
Wichtige Zeugnisse romantische Naturphilosophie
Zu den wichtigsten Zeugnissen romantischer Naturphilosophie gehören die Schriften Gotthilf Heinrich Schuberts, so die erwähnten Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808) und die Symbolik des Traums (1814). Zu nennen sind ferner Franz von Baader: Beyträge zur Elementar-Physiologie (1797), Carl August Eschenmayer: Säze (sic) aus der Natur-Metaphysik auf chemische und medicinische Gegenstände angewandt (1797), Johann Wilhelm Ritter: Beweis, dass ein beständiger Galvanismus den Lebensprozess in dem Thierreich begleite (1798), Lorenz Oken: Abriß des Systems der Biologie (1805), H(e)inrich (Henrik) Steffens: Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft (1806), Carl Gustav Carus: Grundzüge allgemeiner Naturbetrachtung (1823).
Entdeckung des Unbewussten
Wo der Verstand nicht Herr im Seelenhaushalt ist, gewinnen irrationale Kräfte leicht die Macht über rationale, und das Unbewusste wird zum möglichen Impulsgeber. Anthropologie und Ästhetik wenden sich diesem Themenfeld zu. Traum, Wahn und Somnambulismus erscheinen als Zustände, in denen sich das Unbewusste vorzugsweise manifestiert. Da die Seele nicht als statischer, sondern als sich dynamischer Funktionskomplex verstanden wird, konzentriert sich das Interesse der Romantik zudem auf individualgenetische Prozesse. Die Kindheit wird als Schlüsselphase begriffen, und zwar vor allem mit Blick auf traumatische Erfahrungen. Neben der Entwicklungspsychologie ist die Psychopathologie eine die Romantik faszinierende Disziplin: Das Abnorme und Extravagante interessiert als Extremform möglicher Seelenzustände und als Zeugnis der Transgression des Gewöhnlichen mehr als das Mittlere und Gewohnte. Die romantische Psychologie geht in der von Karl Philipp Moritz gewiesenen Richtung weiter. Johann Christian Reil (1759–1813; vgl. die Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen, 1803) und Heinrich Jung-Stilling (1740–1817; vgl. die Theorie der Geister-Kunde, 1808) beziehen die Lehren Mesmers ein und propagieren hypnotisch- „magnetische“ Heilverfahren vor allem für seelische Störungen.
Naturspekulation und Psychologie Schuberts
Die Natur- und Seelenlehre Gotthilf Heinrich Schuberts, dessen Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft Hoffmann und andere Schriftsteller intensiv studieren, möchte diejenigen Bereiche des Wissens erschließen, welche von der an messbaren und eindeutig beweisbaren Ergebnissen interessierten Wissenschaft missachtet werden, insbesondere Traumerlebnisse und Gegenstände des Wunderglaubens. Schubert umreißt ein Stufenschema des Lebens, in welches der Tod als eine Stufe der Höherentwicklung einbezogen ist. Die Vorstellung von Tod und Nacht als den Zielen einer sinnvollen Entwicklung, welche zum mütterlichen Ursprung zurückführe, verbindet Schubert mit Novalis’ Hymnen an die Nacht. Durch Herder und Schelling beeinflusst, betrachtet er das Sein als Einheit in der Mannigfaltigkeit, das Einzelne als Manifestation des Weltganzen, das Sinnliche als Ausdruck des Übersinnlichen. Wer sich magnetisieren lässt, wird der Existenz einer höheren und wahreren Welt inne. Analoges gilt für manche Träume. Schubert konstatiert in seiner Symbolik des Traums (1814) anlässlich von Bemerkungen zur prophetischen Gabe von Somnambulen, diese seien tatsächlich zur Überschreitung räumlicher und zeitlicher Grenzen fähig. Die Symbolik des Traums ist insgesamt ebenfalls den inneren Wechselwirkungen zwischen einzelner Seele und übergeordnetem natürlichem Zusammenhang gewidmet. Schubert geht hier davon aus, dass die Natur eine Totalität von „hieroglyphischen“ Zeichen darstellt. Träume und Traumbilder bilden nach seiner Überzeugung ein Teilidiom der Natursprache in Kürzeln. Damit sind Träume Texte, oft allerdings Gegen-Texte zu den Verlautbarungen des Ichs im Wachzustand. (Weil das Geträumte ein vom wachen Verhalten und Reden überdeckter Text ist, der letzterem aber eigentlich zugrunde liegt, spricht Schubert explizit von einem „ironischen“ Widerspruch zwischen den Alltagsäußerungen und dem unbewussten Subtext.) Das Unbewusste gilt Schubert als eine poetische Instanz. Er charakterisiert es mit der Metapher vom „versteckte(n) Poet(en)“ im menschlichen Innern (Symbolik des Traums). Damit statuiert er eine Analogie zwischen der Tätigkeit des Unbewussten und der des Dichters. Die Produktivkräfte des Unbewussten sind ein wichtiges Thema romantischer Poetik. Hoffmann greift diese Idee – wie auch Schuberts Ausdruck vom versteckten Poeten – auf. Im Traum sehen auch andere romantische Autoren ein Modell der imaginativen Tätigkeit. Diese allerdings sollte bewusst praktiziert werden.
Traum-Dichtungen
Romantische Texte enthalten viele und oft außerordentlich kühne Traumvisionen. Dabei ist eine Grundambivalenz zu registrieren: Einerseits scheint der Traum die Verbundenheit des träumenden Ichs mit dem Universum zu verheißen oder zu bestätigen. Vor allem vom Magnetismus inspirierte Traumdarstellungen suggerieren solche universale Verbundenheit. Andererseits entfremdet sich gerade der Träumer von der ihn umgebenden Welt, da ihm selbst die Wirklichkeit in eine Traumwelt und eine Welt der wachen Erfahrung zerfällt. Statt sich mit der nächtlichen Seite der Welt verbunden zu fühlen, kann das Ich in ein wachendes und ein träumendes Teil-Ich dissoziieren. Auch Schuberts Zutrauen in die träumerischen Offenbarungen schwindet später. An der Vorstellung, dass sich die Nachtseite der Existenz in Träumen artikuliere, hält er zwar fest. Doch er betont nun stärker das Moment der Entfremdung und Selbstentfremdung, das aus der subjektiven Traumerfahrung resultiert.
Fließende Übergänge zwischen Gesundheit und Krankheit
Bedenklich durchlässig erscheint oft die Grenze zwischen sogenannten gesunden und pathologischen Zuständen. Hatte der Rationalismus auf einen Ausschluss des Wahns hingearbeitet, vor allem in seiner offenbaren Form des pathologischen Ausbruchs, so erscheint dieser nunmehr als Extremwert einer Skala, zu der auch das sogenannte normale und gesunde Verhalten gehört: Irrsinn und Vernunft stellen sich als Nachbarn dar. Die Einheit des Ichs scheint künstlich und vom Zerfall bedroht, wie sich vor allem beim Künstler zeigt, der den schöpferischen Kräften der dunklen Seelenregionen verpflichtet ist. Diverse literarischen Autoren legen es auf die Entdifferenzierung zwischen Normalität und Wahn an – oder doch auf die Relativierung der Differenz. Dieses thematische Interesse verknüpft sich mit der kontrastiven Charakteristik von Künstlern und Bürgern (den sogenannten Philistern). Der sogenannte Alltagsverstand erscheint als trivial, die sogenannte Gesundheit als unschöpferisch und borniert, wahrend der Zustand des Wahns der künstlerischen Existenz entspricht. Teilweise in den Spuren älterer Vorstellungsmuster thematisiert die Romantik unter anderem kindliche Traumatisierungen als Auslöser schöpferischer und zugleich quälender Phantasien, wie denn überhaupt die Kindheit das besondere Interesse der Psychologie auf sich zieht. Die literarischen wahnsinnigen Helden stehen im Zwielicht. Einerseits erschließen sich gerade ihnen höhere Dimensionen der Erfahrung, andererseits zerfallen sie mehr denn je mit der Welt und spinnen sich in ihre Eigenwelt aus Träumen, Phantasmen und Visionen ein. Nicht immer ist die synthetisierende Kraft des Ich-Bewusstseins groß genug, um zu verhindern, dass sich das Ich als Folge davon als gespalten erfährt und mit sich selbst zerfällt. Und selbst wenn es sich selbst als Einheit wahrnimmt, erscheint es aus der Außenperspektive vielleicht als jemand anderer als der, den es selbst in sich sieht – und zerfällt als Folge davon noch mehr mit der sozialen Umwelt.