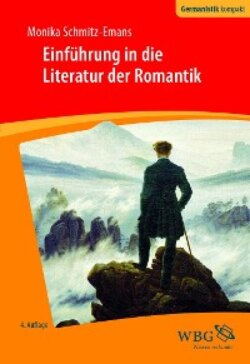Читать книгу Einführung in die Literatur der Romantik - Monika Schmitz-Emans - Страница 23
8. Sprachkonzepte
ОглавлениеSprachmagie
Der menschlichen Wortsprache war seit der Antike ihre Konventionalität und Ferne zu den Signifikaten vorgehalten worden; das „bloße“ Wort erreicht diesem sprachkritischen Ansatz zufolge das jeweils Bezeichnete nicht und hat keine Macht über dieses. Romantische Dichtung orientiert sich, zumal bei Novalis, im Gegenzug hierzu am Ideal magischer Sprachpraxis: Ersehnt wird das Wort, in dem das Wesen der Dinge selbst beschlossen liegt und mittels dessen es beschworen werden kann. A. W. Schlegel charakterisiert die ersehnte Sprache, in welcher der Geist selbst sich offenbaren könne, als „wahre Magie, wo durch die Hilfe unbedeutend scheinender Zeichen die furchtbarsten Geister gebannt werden“ und als „Handhabe für das Universum“ (Berliner Vorlesungen). Eine Definition, so Novalis, sei „ein realer oder generierender Name“, die „reale Definition“ sei „ein Zauberwort“. Programmatisch klingt auch die Notiz: „Jedes Wort ist ein Wort der Beschwörung. Welcher Geist ruft – ein solcher erscheint“ (N II, 523). Novalis und Friedrich Schlegel greifen schon früh auf die Kabbala zurück, um ihre ästhetischen Leitideen zu explizieren. Der Imaginationsprozess wird in Analogie zu kabbalistischen Ideen magischer Evokation gedacht (vgl. FS XVIII, 399: „Der Zweck der Kabbala ist Erschaffung der neuen Sprache; denn diese wird das Organ seyn, die Geister zu beherrschen“). Maßgeblich ist die Idee der Restitution einer magisch-evokativen Ursprache. Auch bei Novalis wird hieran angeknüpft, wie seine Spekulation über eine „Lehre von den Signaturen“ (N III, 268) andeutet und die Wendung von der Schrift als „Zauberey“ (N III, 267) bestätigt: „Der Mensch spricht nicht allein – auch das Universum spricht – alles spricht – unendliche Sprachen“ (N III, 267f.). Kabbalistische Vorstellungen werden auch in Hoffmanns Goldnem Topf reinszeniert, wo der Protagonist Anselmus ein geheimnisvolles Manuskript abschreiben soll, dessen ihm unverständlicher Text in geheimer Korrespondenz zu seinem Leben steht. Die Mahnung seines Mentors Lindhorst, jeder entstellende Tintenklecks werde unausweichlich großes Unglück heraufbeschwören (FN, 225f.), entspricht der Idee einer magischen Korrespondenz zwischen Schrift und Welt, welche durch Schreibfehler gestört werde.
Sprach-Bilder
Verschiedene Autoren vertreten die Idee vom wahrheitsgemäßen und offenbarenden Charakter der Metapher und bewegen sich damit in den Spuren Giambattista Vicos (1668–1744), der die bildhaft-ursprüngliche Ausdrucksweise philosophisch-anthropologisch und kulturhistorisch gerechtfertigt hatte, sowie Herderscher und Hamannscher Auffassungen von der ursprünglichen Bildhaftigkeit sprachlicher Wendungen. Zwischen deren Bilder-Sprache und der Erscheinungswelt selbst wird eine Analogie konstatiert. Die Natur rede, so heißt es etwa bei Friedrich Schlegel, der die poetische Ausdrucksweise damit auf typisch romantische Weise in einer anderen, auf natürliche Weise bedeutsamen figuralen Sprache zu begründen sucht, „in ihrer stummen Bilderschrift eine Sprache; allein sie bedarf eines erkennenden Geistes, der den Schlüssel hat und zu brauchen weiß, der das Wort des Rätsels in dem Geheimnis der Natur zu finden versteht, und statt ihrer, das in ihr verhüllte innere Wort laut auszusprechen vermag, damit die Fülle ihrer Herrlichkeit offenbar werde“ (FS IX, 30). Die These vom fundamental-metaphorischen Charakter aller Sprache liefert der poetologischen Metapherntheorie ein stabiles Fundament. Jedes Idiom sei, so die von Vico, Herder und Hamann inspirierte Überzeugung Jean Pauls, „ein Wörterbuch erblasseter Metaphern“ (JP V, 184). Metaphorischer Vermittlung bedarf einem alten theologisch-mystischen Konzept zufolge vor allem das Übersinnliche, das Transzendente und Göttliche. In der theoretischen Spekulation über die Bedingungen solcher Vermittlung besteht übrigens schon terminologisch kein Konsens; nahe aneinander grenzen wiederum die (andererseits auch oftmals programmatisch gegeneinander abgesetzten) Begriffe der Metapher, der Allegorie und des Symbols, ja der vieldeutige Begriff des „Bildes“ selbst. Die alte Auffassung, dass die ursprungsnahen und darum ausdrucksvolleren Sprachen sich durch einen hohen Grad an Bildhaftigkeit gegenüber den abstrakteren Idiomen der Neuzeit positiv auszeichneten, wird von der romantischen Dichtung zur Prämisse genommen, aber um eine Dimension erweitert: Das „endliche“ Bild soll auf Unendliches verweisen. Das Höchste könne man, so Friedrich Schlegel, „eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch sagen“ (Gespräch über die Poesie, 1800, FS II, 324; in einer anderen Fassung des Textes steht das Adjektiv „symbolisch“, was darauf hindeutet, dass hier nicht mit einer festgefügten Terminologie gearbeitet wird). A. W. Schlegel bevorzugt entschieden den Begriff des Symbolischen: „Wie kann nun das Unendliche auf die Oberfläche, zur Erscheinung gebracht werden? Nur symbolisch, in Bildern und Zeichen. […] Dichten […] ist nichts andres als ein ewiges Symbolisieren“(AWS I, 91).
Wortsprache und andere Sprachen
Zur Erfassung des Wesens von Sprache, ihrer Leistungen und Unzulänglichkeiten, wird diese vorzugsweise von ihren Grenzen her in den Blick genommen, also mit anderen „Sprachen“ als der der Wörter verglichen. Dabei konstatieren die Romantiker teilweise unüberwindbare Differenzen, teilweise halten sie den Wörtern die nonverbalen Ausdruckszeichen aber auch als Muster vor. Als Vergleichsrelate bieten sich zunächst Gesten, Mienen und andere als natürlich geltende Ausdrucksformen lebendiger Wesen an; die englische, französische und deutsche Vorromantik hatte diesen Weg ja bereits gewiesen. In Anknüpfung an die Aufwertung des Gestischen bezeichnet Friedrich Schlegel in einem Athenäumsfragment die „ganze Poesie“ als „pantomimisch“. Darüber hinaus wird die Wortkunst mit anderen Künsten verglichen, vor allem mit den bildenden Künsten. Dass die Poesie „male“, ist auch Jahrzehnte nach Lessing noch ein feststehender poetologischer Topos. Und Jean Paul differenziert in seiner „Vorschule“ zwischen der „plastischen“ Poesie der Griechen, also der Antike, und der der „Neuen“, welche er „romantisch“ und „musikalisch“ nennt (vgl. § 17, JP V, 71–74).
Chiffren
Verglichen wird die Wortsprache ferner mit den mathematischen Chiffren; die „Sprache“ der Mathematik galt schon Franz Hemsterhuis (1721–1790) als vorbildhaft, weil sie gänzlich Produkt und Ausdruck des Geistes sei (Lettre sur I‘homme et ses rapports, 1772). Die mathematischen Gegenstände sind identisch mit der sie ausdrückenden Formel, so wie das Zauberwort mit dem jeweils Benannten innerlich verbunden ist. Novalis begreift die Zahlen als „Erscheinungen, Repräsentationen, katexochin“; in den mathematischen Formeln spiegle sich die Welt selbst, und zwischen Mathematik und Magie bestehe ein innerer Zusammenhang. Mit seiner Analogisierung von Sprache und Mathematik beschreitet Novalis einen Sonderweg der romantischen Sprachreflexion, auch wenn sich ansatzweise verwandte Vorstellungen bei Ritter finden und Friedrich Schlegel, ähnlich wie Novalis selbst, gern mathematische Zeichen als Kürzel in seine eigenen Aufzeichnungen einflicht.
Schlegels Apologie der Unverständlichkeit
Friedrich Schlegel verteidigt das Unverständliche an Texten und betrachtet es als Stimulation zur fortgesetzten Reflexionstätigkeit (FS II, 363–372). Die Reflexionsbewegung kommt Schlegel zufolge niemals an ein Ziel, es wird niemals eine definitive Wahrheit erreicht. Schlegels Apologie der Unverständlichkeit steht in Beziehung zur Idee der Autonomie des literarischen Werkes. Denn Unverständlichkeit bedeutet auch Unerschöpflichkeit des Sinnes. Indirekt ist Schlegels Votum für das „Unverständliche“ auch ein Votum gegen die leicht konsumierbare, auf den Konsens des Publikums setzende und dieses in seinen Vorstellungen bestätigende Unterhaltungsliteratur. Die Autonomie, auf welcher das romantische Kunstwerk beharrt, wird nicht zuletzt als Autonomie gegenüber vorgefertigten Publikumserwartungen konzipiert. Verständlich ist das Triviale, der künstlerische Konsumartikel. Das unverständliche Kunstwerk will über den Verstehenshorizont der Leser hinausgelangen, um ihn zu erweitern.
Aspekte romantischer Sprachtheorie
Seit Herder gilt die Sprache als Ausdruck des „Volksgeistes“ und Grundlage nationaler Kulturen. Als „Muttersprache“ einzelner Menschen und ganzer Völker drückt sie deren Denkweisen aus und prägt ihr Wesen. Dennoch steht die romantische Sprachreflexion vielfach im Zeichen kritischer Erwägungen, insbesondere des kritischen Vergleichs zwischen der konventionellen, in Wissenschaft und Alltagspraxis verwendeten Wortsprache und „anderer“, überlegener Sprachen. Diese Vergleiche bilden – in ihrer unterschiedlichen Akzentuierung – eine Art romantisches Leitkonzept. Ein anderes rekurrentes Thema ist das wechselseitige Bedingungsverhältnis zwischen Sprache und Geist – und zwar sowohl in Akzentuierung der Beziehung zwischen Nationalsprache und Volksgeist, als auch mit Blick auf die Bedeutung der Sprachbildung für das Individuum. In dem Maße, als der konstitutive Anteil des erfahrenden Subjekts an der Struktur der von ihm erfahrenen Welt und an der Bedeutung ihrer Elemente reflektiert wird, rückt die weltgestaltende und welterschließende Funktion der Sprache in den Blick.
Zwischen Mystizismus und historischempirischer Sprachwissenschaft
Empirische und spekulative Vorgehensweisen durchdringen sich in der romantischen Sprachreflexion. Gelegentlich erhebt sich die Spekulation dabei weit über den Boden des empirisch Verifizierbaren. Analogien lautlicher und graphischer Art werden als Argumentationsstütze manchmal selbst dann angeführt, wenn wortgeschichtliche Ableitungen unmöglich sind. Friedrich Rückert hält auf solcher Basis das Deutsche für die lingua idealis (Dissertatio philologico-philosophica de idea philologiae, 1811). Etymologische Studien und Theorien verbinden sich bei verschiedenen Autoren mit der Frage nach einer Ursprache, so bei Friedrich Schlegel, Georg Friedrich Creuzer, Jacob und Wilhelm Grimm, Franz Bopp, Friedrich Rückert, Johann Kaindl und Johann Arnold Kanne. Eine durch die idealistische Philosophie geprägte spekulative Sprachtheorie legt August Ferdinand Bernhardi mit seiner Sprachlehre (1801/03) vor. Sprachwissenschaftliche und mythologische Interessen durchdringen sich im Werk der Brüder Grimm. Hier ist allerdings eine Tendenz zu objektivierenden Verfahrensweisen zu beobachten. Johann Arnold Kannes Erste Urkunden der Geschichte oder allgemeinen Mythologie (1808) stehen im Zeichen des Analogiegedankens. Er will die innere Verwandtschaft der einzelnen Mitglieder der indogermanischen Sprachfamilie bis in die Einzelwörter hinein beweisen. Teilweise sind seine Etymologien recht phantastisch. Modernere Ansätze gelten nicht den Einzelwörtern, sondern den grammatischen Strukturen der verschiedenen Sprachen, die verglichen werden, um Sprachfamilien auszumachen. Mit romantischen Philologen wie Franz Bopp beginnt die Fachgeschichte der modernen vergleichenden Linguistik.
Sprache als transzendentales Apriori
Herders spätere Schriften zur Sprache, insbesondere seine Metakritik (1799) zur Kantischen Kritik der reinen Vernunft (1781), in welcher er Kant vorwirft, die Sprachgebundenheit des Denkens außer Betracht zu lassen, setzen die Grundgedanken seiner Preisschrift über den Ursprung der Sprache (1772) fort. Sprache konstituiert die Wirklichkeit, auf welche sich der Mensch als Subjekt der Erfahrung bezieht, maßgeblich mit und hat insofern den Status einer transzendentalen Instanz im Sinne Kants. Denken und Sprechen sind letztlich identisch. Hamann kritisiert Herders Ursprungsschrift zwar scharf, da er den bloßen Versuch einer Ableitung, also einer „Begründung“ der Sprache durch den räsonierenden Verstand als solchen für verfehlt hält: Sprache ist durch keine reflektierende Instanz hintergehbar. In wesentlichen Punkten berührt sich sein Sprachverständnis jedoch mit dem Herderschen. So insistiert auch Hamann darauf, dass die vom Menschen erfahrene und gedachte Wirklichkeit sprachlich präformiert und strukturiert sei. In der sinnlich-geistigen Doppelnatur der Sprache spiegele und artikuliere sich die analoge Doppelnatur des Menschen. Einflussreich auf die romantische Sprachtheorie wirken sich auch die sprachphilosophischen Konzepte des französischen Illuminaten Claude de Saint-Martin (1743–1803) aus, der die Geschichte des Menschen, auch die seiner Sprache, als Geschichte des Abfalls vom göttlichen Ursprung deutet. Diesem verbunden blieb aber die poetische Sprache. In Zusammenhang damit betont Saint-Martin die magischevokative Kraft des Wortes. In der Dichtung werden die dynamischen und kreativen Kräfte der Sprache in besonderem Maße manifest, und zumal die Metapher besitzt synthetisierende Macht, vermittelt zwischen dem Reich der Wörter und dem der Dinge.
Humboldt
Wilhelm von Humboldt legt das Fundament der modernen Sprachphilosophie. Zu seinen Hauptwerken gehört die posthume Schrift Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (1830–1835). Die Welt ist den sprachlichen Subjekten in den Kategorien der Sprache gegeben; in jeder besonderen Sprache wird Welt auf je besondere Weise in den Gedanken überführt. Grammatik, Morphologie, Syntax und Semantik der Sprache liegen der Organisation und Strukturierung aller Erfahrungsinhalte zugrunde, so dass auch von einer sprachlichen „Zwischenwelt“ gesprochen werden kann, welche sich vermittelnd zwischen Erfahrungssubjekt und Wirklichkeit schiebt. Die jeweilige sprachliche „Weltansicht“ besitzt apriorischen Charakter gegenüber dem einzelnen Denk- und Sprechakt. Wenn Humboldt von der Sprache spricht, so meint er damit kein universales Abstraktum, sondern die jeweils einzelnen Nationalsprachen. Jede besitzt ihre eigene innere Sprachform, die das Denken und Erleben ihrer jeweiligen Sprechergemeinschaft begründet. Insofern die Sprache für Humboldt kein Reservoir fertiger Etiketten darstellt, sondern eine wirksame Kraft zur Aneignung und Strukturierung der Welt, möchte er sie nicht als Ergon („Werk“), sondern als Energeia („Kraft“) begriffen wissen.
Romantische Übersetzungstheorie
Humboldts Sprachkonzept berührt sich in vielen Punkten mitdem Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers (1768–1834) sowie mit den Vorstellungen romantischer Sprachwissenschaftler – wie denen Jacob Grimms (1785–1863) und der Brüder Schlegel. Jeder Sprecher wirkt schöpferisch auf die benutzte Sprache ein. Schleiermacher teilt die Humboldtsche Auffassung, dass die Verschiedenheit der Sprachen nicht primär eine Verschiedenheit der Klänge, sondern eine innerliche sei, und er betont, dass keine Rede, ja kein einzelnes Wort je bruchlos in eine andere Sprache zu übersetzen sei. Dem Problem der Übersetzung und der produktiv-verändernden Leistung des Übersetzenden gilt das besondere Interesse des Hermeneutikers Schleiermacher. Texte, zumal poetische, lassen sich einer weit verbreiteten romantischen Überzeugung nach nie erschöpfend übersetzen.