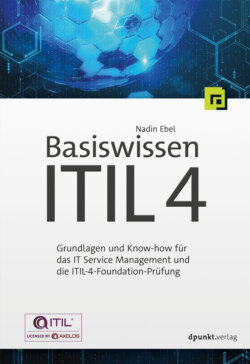Читать книгу Basiswissen ITIL 4 - Nadin Ebel - Страница 73
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.7IT4IT
ОглавлениеIT4IT ist ein wertschöpfungskettenbasierendes Betriebsmodell und eine Referenzarchitektur für die IT, das von der Open Group betreut wird (https://www.open-group.org/it4it).
Auf dem »Open Group London 2014 Event« im Oktober 2014 wurde der Start des »The Open Group IT4IT Forum« angekündigt. IT4IT wurde in den Versionen 1.x bis 2015 in einem Herstellerkonsortium entwickelt, bei dem HPE und Shell die Haupttreiber waren. Danach erfolgte die Übergabe an die Open Group, um Herstellerneutralität zu gewährleisten. Die Version 2.0 wurde durch die Open Group dann im Oktober 2015 veröffentlicht (The Open Group IT4IT Reference Architecture). Die Veröffentlichung der Version 2.1 erfolgte im Januar 2017. Das letzte Update wurde im Mai 2017 durchgeführt.
IT4IT beschreibt, was zum Betreiben der IT als Geschäftseinheit nötig ist (»run the business of IT«). Dies erfolgt über ein »IT value chain-based IT operation model« (siehe Abb. 2–25), das heißt, es wird der Schwerpunkt auf produktionsorientierte End-to-End-Wertschöpfungsketten der IT, die Referenzarchitektur, ein Service-Modell und ein konzeptuelles Datenmodell gelegt. Die IT wird als wertschöpfender zentraler Funktionsbereich einer Organisation angesehen, vergleichbar mit der Produktion in der Industrie. Ähnliches ermöglichen eTOM für die Telekommunikationsbranche, BIAN für die Banken und ARTS für den Einzelhandel.
Abb. 2–25 IT Value Chain (IT4IT)
Die Darstellung der Aktivitäten des Service Provider als Wertschöpfungsketten (value chain framework) bezeichnet die Open Group als IT Value Chain und basiert auf Michael E. Porters Wertkettenmodell. Das von Porter entwickelte Konzept der Wertkette (auch Wertschöpfungskette, Value Chain), erstmals 1985 in seinem Werk »Competitive Advantage« beschrieben, stellt ein Hilfsmittel für die Identifikation wertschöpfungsbezogener Aktivitäten dar (Wertschöpfungsaktivitäten, siehe auch Abschnitt 1.2.1). Im IT4IT-Standard werden Aktivitäten wie bspw. Planung, Entwicklung, Bereitstellung oder Support als Primäraktivitäten angesehen, während bspw. Personal, Legal, Governance oder Finanzen als unterstützende Aktivitäten eingeordnet werden.
Die Wertketten eines Unternehmens sind mit den Wertketten von Lieferanten und Kunden verknüpft und bilden so ein Wertschöpfungskettensystem bzw. ein Wertschöpfungsnetzwerk.
Wertströme umfassen die Schlüsselaktivitäten der IT Value Chain, innerhalb derer Wertschöpfung erzeugt oder dem Service auf seinem Weg der Wertschöpfungskette entlang hinzugefügt wird (siehe Abb. 2–26).
Abb. 2–26 IT4IT Value Streams (IT4IT)
IT4IT beschreibt vier Wertströme, über die innerhalb seines Lebenszyklus ein Wertbeitrag für den Service erfolgt. Ein Service wird über die Wertströme entworfen, logisch zur Verfügung gestellt und irgendwann instanziiert (bestellt). Das darunterliegende Datenmodell ist durchgängig über alle Wertschöpfungsketten der Wertströme dasselbe und unterstützt diese:
Strategy to Portfolio (S2P):In diesem Wertstrom geht es um die Ausrichtung und Unterstützung des Business durch die IT und dessen strategische Entscheidung, um bspw. das Portfolio mit den Services auf die Businessbedürfnisse auszurichten (»Business-/IT-Alignment«) und dementsprechende Entscheidungen zu Investitionen zu treffen. Die strategischen Entscheidungen der IT sollten sich in einem businessgeprägten Portfolio widerspiegeln. Ziel ist es, dass die IT Services den zu erzielenden Outcome für das Business bzw. die Kunden ermöglichen.
Requirement to Deploy (R2D):Über diesen Wertstrom werden bspw. Projekte, Tätigkeiten wie Anforderungsaufnahme, Service Design, Entwicklung, Build und Test sowie Deployment realisiert (siehe Abb. 2–27). Die Anforderungen von Kundenseite sind zu berücksichtigen und vorhersagbare, effiziente Ergebnisse von hoher Qualität bereitzustellen. Dies korrespondiert mit der Arbeitsweise in der IT, die bspw. Standardisierung und Wiederverwendung, Flexibilität, Schnelligkeit und eine gute Zusammenarbeit innerhalb der IT und mit den Lieferanten/Herstellern als wichtig erachtet und methodisch abbildet. Dazu gehört der geeignete Einsatz sowohl von traditionellen als auch neuen Methoden für die Erzeugung von Services, auch unter den Gesichtspunkten von Sourcing und der Integration von Lösungen (ITIL, COBIT, agile Methoden, Wasserfall etc.). Wichtig ist, dass das Service-Release die Businesse-Erwartungen erfüllt und den Warranty-Anforderungen (Sicherheit, Verfügbarkeit, Performance etc.) entspricht.
Abb. 2–27 Aktivitäten der IT Value Chain Requirement to Deploy (in Anlehnung an IT4IT)
Request to Fulfill (R2F):Über diesen Wertstrom soll ein nachfrageorientiertes Engagement-Modell über einen integrierten, zielgruppengerechten Service-Katalog angeboten werden, das die IT im Sinne eines Service-Brokers bereitstellt. Zahlreiche Leistungen werden von unterschiedlichen externen Lieferanten für Produkte und Services integriert, was einer Multi-Sourcing-Steuerung bedarf.Die Services werden nach Anforderung für die Anwender zur Verfügung gestellt, und die Service-Nutzung wird gemanagt. Dazu gehören auch die Informationsbereitstellung (also Knowledge Management) zu den Services und die spätere Verrechnung der Service-Kosten auf Basis der gemessenen Service-Nutzung.Die Einträge im Service-Katalog sollten wertschöpfungsorientierte Services darstellen, die auf Service-Modellen beruhen, instanziiert und angeboten werden können. Sowohl die Anforderung über den Katalog (z.B. über ein Self-Service-Portal) als auch die Bereitstellung sollten konsistent erfolgen und so weit wie möglich automatisiert werden. Wichtig ist, dass der angeforderte und genutzte Service den Anforderungen entspricht.
Detect to Correct (D2C):Im Rahmen dieses Wertstroms erfolgen in der Produktion u.a. die Handhabung von Events, Störungen, Problemen, Changes sowie das Monitoring und das Configuration Management. Hier geht es auch um ihr Zusammenspiel im Betrieb und die Berücksichtigung der verschiedenen Stakeholder, um Probleme im Betrieb zu lösen. Zu den Stakeholdern gehören auch die verschiedenen Drittanbieter in einer Multi-Sourcing-Umgebung mit den unterschiedlichen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten, die im Betrieb über Services, Technologien und Prozesse beteiligt sind.Im Fokus steht die Sicherung des kontinuierlichen Betriebs der IT Services für das Business.Der angestrebte Nutzen liegt in der Vermeidung von Betriebsunterbrechungen im Sinne einer Risiko-Reduzierung, der rechtzeitigen Entdeckung, Priorisierung und Lösung von Problemen zusammen mit den beteiligten Parteien. Auch die kontinuierliche Verbesserung hat einen Platz.
Die Referenzarchitektur (siehe Abb. 2–28) erlaubt es, die IT als »Business Innovation Center« zu positionieren und einen End-to-End-Business-Service-Lebenszyklus für bestehende und zukünftige Rahmenbedingungen zu bilden. Die Referenzarchitektur bildet die Aktivitäten der IT Value Chain auf vier Elemente ab: Service Model, Information Model, Functional Model und Integration Model. Dies macht den sogenannten präskriptiven Charakter des Standards aus.
Abb. 2–28IT4IT Reference Architecture – Level 1 in Verbindung mit dem IT4IT Service Model (IT4IT). Der Übersicht halber verweisen nicht alle Service-Status des Modells auf die Referenzarchitektur.
Die wesentlichen Informationen des IT-Management-Ökosystems sind in den Modellen der Referenzarchitektur abgebildet und beschrieben. Sie liefern konkrete und detaillierte Angaben, wie die Integration der einzelnen Funktionen und Daten zu erfolgen hat. Jeder IT Value Stream nimmt Bezug auf mindestens ein Element des Service Model und die jeweilige Konstellation der Datenobjekte (Information Model) und funktionalen Komponenten (Functional Model, »Building Blocks«), die dies unterstützen. Jeder Value Stream nutzt bzw. erzeugt Daten. Das Information Model berücksichtigt die Datenobjekte und ihre Beziehungen.
IT4IT beschreibt unterschiedliche Ebenen, die sich von der Referenzarchitektur der Ebene 1 über die Ebene 2 der einzelnen Value Streams erstreckt. Jede funktionale Komponente der Ebene 2 wird auch noch einmal mit ihren Eingangs- und Ausgangsobjekten separat dargestellt. Die Beschreibung reicht bis hin zu einer herstellerunabhängigen Architektur, die über eine andere Notation mit Hilfe von ArchiMate und UML die Datenobjekte und ihre Attribute auf einer tieferen Detailebene beschreiben (Level 3: Vendor-independent Architecture). Die Beschreibung von IT4IT endet mit Ebene 3.
Die darunterliegenden Ebenen stellen weitere spezifische Details bereit und eignen sich für die Entwicklung von Implementierungsplänen oder Produkt-Design (Level 4: Vendor-specific Refinement Architecture und Level 5: Solution Architecture); sie unterliegen nicht der Steuerung von IT4IT. Ebene 4 kann von den Herstellern herstellerspezifisch ergänzt werden. Eine beispielhafte und tatsächlich eingesetzte Architektur wird in Ebene 5 als Lösungsarchitektur beschrieben, IT4IT gibt hier allerdings nur noch die Notation vor.
Mit der Veröffentlichung »IT4IT for Managing the Business of IT – A Management Guide« stellt die Open Group einen Leitfaden für die Implementierung von IT4IT im Sinne einer Transition zur Verfügung.
Eine IT4IT-Personenzertifizierung wird über die von der Open Group akkreditierten Schulungsunternehmen angeboten. Die Lernziele der IT4IT-Foundation-Zertifizierung lauten: Wissen und Verständnis der Terminologie, Struktur und Konzepte der IT4IT-Referenzarchitektur sowie der grundlegenden Prinzipien der Referenzarchitektur und der IT Value Chain.