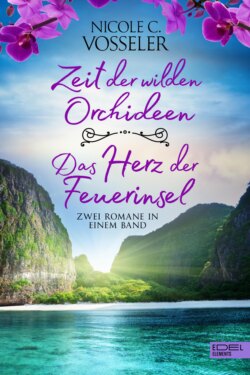Читать книгу Zeit der wilden Orchideen / Das Herz der Feuerinsel: Zwei Romane in einem Band - Nicole-C. Vosseler - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
___________
ОглавлениеIn reinstem Azurblau leuchtete der Morgenhimmel, so strahlend, dass dagegen die Farben des Meeres zu Jadegrün und Lavendel verblassten. Heitere Wolkenbänke kräuselten sich am Horizont, und das klare Licht hatte noch nicht die diesige Schwere der Mittagszeit.
»Das war doch heute schon ganz gut«, lobte Paul Bigelow, noch unrasiert zu dieser frühen Stunde. Schwungvoll stieg er von seinem braunen Wallach ab, um Georgina aus dem Sattel der falben Stute zu helfen. Kräftig packte er dabei zu, und kräftig war auch sein Geruch, wie schwerer Ackerboden und warmes Tierfell. »Sie machen große Fortschritte!«
Jati lenkte sein Pony ein Stück weit den Strand hinunter, ließ sich von seinem Rücken gleiten und hockte sich in den Sand, wo er herzhaft gähnte und dann müßig auf das Meer hinaussah.
Paul Bigelow hatte Wort gehalten, sich so lange hartnäckig gezeigt, bis Georgina es nicht länger übers Herz gebracht hatte, ein ums andere Mal seine Einladung auszuschlagen. Er war ein guter Reiter, der sicher im Sattel saß und sich in kraftvoller Harmonie mit dem Pferd unter ihm bewegte, in Stiefeln und engen Reiterhosen, die seine starken Oberschenkelmuskeln betonten, ein goldenes Vlies im Ausschnitt seines aufgeknöpften Hemdes.
Lachend strich sich Georgina Haarsträhnen, die sich gelöst hatten, hinter die Ohren und rieb sich mit dem Ärmel ihres Sommerkleids über das verschwitzte Gesicht.
»Meine Leidenschaft wird es wohl trotzdem nicht werden!«
Der malvenfarbene Baumwollstoff klebte überall auf ihrer Haut, obwohl die Luft angenehm leicht war und eine kräftige Brise über den Strand blies; es war anstrengend, sich im Sattel in der Balance zu halten, und nur langsam wich das Ziehen und Brennen aus ihren Muskeln.
»Das muss es auch nicht«, erklärte Paul Bigelow gelassen. »Mir genügt es schon, wenn es keine allzu große Qual für Sie ist und Sie vielleicht doch eines Tages ein wenig Vergnügen daran finden können.«
Er machte sich am Sattel zu schaffen.
»Ich genieße unsere morgendlichen Ausritte jedenfalls sehr.«
Verlegen wandte sich Georgina ab.
»Würden Sie vielleicht einmal mit mir ausgehen?«
Georginas Kopf flog herum.
»Mit dem Einverständnis von Mister Findlay natürlich«, schob Paul Bigelow hastig nach.
Georgina dachte an die Teekränzchen von Tante Stella, an die Abendgesellschaften am Royal Crescent. Ein Geschicklichkeitsspiel, dessen Regeln man ihr zwar beigebracht hatte, das sie aber nicht beherrschte. In dem sie überdeutlich zu spüren bekam, dass sie ihre Kindheit in einer vollkommen anderen Welt verbracht hatte, immer einen Taktschlag zu langsam, einen Atemzug zu schnell. Das Unausgesprochene hinter dem Gesagten entging ihr oftmals, und zuweilen war sie um die richtigen Worte verlegen, als spräche sie nicht dieselbe Sprache wie ihr Gegenüber.
Unwillkürlich zog sie die Schultern hoch.
»Sagen Sie jetzt nicht, Sie machen sich auch nichts aus gesellschaftlichen Anlässen!«, rief Paul Bigelow mit gespielter Strenge und lachte auf. »Sie sind so jung, Sie sollten die Nächte durchtanzen!«
»Ich habe kein allzu großes Talent fürs Tanzen.«
Georgina senkte den Kopf und vergrub die Zehen im Sand. Mangels Reitstiefeln hatte sie anfangs halbwegs bequeme Schuhe zu diesen Ausritten angezogen, doch nachdem Jati immer wieder umdrehen und einen verlorengegangenen Schuh auflesen musste, war sie dazu übergegangen, barfuss in den Sattel zu steigen.
»Ich fürchte, ich habe für rein gar nichts ein Talent.«
Anders als Maisie, die hervorragend Klavier spielte, begeistert malte und zeichnete und mit buntem Garn kleine Kunstwerke schuf, waren Georginas Fertigkeiten allenfalls bescheiden zu nennen; vielleicht, weil sie nicht von klein auf daran herangeführt worden war, vielleicht, weil ihr die Leidenschaft dafür fehlte.
»Und wenn schon!«, kam es entschieden von Paul Bigelow, und ein Lächeln huschte über Georginas Gesicht. »Allerdings rätselt die halbe Stadt über Miss Findlay, die schon fast ein halbes Jahr hier ist, die aber noch niemand gesehen hat. Die womöglich an einer mysteriösen Krankheit leidet, einen Klumpfuß hat, ein Feuermal im Gesicht oder anderweitig entstellt ist. Manche halten es auch für denkbar, dass Sie nichts anderes sind als ein Gespenst, das L’Espoir heimsucht.«
Ein Seitenblick auf ihn bestätigte ihr, dass er sie aufzog, und sie musste lachen. Schließlich saß sie jeden Sonntag neben ihrem Vater und Paul Bigelow in einer der Kirchenbänke von St. Andrew’s und reichte den Gentlemen und den wenigen Ladys, mit denen die beiden nach dem Gottesdienst ein paar Worte wechselten, die Hand. Wie Gouverneur Butterworth nebst seiner stattlichen Gattin oder Doktor Oxley und seine Frau Lucy mit ihren vier Kindern, von denen Isabella, die Älteste, nur drei Jahre jünger war als Georgina. Der Doktor bedachte sie stets mit versonnenen wie melancholischen Blicken, weil er sich noch sowohl an die neugeborene Georgina erinnerte als auch daran, Joséphine Findlay auf ihrem letzten Weg begleitet zu haben. Mr Guthrie von Guthrie & Company oder Mr Little, der das kleine Kaufhaus von Little, Cursettjee & Co. am Commercial Square führte und viele seiner Waren von Findlay & Boisselot bezog.
»Ihnen ist hoffentlich bewusst, welch bittere Enttäuschung Sie all den vielen Junggesellen Singapurs bereiten. Die verzehren sich doch danach, einmal eine hübsche junge Lady zu Gesicht zu bekommen, ihr vielleicht gar den Hof zu machen. Wobei ich es durchaus genieße, um das Privileg beneidet zu werden, mit Ihnen unter einem Dach zu leben.«
Georgina blinzelte in die Sonne und hatte Mühe, ihr Lächeln, das sich jäh ausgedehnt hatte, wieder zurückzudrängen. Falls ihr Vater seinen Untermieter tatsächlich darum gebeten hatte, sich nach einem anderen Quartier umzusehen, deutete bislang jedoch nichts darauf hin, dass Paul Bigelow in Bälde L’Espoir den Rücken kehren würde. Nach wie vor bewohnte er die beiden Zimmer mit eigenem Bad auf der anderen Seite des Stockwerks und bewegte sich durch das Haus, als wäre es seines, erhellte es mit seiner gutgelaunten Präsenz und brachte Georgina oft zum Lachen.
»Werden Sie wenigstens darüber nachdenken, ob Sie einmal mit mir ausgehen?«
Georgina nickte. »Das mache ich.«
»Schön. Ich freue mich darauf«, sagte er, als hätte sie bereits zugestimmt.
Seine Augen, blau wie der Himmel über ihnen, funkelten, bevor er sie auf das Pferd richtete und dessen Flanke zu streicheln begann.
»Wissen Sie«, sagte er leise, »ich mache mir Gedanken um Sie, Miss Findlay. Ob Sie sich nicht sehr allein fühlen. Ich frage mich, wie Ihre Tage aussehen, während Mister Findlay und ich im Kontor sind. Wie es für Sie sein muss, den lieben langen Tag allein im Haus, nur von Dienstboten umgeben. Die für Sie etwas wie Familie sein mögen, aber doch ihrer Arbeit nachgehen müssen, während Sie ganz sich selbst überlassen bleiben.«
»Ich bin gern allein«, verteidigte sich Georgina mit einem Anflug von Trotz.
Er warf ihr einen schnellen Blick zu, und sein Mund krümmte sich zu seinem schelmischen Lächeln.
»Damit Sie heimlich schwimmen gehen können?«
Georgina erstarrte, und er zuckte mit einer Schulter.
»Ich bin zwei oder drei Mal früher nach Hause gekommen und habe zufällig gesehen, wie Sie sich ins Haus zurückgeschlichen haben. Tropfnass.« Sein Lächeln bekam etwas Herausforderndes. »Was mich zu der Frage bringt, was sich wohl in diesem verwilderten Winkel des Gartens verbirgt, der auf Sie eine so starke Anziehungskraft ausübt.«
Georginas Miene verfinsterte sich.
»Das geht Sie nichts an! Das ist mein Platz«, fauchte sie ihm entgegen, ihre Stimme wie ein scharfes Messer, das jedoch an ihm abprallte.
»Ah, eine Frau mit Geheimnissen.« Er legte die Schläfe gegen den Pferdeleib und sah Georgina an. »Das gefällt mir«, murmelte er, ein tiefes Vibrieren in seiner Stimme, bevor er sich wieder aufrichtete. »Ich lasse Ihnen natürlich Ihre Geheimnisse. Und Ihr Versteck.«
Georgina drehte ihm den Rücken zu. Die Arme um sich geschlungen und das Kinn vorgeschoben, starrte sie aufs Meer hinaus.
Irgendwo dort draußen, in der weiten Bläue, kreuzte Raharjo auf seinem Schiff umher. In einem Labyrinth aus von Dschungeln bedeckten Inseln, von fremdartigen Völkern bewohnt.
Das Verlangen, in die Wellen hinauszuwaten und sich ihnen zu überlassen, das Wasser mit ihren Armen und Beinen zu teilen und sich von ihm tragen zu lassen, war beinahe übermächtig. Wenn sie im Meer schwimmen ging, wurden nicht nur Erinnerungen an die Tage mit Raharjo an den Stränden von Serangoon wach; jede Welle, die auf ihren Körper traf, konnte dieselbe sein, durch die der Kiel von Raharjos Schiff irgendwann zuvor gepflügt, in der er selbst geschwommen war.
Der Wind, der von Westen kam, kühlte ihr das erhitzte Gesicht, und stumm bat Georgina diesen Wind, bald zu drehen und ihren Selkie zu ihr zurückzubringen.
Georgina war immer gern allein gewesen, selbst unter anderen Menschen.
Sie zog es vor, still zu sein. Zu beobachten, zuzuhören, früher oder später in diese Welt in ihrem Inneren hinabgezogen zu werden, in der sie Formen schmecken und Farben riechen konnte. In der sie die Sprache der Tiere verstand und Bäume und Flüsse beseelt waren und Steine atmeten. Eine Welt, die sie an der Hand ihrer Mutter mit den Märchen und Legenden aus der Provence, aus Madras, Maharashtra und Bengalen entdeckt hatte und die ihr nach dem Tod Mamans ein sicherer Hort geworden war. Diese Welt, an deren Küsten die Wellen des Ozeans brandeten, der die Heimat der Orang Laut war.
Raharjo hatte ihr Alleinsein verändert.
Nicht nur, dass sie seine Nähe, seine Stimme vermisste, seine Küsse, die Wärme seiner Haut. Eine Gier nach mehr und immer mehr hatte er ihr hinterlassen, die sie verwirrte. Einen Traum von einem Leben, das sie sich nur schemenhaft ausmalen konnte. Der ihr Angst machte, weil er so vage, so ungreifbar war, nichts als ein Gefühl tief in ihrem Bauch; ein Sehnen, das gewaltsam an ihr zerrte und sie rastlos machte. Als riefe das Meer, das Raharjo stets aufs Neue fortlockte, nun auch nach ihr.
Traust du dich zu lieben?, rief es ihr zu. Traust du dich zu leben?
Ein gläserner Himmel wölbte sich hoch oben über dem Garten. Der auffrischende Wind zerzauste die Baumkronen, hinter denen sich schon die grauen Schlieren regenbeladener Wolken abzeichneten.
Angespannt kaute Georgina auf ihrer Lippe, während sie Ah Tong dabei zusah, wie er die welken Sternchen aus den leuchtend roten und grellrosafarbenen Blütentrauben der Hecken aus Jejarum, der Dschungelflamme, pflückte.
»Hast du was auf dem Herzen, Ay … Miss Georgina?«
Georgina konnte sich nicht daran erinnern, dass Ah Tong jemals Hast an den Tag gelegt hatte, wenn er im Garten seiner Arbeit nachging. In sich ruhend und mit feierlicher Hingabe jätete, harkte, säte, pflanzte, mähte und sägte er. Ein Priester, der in diesem grünen, verschwenderisch mit Blüten geschmückten Tempel seine heiligen Handlungen vollzog, zu Ehren einer Göttin der Schönheit und Fruchtbarkeit. Als wäre er stets mit sich und seiner Welt im Reinen.
»Bist du glücklich, Ah Tong?«, wisperte sie.
»Oh ja.« Ohne auch nur einen Moment zu überlegen, ohne seinen Blick von den üppigen Blütenkugeln zu lösen, nickte er. »Ich bin ein sehr glücklicher Mann, Miss Georgina. Die Götter haben es gut mit mir gemeint.«
Er ließ eine Handvoll der aussortierten Blüten fallen, zupfte ein gelbes Blatt aus dem Laub und noch eines, widmete sich dann der nächsten Blütentraube.
»Ich komme aus einer sehr armen Gegend in Fukien. Wir waren zu viele Kinder für das kleine Reisfeld meines Vaters und das Gemüsegärtchen meiner Mutter. In schlechten Jahren fehlte es uns an allem, und wir litten Hunger. Zwei meiner Brüder starben, und meine Eltern mussten meine drei Schwestern verkaufen. Als ich alt genug war, bin ich ans Meer, um Arbeit zu finden. Und da war ein Mann, der Leute für Singapur gesucht hat. Als Coolies. Ich war stark, aber nicht schnell genug und bekam viel Prügel deshalb. Einmal hat der Tuan das mitangesehen und mich gefragt, ob ich etwas von Pflanzen verstehe.«
Ah Tong musterte die Hecke, suchte jeden der Blütenbälle nach einem welken Blättchen ab, das er vielleicht noch übersehen hatte, und nickte dann vor sich hin.
»So kam ich hierher.« Er bückte sich nach dem Rechen, um die verblühten Sternchen im Gras zusammenzuharken.
»Und schau mich heute an, Miss Georgina. Ich habe eine bessere Arbeit, als ich mir je hätte träumen lassen, und werde gut dafür bezahlt. Ein behagliches Heim, das mich nichts kostet. Ich bekomme reichlich zu essen und kann Geld für meine alten Tage zurücklegen. Und dazu hat mir der Himmel noch eine gute Frau geschenkt.«
Wie auf Geheiß durchbohrte Cempakas Keifen die Stille im Garten, die Rechtfertigungen Kartikas, obwohl ebenfalls laut vorgebracht, kaum mehr als das Summen eines Insekts dagegen.
Um Georginas Mund zuckte es, und auch Ah Tong entblößte seine schiefen Zähne zu einem Grinsen.
»Ich hatte vergessen, den Himmel auch darum zu bitten, sie soll sanftmütig und fügsam sein.« Er gluckste, bevor er Georgina ernst ansah. »Cempaka ist mir wahrlich eine gute Frau. Und glaub mir, tief in ihrer Brust schlägt ein gutes Herz.«
Georgina verschränkte die Arme; es fiel ihr schwer, das zu glauben, heute genauso wie früher, als Kind.
»Siehst du, Miss Georgina … Manche Pflanzen können nur dann blühen, wenn sie Dornen austreiben. Weil diese Dornen die Pflanze davor schützen, verletzt zu werden und einzugehen. So ist es mit Cempaka. Sie spricht nicht viel über früher, aber ich weiß, dass sie ein schweres Leben voller Armut und Leid gehabt hat, bevor sie hierher kam.« Ein Schatten legte sich auf Ah Tongs Gesicht. »Gewiss, vollkommen wäre mein Glück, wenn uns Kinder vergönnt gewesen wären.« Seine Miene hellte sich auf. »Aber dafür warst du ja da. Ein liebes Mädchen und so lebhaft, dass wir alle hier im Haus etwas von dir abhaben konnten.«
Mit zusammengezogenen Brauen schüttelte er Blüten aus den Zinken des Rechens, pflanzte ihn dann in den Boden und stützte sich darauf ab.
»Und für uns alle war es schwer mitanzusehen, wie die Mem so krank wurde und dann jeden Tag schwächer. Als ob ein böser Geist sie von innen her auffraß. Aber für niemanden war es schwerer als für den Tuan.«
Seine schmalen Augen wanderten durch den Garten, während seine Brauen sich lockerten und wieder verkniffen.
»Manchmal denke ich, er gibt sich die Schuld daran. Weil er sie hierhergebracht hat. Weil er nichts finden konnte, um sie zu retten. Nichts, was der Doktor ihr gab, und nichts an Kräutern und Wurzeln, die ich in der Stadt kaufte.«
Seufzend fuhr er fort, mit den Zinken durch das Gras zu fahren.
»Er ist ein guter Tuan, nach wie vor. Aber er hat sein Herz mit seiner Mem begraben.« Er warf ihren einen kurzen, weichen Blick zu. »Und für niemanden dauert mich das mehr als für dich, Miss Georgina.«
Georgina dachte an ihren Vater, der ebenso einer undurchdringlichen Dornenhecke glich. Und die Angst, das Meer könnte sich unter einem Sturm aufbäumen und Raharjo verschlingen, presste ihr den Atem aus der Lunge; sicher würde auch sie zu einer Dornenhecke werden, sollte ihm je etwas zustoßen, sie ihn niemals mehr wiedersehen.
»Wie könnte man danach auch einfach weiterleben?«, hauchte sie.
»Man muss dankbar sein für das, was einem die Götter geschenkt haben«, sagte Ah Tong. »Bevor sie einem das genommen haben, was einem das Liebste ist. Dankbar auch für die kleinen Dinge.«
Er bückte sich und klaubte eine Blüte des Kemboja auf, die der Wind durch den Garten getragen hatte; frisch vom Baum gefallen, war sie noch reinweiß, mit leuchtend gelber Mitte.
»Das lerne ich hier jeden Tag. Dankbar zu sein für das, was mir zuteilgeworden ist. Dankbar für die Schönheit, die mich umgibt.« Er verzog das Gesicht. »Vielleicht ist das eine Gabe. Vielleicht muss man es auch einfach nur versuchen. Unsere Mem konnte es, bis zu ihrem letzten Tag auf Erden. Cempaka kann es nicht. Genauso wenig wie der Tuan.«
Lächelnd hielt er Georgina die Blüte hin. »Und dabei hat ihm die Mem doch eine Tochter hinterlassen, für die er jeden einzelnen Tag dankbar sein müsste.«
Der Palanquin rumpelte an der säulenumstandenen Kirche der winzigen armenischen Gemeinde vorüber und dann weiter die Steigung hinauf. Jati hatte den Wagen kaum am Fuß des Hügels zum Stehen gebracht, als Georgina die Tür aufriss, ihre Röcke zusammenraffte und heraussprang.
»Wird nicht lange dauern«, rief sie. »Ich bin bald zurück!«
Jati grummelte etwas Unverständliches in sich hinein, hin- und hergerissen, ob es nicht seine Pflicht war, sich Miss Georgina als Geleitschutz anzudienen oder ob er doch lieber auf Pferd und Wagen achtgeben sollte.
Argwöhnisch linste er auf das eingezäunte Gelände hinunter, das um diese Tageszeit verlassen dalag, aber man wusste schließlich nie. Denn in den langgestreckten Bauten mit Walmdach waren die indischen Sträflinge untergebracht, die jeden Morgen vor Sonnenaufgang in Kolonnen ausschwärmten und irgendwo in der Stadt ihr Tagwerk verrichteten. Schon von Weitem waren dann die schwermütigen Gesänge zu hören, die ihre Handgriffe begleiteten, wenn sie den oberen Lauf des Singapore River begradigten oder den unteren von angeschwemmtem Sand und Schlamm freihielten. Wenn sie unter dem Kommando ihres Aufsehers ein neues Haus errichteten und mit Chunam verputzten, dieser eigentümlichen Mischung aus Eiklar, Kokosfasern, grobem Zucker und Muschelkalk, die den Häusern Singapurs ihr unverkennbares strahlendes Weiß und ihre glänzend polierte Oberfläche verlieh.
Nicht weniger sorgenvoll beobachtete Jati den Himmel, der sich finster und ächzend auf die Insel niederwalzte und die Luft zu einer klebrigheißen Masse zusammenpresste, unbewegt von den Windstößen, die zischelnd und raschelnd durch Baumkronen und Gräser huschten wie geisterhafte Wesen.
Jati schauderte. Nicht ohne Grund nannten die Malaien den Hügel, der für die Briten Government Hill hieß, Bukit Larangan. Verbotener Hügel.
»Kein guter Tag, um die Toten zu besuchen«, knurrte er vor sich hin.
Mit einem tiefen Seufzen ergab er sich in sein Schicksal und behielt mit Leidensmiene sowohl die Umgebung des Wagens im Auge als auch die schlanke Gestalt von Miss Georgina, die hügelan stapfte.
Einen Korb aus geflochtenen Bananenblättern in den Händen ging Georgina durch den Torbogen in der roten Backsteinmauer. Ratlos ließ sie ihre Blicke über den Garten aus Granit und Marmor schweifen, wanderte dann ziellos zwischen den Obelisken, Grabsteinen und Statuen umher; im Vorübergehen entzifferte sie die Inschriften, von denen manche sich bereits aufzulösen begannen.
Seeleute lagen hier begraben, George Coleman, der irische Architekt, der Singapur seinen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt hatte, und Kaufleute und Angestellte der Verwaltung in Bengalen. Und ihre Frauen, viele davon nur wenige Jahre älter als Georgina, oft zusammen mit ihren Kindern.
So viele Kindergräber waren es.
Eine kleine Kate, nur sieben Tage alt. John, zehn Monate und neunzehn Tage. Zwei Schwestern, Laura und Lorena, vier Jahre die eine, vier Monate die andere, innerhalb weniger Wochen nacheinander gestorben. Zwei kleine Töchter der Oxleys.
Steinerne Zeugnisse dafür, wie zerbrechlich das Leben in Singapur war. Welches Glück Georgina gehabt hatte.
Ihr Blick fiel auf einen Engel aus Marmor, der auf der Kante eines Grabsteins saß und traurig auf die Inschrift zu seinen Füßen hinunterblickte; ihr Herz machte einen Sprung, und ihre Schritte beschleunigten sich.
Georgina wusste nicht, ob sie schon einmal hier gewesen war, davon erzählt bekommen oder davon geträumt hatte; ihre Erinnerungen an die Zeit nach dem Tod und dem Begräbnis ihrer Mutter waren nebelhaft und verschwommen, und dennoch glaubte sie diesen Engel wiederzuerkennen. Während Moos und gelbschuppige Flechten die anderen Grabsteine überzogen, schimmerten Engelsfigur und Steinplatte reinweiß wie ein Stück Singapur. Jemand musste viel Zeit und Sorgfalt darauf verwenden, das Grabmal sauber zu halten, Ah Tong vielleicht.
Etwas in dem feinen Marmorgesicht ähnelte den ebenmäßigen, klaren Zügen ihrer Maman, aber Georgina war nicht sicher, was es war. Sie wünschte, es hätte damals schon die Erfindung der Daguerreotypie gegeben, diesen sepiagetönten Spiegel der Erinnerung, oder wenigstens ein Portrait von Maman in Öl oder Kreide. Doch außer einem Gemälde im Haus von Onkel Étienne, das die gesamte Familie Boisselot vor einer grünen Flusslandschaft mit Tempel zeigte, zu einer Zeit entstanden, als Maman selbst noch ein Kind gewesen war, hatte Georgina kein Bildnis ihrer Mutter. Nur das Abbild in ihrem Gedächtnis, viel zu schnell vom Fluss der Zeit abgeschliffen und ausgewaschen.
Unter einem heranrollenden Donner ging Georgina in die Knie, stellte den Korb ab und fuhr mit zitternden Fingern die goldenen Lettern nach.
In seligem Angedenken an Joséphine Aurélie FINDLAY née Boisselot Geliebte Ehefrau von Gordon Stuart Findlay Schmerzlich entbehrte Mutter von Georgina India Findlay Gestorben am 27. Oktober 1837 im Alter von 33 Jahren und 4 Monaten
Beschützt und sicher vor Schmerz und Sorge
Georginas Brust quoll über von all den Dingen, die sie ihrer Mutter anvertrauen wollte, und doch brachte sie kein Wort heraus; nicht einmal die Gedanken für ein stummes Zwiegespräch brachte sie zusammen. Alles in ihr tat weh; in ihrem Gesicht zuckte es, und die ersten Tränen liefen ihr über die Wangen.
Aufschluchzend klaubte sie ein paar Blüten aus dem mitgebrachten Korb und legte sie auf das Grab, doch der Wind trug sie sogleich mit sich fort. Die nächste Bö preschte heran, und beide Hände voll mit wächsernen, süß duftenden Kembojas in Weiß und Rosa erhob sich Georgina. Der Wind zerwühlte ihre Röcke und ihr Haar; ein Blitz blendete sie, der darauffolgende Donner machte ihr Gänsehaut, und sie öffnete die Finger. Ein Wirbel aus Blüten umtoste sie, bevor der Wind die Kembojas in alle Richtungen blies und Georgina den Atem nahm.
Keuchend stand sie da, am Grab ihrer Mutter, Singapur zu ihren Füßen. Ein sorgsam bestelltes Feld aus weißen Häusern unter roten und braunen Dächern, die Türme der katholischen und der armenischen Kirche und von St. Andrew’s wie Wegweiser auf den Pfaden durch dieses Feld. Der aufkommende Sturm pflügte durch das dichte Grün der Stadt, schüttelte Baumriesen, zerzauste die Palmen und brachte das Meer zum Kochen.
Blitz und Donner begannen miteinander zu wetteifern, Regen stürzte in kräftigen Bächen vom Himmel. Georgina schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken, und Regentropfen mischten sich mit ihren Tränen.
Sie spürte, wie lang und stark ihre Wurzeln waren und wie tief sie in den roten Boden der Insel hinabreichten, den der Regen unter ihren Füßen aufweichte. Gier stieg in ihr auf, gewaltig und himmelsstürmend, danach, das Leben mit beiden Händen zu packen und in sich hineinzuschlingen, ohne Angst vor Reue oder Schmerz, um auch ja nicht nur den kleinsten Tropfen Glück zu vergeuden.
Wie ein Otter schüttelte sie sich, aus purer, übersprudelnder Lebensfreude, raffte ihre Röcke und rannte zwischen den Gräbern hindurch den Hügel hinab, durch hoch aufspritzenden Schlamm und durch den Sturm, der fauchend über die Insel fegte und ihr Herz fröhlich springen ließ.
Der Sturm, der an diesem Oktobertag über Singapur wütete, hatte die Unruhe aus Georginas Gliedern und aus ihrer Seele geschüttelt. Gelassen und heiter trieb sie durch die graue, nasse Zeit des Nordostmonsuns, der die Straßen der Stadt flutete und auch vor den Gartenmauern der Beach Road nicht Halt machte.
Bücher aus dem Schrank im Salon begleiteten ihre Tage zwischen den Rattansesseln dort, der Veranda und dem Pavillon, obwohl sie sich allzu oft über den aufgeschlagenen Seiten in Tagträumen verlor. Die Erinnerung an jeden Moment mit Raharjo auskostend, malte sie sich aus, wie sie mit ihm an Bord seines Schiffs zu fernen Küsten segelte. Wie sein Haus am Serangoon River wohl einmal aussehen würde; vielleicht ein weitläufiger Bungalow, luftig und lichtdurchflutet. Mit einer Veranda, die auf einen üppig blühenden, wilden Garten hinausging, voller Schmetterlinge und Vogelgesang, und von der aus man auf den Fluss sah und den Flug der Königsfischer beobachten konnte.
Briefe aus England trafen ein, von Tante Stella und Maisie, und einer von Mrs Hambledon aus China, und ein paar Mal kutschierte Jati sie und Kartika in die Stadt, wo sie sich neue Sarongs und Kebayas kaufte. Eine ruhige, fast traumverlorene Zeit für Georgina, in der sie wieder in den Rhythmus des Lebens auf L’Espoir hineinfand wie in ein altes, eingetragenes und nach langer Zeit wieder hervorgeholtes Kleidungsstück.
In den Godowns indes herrschte Hochbetrieb. Der November, in den der St. Andrew’s Day fiel, bildete den Schlusspunkt der Saison für die Bugis aus Sulawesi, Celebes, Bali und Borneo, die in ihren dickbäuchigen Schiffen die Schätze Südostasiens nach Singapur brachten. Verschiedene Algensorten für die japanische und chinesische Küche und Haifischflossen. Schwalbennester, die sich als Delikatesse und Medizin für teuer Geld nach China verkaufen ließen. Ebenholz und Sandelholz, Rattan und Reis und edle Gewürze. Gambir, ein Strauch aus Java und Sumatra, aus dessen Blättern eine braune, fast schwarze Farbe für Baumwolle und Seide gewonnen wurde, der vor allem aber als Gerbstoff für Leder heiß begehrt war. Bis der Wettlauf um die besten Waren, die besten Preise beendet und das Weiterverschiffen in die Wege geleitet war, neigte sich das Jahr schon fast dem Ende zu.
Der Dezember und der Januar bedeuteten eine Verschnaufpause im umtriebigen Geschäftsleben der Stadt. Von den Malaien der Insel die Zeit der geschlossenen Mündungen genannt, behinderten starke Regenfälle und stürmische Winde den Schiffsverkehr. Nur einzelne unerschrockene Handelsfahrer aus Java oder Siam steuerten noch den Hafen an; Geschäfte, die sich locker nebenbei aus dem Handgelenk abwickeln ließen.
Das Christfest kam und ging, und das neue Jahr brach an, leise und nüchtern, verglichen mit dem chinesischen Neujahrsfest im Februar. Bunt und lärmend und unter dem Krachen von Knallfröschen begrüßten die Chinesen das Jahr des eisernen Hundes. Was Ah Tong sorgenvoll die Stirn runzeln ließ, weil sich in einem solchen Jahr großes Glück und Unglück die Waage hielten, und die Pocken, die sich auf der Insel ausbreiteten, waren wie ein unheilvolles Vorzeichen für das neue Jahr.
In das Gordon Findlay hingegen voller Zuversicht blickte, nachdem er als Mitglied der Handelskammer die Gelegenheit bekommen hatte, Lord Dalhousie, dem Generalgouverneur von Indien, anlässlich seines dreitägigen Besuchs nicht nur die Hand zu schütteln, sondern auch ein paar Worte mit ihm zu wechseln, von Schotte zu Schotte, von einem Indienveteranen zum anderen. Dalhousie schien ebenso wie seine Gattin angetan von Singapur, das eben doch mehr war als nur ein Fischerdorf, besser als eine Sträflingskolonie. Ein Besuch, der zu der Hoffnung Anlass gab, Dalhousie würde dafür sorgen, dass Singapur künftig mehr und vor allem schnellere Unterstützung aus Calcutta erhielt.
Zweimal ging Georgina in dieser Zeit mit Paul Bigelow aus, mit Zustimmung ihres Vaters und in dessen Begleitung. Gesellschaften in bescheidenem Rahmen, auf denen viel gegessen, noch mehr getrunken, ein bisschen getanzt und vor allem über Geschäfte geredet wurde. Paul Bigelow erwies sich dabei als ähnlich ungeschickt auf dem Parkett wie sie selbst, ließ sich davon jedoch nicht den Spaß verderben und steckte Georgina damit an. Dennoch waren es Abende wie Talmi, glitzernd im Lampenschein, aber nicht von dauerhaftem Wert und bald schon vergessen.
Sobald die gespannt erwartete erste Dschunke vom Government Hill aus gesichtet wurde, die gehisste Flagge ihre Ankunft verkündete, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Denn dieser ersten Dschunke folgten viele, viele weitere, schwer beladen mit Kostbarkeiten aus dem Reich der Mitte, für die es überall auf der Welt einen Markt gab. Granitplatten und Fliesen, Steingut, Porzellan und Schirme aus Papier. Fadennudeln und getrocknete Äpfel, Aprikosen und Pfirsiche und allerlei heilkräftige Kräuter, Wurzeln und Pülverchen. Räucherstäbchen und Geistergeld: farbig bemalte und mit Ornamenten verzierte Stücke aus Papier, die die Chinesen zu Ehren ihrer Toten verbrannten. Mehl und süße oder salzige Kekse, Zuckerzeug und kandierte Lotussamen und Ingwer. Nankingstoffe in Gelb, Grün und Blau, bunter Satin und Seidenstoffe.
Und natürlich Tee, eine Unmenge von Tee in verschiedensten Sorten und Qualitäten. Nicht selten belief sich der Wert der Ladung einer einzigen Dschunke auf Zehntausende spanische Dollar, der offiziellen Handelswährung in Singapur und darüber hinaus.
Oft saß Georgina in dieser Zeit in der feuchten Wärme der Kirche von St. Andrew’s. In diesem kleinen Stück alter Heimat, schottisch durch und durch, das sich Händler wie Gordon Findlay an diesem Ende der Welt geschaffen hatten. Und jedes Mal bat sie Saint Andrew, den Fischer vom See Genezareth, Schutzpatron der Fischerleute und Seemänner, dessen Gebeine nach einem Schiffbruch heil an der Küste Schottlands gelandet waren, am Ende der damaligen Welt, Raharjo heil und unversehrt zu ihr zurückzubringen.
Der Regen ließ nach, die Tage hellten sich auf, und bald wechselten sich wieder irisierend blauer Himmel und Sonnenschein mit kräftigen Gewittern ab.
Endlich, endlich drehte der Wind und kam von Osten.