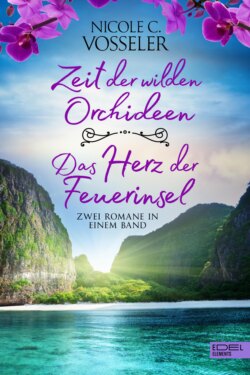Читать книгу Zeit der wilden Orchideen / Das Herz der Feuerinsel: Zwei Romane in einem Band - Nicole-C. Vosseler - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
___________
ОглавлениеDer Palanquin bremste scharf in der überdachten Auffahrt.
Paul Bigelow sprang heraus und bezahlte den syce, dessen braunrunzliges Gesicht grimmig verzogen und schweißgebadet war, bevor er in langen Schritten die Stufen hinaufeilte. Hinter ihm trabte das Pferd an, und in einer Wolke aus rotem Staub rollte der gemietete Wagen davon.
»Willkommen zu Hause, Tuan Bigelow.«
Boy One ließ sich nicht anmerken, wie überrascht er von seiner verfrühten und unerwarteten Rückkehr sein musste; vielleicht wusste er es schon, manche Neuigkeiten verbreiteten sich schneller als Blütenpollen in der Luft.
Die Miene des Hausdieners zeigte auch keine Regung, als Paul ihm das Gewehr hinhielt.
»Bring das bitte ins Arbeitszimmer und leg es auf die Kommode hinter der Tür.
»Jawohl, Tuan!«
»Jati soll anspannen, in den Godown fahren und dort auf Tuan Findlay warten, gleich wie lange es dauert. Und sag ihm, er soll auf sich aufpassen, in der Stadt ist die Hölle los.«
»Sehr wohl, Tuan.«
Paul zwang sich, langsam und leise zu gehen, während er die Halle durchquerte; er wollte sich die Freude nicht nehmen lassen. Auch an einem Tag wie diesem nicht.
An der Tür zur Veranda blieb er stehen, lehnte sich mit verschränkten Armen gegen den Türrahmen und spähte hinaus. Ein Lächeln schien auf seinem Gesicht auf.
Das war das Beste an jedem Tag: nach Hause zu kommen.
Er mochte die Arbeit in der Firma, den Umgang mit Waren, Listen und Zahlen; süchtig war er nach dem Nervenkitzel des Wettlaufs um die besten Handelsgüter, den besten Preis. Nach der kribbelnden Anspannung während der Verhandlungen und dem Triumph danach und nach dem Druck, Kauf, Verkauf, Verschiffung so schnell, so dicht nacheinander wie möglich abzuwickeln. Doch es bedeutete ihm nichts, verglichen mit dem Gefühl absoluten Glücks, das ihn jeden Tag hier erwartete, sobald er nach Hause kam.
Er war stolz darauf, als einer der wenigen Männer der Stadt eine Frau zu haben, noch dazu eine wie Georgina, genoss die neidischen, die bewundernden Blicke, wenn er sie, elegant frisiert und in einem feinen Kleid, an seinem Arm ausführte. Zu einem Dinner, in ein Theaterstück in die Assembly Rooms am Fuß des Government Hill oder wie jüngst erst im Februar, als die Stadt in ebendiesem Saal ihre Gründung vor fünfunddreißig Jahren mit einem Ball des Gouverneurs feierte. Zum Pferderennen auf der Rennbahn jenseits der Serangoon Road, einen hübschen Hut auf ihrem hochgesteckten Haar, zum Freiluftkonzert auf der Esplanade und der alljährlichen Regatta am Neujahrstag. Oder einfach nur sonntags zum Gottesdienst, der nach dem Abriss der einsturzgefährdeten Kirche von St. Andrew’s teils in der alten Mission Chapel in der Bras Basah Road abgehalten wurde, teils im ebenfalls schon alten und erneuerungsbedürftigen Gerichtsgebäude zwischen High Street und dem Ufer des Singapore River.
Doch am liebsten sah er sie so: in Sarong und Kebaya.
Die bloßen Füße mit den eingestaubten Sohlen von sich gestreckt und ihr Haar zu einem nachlässigen Zopf zusammengebunden, sah Georgina mit zweiundzwanzig noch immer aus wie ein junges Mädchen. Nicht wie die Mutter zweier Söhne, die mit ihr und Cempaka auf den Holzbohlen der Veranda saßen. In eins der Spiele waren sie vertieft, mit denen Georgina die Tage der Kinder füllte, mit Geschichten und Phantasiewelten, die Paul ahnen ließen, wie Georgina ihre Kindheit hier auf L’Espoir wohl verbracht hatte.
Duncans dunkler, fast schwarzer Schopf beugte sich über das Haus, das er gerade errichtete, dann hob er den Kopf und deutete auffordernd auf eine Ecke der Hausmauer. Halb auf Cempakas Schoß und von ihrer Hand geführt, stellte der kleine David den Bauklotz, den er zuvor schon ungeduldig in der Faust geschüttelt hatte, dort ab. Die Zunge angestrengt auf die Oberlippe geheftet, lösten sich seine Finger. Als er begriff, dass der Klotz stehenbleiben würde, kiekste er auf und klatschte in die Hände. Ein glückliches Strahlen auf dem Gesicht, grapschte er sich den nächsten Klotz, den sein Bruder ihm hinhielt.
Pauls Lächeln vertiefte sich, als er Georgina beobachtete, wie sie mit ihren Söhnen sprach und wie ihre Augen dabei leuchteten.
Sofern das auch nur möglich war, schien ihm Georgina mit der Geburt von David vor etwas über einem Jahr noch schöner geworden zu sein. Bereits in der Schwangerschaft, die so viel sanfter verlief als die erste, Georgina geradezu aufblühen ließ, hätte er ganze Tage mit ihr im Bett zubringen können. Die Arme um ihren wachsenden Leib geschlungen und die Bewegungen des Kindes unter seinen Händen. Das Gesicht in Georginas Haar vergraben und den Duft ihrer Haut einatmend, diesen Duft nach dem rauen Gras des Gartens und wie die Luft kurz vor einem nächtlichen Gewitter.
Zuweilen fühlte er sich schuldig, dass er sein Begehren auslebte, wann immer ihm danach war, obwohl er sehr wohl merkte, dass ihr nichts daran lag. Schuldig, obwohl er wusste, dass es sein gutes Recht war als ihr Ehemann. Er gab sich Mühe, sacht zu sein mit ihr, sich Zeit zu lassen, vielleicht doch noch etwas zu finden, das ihr daran gefallen mochte.
Und beruhigte unterdessen sein schlechtes Gewissen, indem er ausgefallene und teure Spielsachen für die Kinder kaufte. Ein Schmuckstück für Georgina, einen neuen Hut. Geschenke, über die sie sich ehrlich zu freuen schien, am meisten über die Bücher, die er für sie kommen ließ, und über das klebrigsüße Zuckerzeug, das er ihr aus dem chinesischen Viertel mitbrachte.
Einen Fehlgriff hatte er allerdings mit dem Kakadu in seinem Käfig getan, bei dem ihm schließlich nichts anderes übrig geblieben war, als sich von Jati ins Innere der Insel fahren zu lassen und den Vogel dort freizulassen. Die glänzenden Augen, mit denen Georgina dem davonflatternden Kakadu nachgeblickt hatte, wie sie ihm dann um den Hals gefallen war und mit einem geflüsterten Danke seine Wange geküsst hatte, war dennoch jeden einzelnen Penny wert gewesen.
Georgina war ihm in der Hitze Singapurs wie eine kühle Meeresbrise, die ihn durchatmen ließ. Bei der er zur Ruhe kam.
Das Lächeln auf seinem Gesicht verlosch. Es widerstrebte ihm, diese Idylle zu zerstören, er wollte diesen Moment so lange hinauszögern wie möglich; seit ein paar Stunden verstand er, wie Gordon Findlay damals seine kleine Tochter entwurzeln und in die Fremde schicken konnte.
Georginas Augen, die durch den Garten wanderten, dann über die Veranda, entdeckten ihn schließlich in seinem verborgenen Winkel.
Eine feine Röte zeichnete sich auf ihren Wangenknochen ab, dann lächelte sie ihm entgegen. »Hallo.«
Die beiden Kinderköpfe ruckten hoch.
»Papa!«
David ruderte mit beiden Armen, und der Bauklotz flog in hohem Bogen davon. Cempaka half ihm aufzustehen; die großen blauen Augen funkelnd vor Aufregung und Glück, patschte er in schnellen, noch ein wenig wackeligen Schritten auf seinen Vater zu, der in die Knie ging und seinen Sohn in den ausgebreiteten Armen auffing.
»Hallo, mein Kleiner«, murmelte er in das seidige Blondhaar des Jungen hinein, einmal mehr berührt von diesem kleinen, stets fröhlichen Menschen, der ihn mit so viel Liebe überschüttete.
Seinen Sohn auf dem Arm, trat er hinaus auf die Veranda und ließ sich neben Georgina nieder, küsste sie auf die Wange.
»Hallo, meine schöne Fee.«
Er sah Duncan an, der sich mit zusammengezogenen Brauen an seine Mutter drückte, seine Haut in genau demselben hellen Goldton wie ihre, sein scharf geschnittenes Gesicht eine kühne Abwandlung von Georginas Zügen.
»Bekomme ich kein Hallo von meinem Großen?«
Duncans Stirn glättete sich, und er kam auf ihn zu, ein kaum sichtbares Lächeln um seinen vollen Mund.
Paul tat sich schwer mit dem Jungen, auch wenn er manchmal vergaß, dass ein anderer Mann ihn gezeugt hatte. Vielleicht weil Duncan so scheu war, so bedächtig, langsam geradezu und wenig sprach.
Lange war er überzeugt gewesen, der Junge sei zurückgeblieben, aber das war er nicht. Im Gegenteil: Duncan verblüffte ihn immer wieder damit, was er schon alles wusste und verstand, und mit den klugen Fragen, die er aus heiterem Himmel stellte, bevor er wieder in Schweigen verfiel. In diese andächtige, tiefgründige Ruhe, die Paul bei einem noch so kleinen Kind befremdlich, beinahe unheimlich fand.
Es mochte auch daran liegen, dass Duncans unkindlich ernste Miene nur selten Einblicke in das erlaubte, was in ihm vorgehen mochte, und an seinen irritierend grauen Augen, manchmal wie Quecksilber, manchmal wie Granit. Oder daran, dass der Junge zuweilen aufbrausend reagierte, sich in Zornausbrüche hineinsteigerte und Paul hilflos zusehen musste, wie es niemand anderem als Georgina gelang, ihn wieder zu beruhigen, nur indem sie ihn berührte, ihm in die Augen schaute und leise auf ihn einredete.
Aber in seltenen Momenten wie diesem, als Duncan sich an ihn drückte, das Gesicht in seiner Halsbeuge vergrub, er ihm über Kopf und Nacken strich und der Junge selig aufschnaufte, spürte er, wie viel Vertrauen und Zuneigung ihm dieses Kind entgegenbrachte; dann war Duncan ganz und gar sein Sohn.
Georgina rutschte näher und streichelte Duncan über den Rücken, lehnte sich dann gegen Pauls Schulter. Eine dieser kleinen Gesten, die sich in der letzten Zeit eingeschlichen hatten. Wenn sie ihn bei der Hand nahm, sich in seine Armbeuge schmiegte oder gar einen Kuss von ihm erwiderte, kam sie ihm vor wie eine Knospe, die halb verdorrt zu lange im Schatten ausgeharrt hatte und sich unter Regen und Sonne langsam und zögerlich öffnete. Und nährte damit seine Hoffnung, dass sie ihn vielleicht doch noch irgendwann liebgewann.
Sie blinzelte zum Himmel hoch, zur Sonne hin.
»Du bist heute früh zurück.«
Beunruhigt sah Georgina zu, wie Cempaka auf Pauls Bitte hin David auf den Arm hob und die Kinder ins Haus brachte. Der Blick, den Duncan ihr an der Hand seiner Ayah zuwarf, fragend, fast ängstlich, schnitt ihr ins Herz.
»Ist etwas passiert?«, flüsterte sie und sah unwillkürlich zum Haus hin. »Ist … ist etwas mit Vater?«
»Keine Sorge. Deinem Vater geht es gut. Er kommt bald nach.« Er legte den Arm um ihre Schultern und zog sie an sich. »Es hat heute Mittag in der Stadt einen Zwischenfall gegeben. Zwei Chinesen gerieten über eine Nichtigkeit in Streit. Über den Preis für eine kleine Menge Reis oder etwas in der Art. Das hat Neugierige angezogen, sich dann schnell zu einer Massenprügelei hochgeschaukelt und auf ganze Viertel ausgeweitet. Überall sind Steine durch die Gassen geflogen, gingen die Männer mit Stöcken und Messern aufeinander los. Buden und Läden wurden demoliert und geplündert. Das Militär versucht gerade, der Unruhe Herr zu werden.«
»Und da hast du meinen Vater allein im Godown gelassen?«
Ihre Augen schlugen Funken, und Paul musste grinsen; als sie sich losmachen wollte, hielt er sie unnachgiebig fest.
»Ich bin nicht annähernd ein solcher Schuft, wie du glaubst. Dein Vater wollte eigenhändig darüber wachen, dass im Kontor alles Wertvolle und Wichtige hinter Schloss und Riegel kommt und der Godown verrammelt wird. Und dass seine Angestellten und Arbeiter in Sicherheit sind. Mich hat er hierher geschickt, damit ich meine Frau und meine Kinder beschützen kann.«
Er drückte einen Kuss auf Georginas glühende Wange.
»Morgen ist bestimmt alles schon wieder vorbei.«
Eine ruhige Nacht war Singapur noch vergönnt.
Eine Nacht, in deren Dunkelheit sich die Chinesen zusammenrotteten und mit allem bewaffneten, was als Waffe taugte, um bei Tagesanbruch loszuschlagen.
Chinesen, die aus Kanton stammten gegen Chinesen aus Fukien und Amoy, viele davon noch kampfesdurstig wie gereizte Raubtiere, nachdem sie gerade erst nach Singapur geflohen waren. Sinkehs, Neuankömmlinge, aus einem China, das sich in der nicht enden wollenden Taiping-Rebellion selbst zerfleischte. Teochew gegen Hokkien: Der Graben zwischen den beiden chinesischen Dialekten, immer spürbar, immer sichtbar, riss die Insel auseinander. Klaffte weiter auf, weil es zu wenig Arbeit gab und zu wenig, zu teuren Reis, und dieser Graben füllte sich mit Scherben und Trümmern, Feuer und Blut.
Die Handvoll Ordnungshüter der Stadt stand diesem Ausbruch an Gewalt hilflos gegenüber. Das Militär musste einspringen und die Besatzung der vor der Küste ankernden Kanonenboote. Siebzig Männer, ein großer Teil der europäischen Bevölkerung, schlossen sich zu einer freiwilligen Schutztruppe zusammen; sogar der Sultan von Johor schickte schließlich zweihundert seiner Krieger, und mächtige Towkays wie Tan Kim Seng und abermals Seah Eu Chin bemühten sich um Vermittlung.
Die Zorneswogen waren jedoch nicht zu glätten, schaukelten heftig auf und ab, rollten von der Stadt in die ländlichen Gebiete des Landesinneren hinein, nach Paya Lebar, Bedok und Bukit Timah und wieder zurück, ohne sich dabei zu erschöpfen.
Angstvolle, nervenzerreißende Tage waren es in diesem Mai, während die Chinesen Singapurs randalierten, plünderten und einander niedermetzelten. Ah Tong und die drei Boys schlichen wie geprügelte Hunde durch den Garten und das Haus, beschämt über ihre Landsleute und voller Sorge, was ihre Herrschaft nun von ihnen denken mochte.
Georgina wischte sich über die nasse Stirn und sah zum Himmel hinauf, der milchigweiß schwitzte. Eine drückende Stille lastete über dem Garten. Nur das Meer gurgelte unruhig jenseits der Mauer; bald würde es wieder ein Gewitter geben.
Gleichmäßig schaukelte sie die Hängematte vor und zurück, die Ah Tong für den neugeborenen und anfangs oft stundenlang brüllenden Duncan an den Deckenbalken der Veranda befestigt hatte; jetzt war es David, der mit lockeren Gliedern und offenem Mund darin schlummerte. Dieses Kind, das in seinem Äußeren, seinem Wesen so sehr Paul glich, als wäre Georgina nur das Gefäß gewesen, um es zur Welt zur bringen, und nichts weiter. Vielleicht, weil sie so wenig dabei empfunden hatte, als sie beide dieses Kind zeugten, wie sie manchmal dachte.
Cempaka, die ihn sonst in den Schlaf wiegte und über ihn wachte, hatte sie fortgeschickt und gehofft, die eintönigen Bewegungen würden sie beruhigen. Doch bei jedem Knacken in den Bäumen, jedem Rascheln und Knistern fuhr sie zusammen.
»Keine Angst«, ließ sich Gordon Findlay vernehmen. »Hier sind wir sicher. Wir Europäer hier in der Beach Road sind für diese Unruhestifter vollkommen uninteressant.«
Georgina sah zu ihrem Vater hinüber, der in Anzug und Weste bei einer Tasse Tee am Tisch saß und sich durch die Straits Times blätterte.
»Wie kannst du nur so ruhig bleiben?«
»Das ist eben Singapur.« Er warf ihr einen nachsichtigen Blick zu. »Wenn du in geordneten, allzeit sicheren Verhältnissen leben willst, hättest du in England bleiben müssen.«
Nüchtern klang er dabei, ohne einen Vorwurf oder auch nur die Spur einer Schärfe in der Stimme; die Geburten seiner Enkelsöhne hatten Gordon Findlay versöhnlich gestimmt, fast milde.
Georgina blutete das Herz bei der Vorstellung, wie die Chinesen der Stadt miteinander im Krieg lagen.
Sie dachte an die Gassen und Straßen, in denen sich unter den geschwungenen Dächern ein Lädchen an das nächste reihte, in denen man vom Taschenmesser über Schraubenzieher bis hin zum Schießpulver alles bekam. Die unterschiedlichsten Teesorten und Kräuter, Zuckerzeug, Porzellan und Glas und Korbwaren. Straßenhändler boten Wasser an, Zuckerrohr zum Naschen und Stücke von Ananas, Mango und Jackfrucht; mobile Garküchen verkauften Suppe, Krebsfleisch, Reis und Gemüsegerichte. Schreiber verfassten gegen Geld Briefe in die alte Heimat oder lasen dem Empfänger ebensolche vor, und die Barbiere hatten immer alle Hände voll zu tun: die Köpfe der Chinesen bis auf den allgegenwärtigen langen Zopf kahl zu scheren, Bärte zu rasieren und zu stutzen und die Ohren mit allerlei Pinzetten, Stäbchen und Bürstchen zu säubern.
Ihre Gedanken wanderten zu Poh Heng, ihrem Schuhmacher, und zu ihrem Schneider Ah Foo Mee, mit dem sie über einer Tasse Tee die Modemagazine studierte, die Tante Stella nach Singapur schickte, damit er Georgina ein neues Kleid zauberte. Ihr feines Briefpapier kaufte Georgina ebenfalls in einem dieser chinesischen Läden, wenn sie mit Kartika hinfuhr.
Manchmal bat sie Ah Tong, sie zu begleiten, unter dem Vorwand, vielleicht einen Übersetzer zu benötigen. Tatsächlich aber, weil das Strahlen auf seinem Gesicht sie glücklich machte, wenn er sich unter seine Landsleute mischen konnte, hierhin grüßte, dort ein Schwätzchen hielt, irgendwo bei einer Tasse Tee auf sie wartete oder auf einen Sprung in den Tempel von Thian Hock Keng ging, den Tempel des Himmlischen Glücks, der auf das Meer hinaussah, um unter den geschweiften, drachengekrönten Dächern aus roten und grünen Ziegeln zu seinen Göttern zu beten.
Ihr Herz verfiel in einen angstvoll stolpernden Takt.
»Ich habe Angst, dass Paul etwas zustößt«, flüsterte sie.
Seit zehn Tagen tobten die Unruhen in Singapur, und seit neun Tagen war Paul Bigelow als Teil der freiwilligen Schutztruppe in der Stadt unterwegs. Nur für einige wenige Stunden bleischweren Schlafs, ein Bad und eine schnelle Mahlzeit kam er zwischendurch nach L’Espoir, verschwitzt, staubig und müde, eine Erschöpfung, eine Härte im Blick, die verrieten, was seine Augen gesehen hatten.
»Brauchst du nicht«, entgegnete Gordon Findlay. »Er ist körperlich stark und auch sonst auf dem Quivive. Dem passiert so leicht nichts.«
Er schwieg einen Augenblick.
»Einen guten Mann hast du dir da ausgesucht.«
Ein seltenes, unerwartetes Lob, und Georgina wurde es warm ums Herz.
»Ja, das ist er.«
Die kohlschwarzen Brauen ihres Vaters zogen sich zusammen, und geräuschvoll blätterte er die Zeitung um.
»Sieht man einmal von dem Fiasko mit der Plantage ab. Ich hatte ihm gleich gesagt, dass das nichts wird. Wir sind schließlich Kaufleute und keine Pflanzer. Daran sind schon ganz andere gescheitert. So wie Balestier, der amerikanische Konsul seinerzeit, mit seiner Zuckerrohrplantage. Damals, in den Dreißigern.«
Gambir und Pfeffer, zwei Pflanzen, die sich in ihrem Wuchs und Ertrag gegenseitig förderten und sich für gutes Geld verkaufen ließen, hatten sich in den letzten Jahren in die Dschungel im Herzen der Insel hineingefressen, und nicht wenige chinesische Pflanzer waren mit ihren Plantagen reich geworden.
Lange hatte Paul sich mit dem Gedanken getragen, ebenfalls in dieses Geschäft einzusteigen. Zu lange; als er kurz nach Duncans Geburt mit Firmenkapital endlich eine Plantage erwarb, begann sich bald danach abzuzeichnen, dass die Erdkrume der Insel zu dünn war für eine dauerhafte Kultivierung der Pflanzen. Nach zehn, höchstens fünfzehn Jahren hatten Gambir und Pfeffer den Boden erschöpft, war er allenfalls noch für den Anbau der anspruchslosen Ananas zu gebrauchen. Die Plantagen wanderten auf die malaiische Halbinsel ab, die besseren Boden bei gleichwertigem Klima bot und dazu noch wesentlich mehr Raum als die kleine Insel von Singapur, und der Preis für Gambir sackte in die Tiefe.
»Warum hast du ihm dann erst das Geld dafür gegeben?«
Eine seiner Brauen hob sich.
»Wie soll er denn sonst lernen, Risiken einzuschätzen? Er ist ein heller Kopf und weiß eine Menge, hat schon viel Erfahrung gesammelt, seit er hier ist. Aber noch nicht genug. Nicht genug, dass ich die Firma guten Gewissens in den nächsten Jahren nach und nach in seine Hände geben könnte. Außerdem«, er trank einen Schluck Tee, »sind wir so zu einem guten Stück Land gekommen. Das wird nicht schlecht. Das kann man immer mal gebrauchen.«
Duncan hatte vor geraumer Zeit schon darin innegehalten, an seinem Turm aus Bauklötzen weiterzubauen, und stattdessen aufmerksam seiner Mutter und seinem Großvater zugehört. Er legte den Klotz, den er noch in der Hand hielt, beiseite und tapste auf bloßen Füßen zu Gordon Findlay hinüber.
Georgina verbiss sich ein Auflachen. Wie der Junge dastand, kerzengerade und beide Füße fest auf dem Boden, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, war er das Ebenbild seines Großvaters.
Gordon Findlay musterte seinen Enkelsohn. »Möchtest du mit mir Zeitung lesen?«
Duncan deutete ein Nicken an.
»Na dann.«
Gordon Findlay hob ihn auf sein Knie und begann, ihm vorzulesen, unterbrach sich dabei immer wieder, um etwas zu erklären oder zu erzählen. Ihm, dem sonst die Arbeit das Lebenselixier war, schien es nichts auszumachen, dass er die Firma vorsorglich geschlossen hielt; vielmehr schien er die Zeit zu genießen, die er auf L’Espoir mit seinen Enkeln verbringen konnte.
David gab einen kleinen Laut von sich, zog blinzelnd eine Grimasse und rieb sich mit dem Handrücken über das Gesicht. Georgina streichelte seine Wange und setzte die Hängematte wieder in Bewegung. Ein Lächeln zuckte um seinen rosigen Mund; mit einem Aufschnaufen wandte er den Kopf und schlief weiter.
Georginas Blick kam auf dem Wäldchen zu liegen, das sich finster gegen den weißgrauen Himmel abzeichnete.
Sie war lange nicht mehr dort gewesen. Das letzte Mal ein paar Tage, nachdem die Verlobung mit Paul Bigelow beschlossene Sache gewesen war. In der verzweifelten Hoffnung, Raharjo könnte doch noch zurückgekehrt sein, ihr irgendein Zeichen hinterlassen haben, das sie vor dieser Heirat bewahrte. Eine Hoffnung, die ihr wie Wasser durch die Finger geronnen war, bis sie voller Zorn alles hinweggefegt hatte, was sie an Raharjo erinnerte.
Manchmal kam ihr die Zeit mit Raharjo wie ein Traum vor. Wie ein Märchen, das sie mit allen Sinnen durchlebt hatte. Das Märchen vom Piratenjungen, der aus dem Meer gekommen war, und dem Mädchen aus der roten Erde von Singapur. Das jäh zerstob, als die Wirklichkeit sich seiner bemächtigte.
Die Wirklichkeit – das waren ihre beiden Söhne, die Hunger hatten und spuckten, zahnten und weinten. Die gewickelt werden mussten, die laufen und sprechen lernten und aufs Töpfchen zu gehen. Die mal leicht fieberten, sich Beulen stießen und die Knie aufschlugen und getröstet werden wollten. Gierig waren sie danach, die Welt Stück für Stück, Schritt für Schritt zu begreifen, hungrig nach Nähe und Zärtlichkeit, nach immer neuen Spielen und alten Geschichten.
Manchmal war es fast, als wäre es nie geschehen. Nur in ihrer Phantasie.
Doch die Schwimmhäute an den Füßen ihres Sohnes erinnerten sie stets daran, dass sie einmal einen Meeresmenschen geliebt hatte. Wenn Duncan den Mund oder seine Brauen auf eine bestimmte Weise verzog, so wie Raharjo es getan hatte. Und wenn er seine grauen Augen in die Ferne schweifen ließ, als lausche er dem Ruf des Meeres wie sein Vater, war es kaum zu ertragen.
Es tat weh, das mit niemandem teilen zu können.
Das Wäldchen, das Georgina einmal so geliebt hatte, in dem sie früher so glücklich gewesen war, hatte etwas Bedrohliches bekommen. Nicht mehr nur eine Wildnis, sondern ein wucherndes Pflanzengeschwür, war es zum Sinnbild des Unheils geworden, das sie nach Cempakas Überzeugung mit sich brachte, wohin sie auch ging. Vielleicht hatte sie Raharjo Unglück gebracht, und er war nie von dieser einen Fahrt über das Meer zurückgekehrt; vielleicht hatte sie sich auch selbst ins Unglück gestürzt, indem sie einem Mann vertraut hatte, für den sie nichts anderes gewesen war als eine flüchtige Liebelei.
Sie würde es wohl nie erfahren.
»Meinst du nicht, dass wir das Wäldchen endlich abholzen sollten?«, fragte sie leise und mehr sich selbst. »Und den Pavillon abreißen. Sofern er nicht schon eingestürzt ist. Nicht dass sich eines der Kinder dort noch etwas tut.«
Gordon Findlay hob den Kopf von der Zeitung und sah in den Garten hinaus.
»Vielleicht sollten wir das, ja«, sagte er nach einer Weile, die schmale Brust seines Enkels sicher in seiner großen Männerhand geborgen. Seine Augen richteten sich auf Georgina, mattblau, wie aufgeschürft. »Aber ich habe deiner Mutter versprochen, es nicht zu tun. Nicht, solange ich lebe.«
Georgina nickte und sah wieder in den Garten hinaus. Womöglich war es besser, wenn das Wäldchen erhalten bliebe, besser als eine freie Sicht auf das Meer.
Sie konnte nur hoffen, dass sie nicht auch noch Paul Unglück brachte.
Das Rauschen des Regens und ein fernes Donnergrollen ließen Georgina aus tiefem Schlaf heraufdämmern. Das Bettlaken feuchtheiß und klebrig auf ihrer Wange, blinzelte sie in schummriges Licht hinein. Die Lampe brannte noch.
Ihre Schulter tat weh, als sie sich streckte. Sie musste eingenickt sein, während sie in ängstlicher Unruhe auf Paul wartete.
Flüsterstimmen woben sich in das Lied des Regens, ein Lachen; dann Schritte und das Geräusch der sich leise öffnenden und wieder schließenden Tür. Georgina setzte sich auf.
»Du bist ja noch wach«, sagte Paul leise und hockte sich auf die Bettkante. »Ist doch schon mitten in der Nacht.«
Gähnend rieb sie über ihre schlafverklebten Augen, zuckte zusammen und streckte die Finger nach der blutverkrusteten Schramme aus, die sich über Pauls Stirn zog.
Grinsend bog er den Kopf zurück. »Ist nur ein Kratzer. Sieht schlimmer aus, als es ist.«
Seine Hand legte sich gegen ihre Wange.
»Es ist vorbei, Georgina. Mehrere hundert Männer sind verhaftet, der Rest hat sich zerstreut. Draußen ist wieder alles ruhig.«
Sie schlang die Arme um ihn, jeder ihrer Atemzüge stoßweise wie ein Schluchzen.
»Schon gut!« Paul rieb ihr über den Rücken und lachte leise. »Nicht dass ich mir noch einbilde, du hättest Angst um mich gehabt.«
Georgina blieb stumm, klammerte sich nur noch fester an ihn, ihre Wange gegen die Bartstoppeln in seinem Gesicht gedrückt, die schon weich wurden.
Behutsam schob er sie von sich weg, fasste sie unter dem Kinn und sah ihr in die Augen, ein Blick, dem sie auszuweichen versuchte.
Erstaunen breitete sich auf seinem Gesicht aus.
»Du hattest wirklich Angst um mich.«
Sie lehnte sich vor und legte ihre Lippen auf seinen Mund. Begann ihn zögerlich zu umschmeicheln, in einem Kuss, der drängender, fordernder wurde.
Paul keuchte auf, als sie sich abrupt von ihm löste, sich die Kebaya über den Kopf zog und das Hemdchen, das sie darunter trug, den Sarong von ihren Hüften schob.
»Georgina …«
Nackt presste sie sich an ihn und verschloss ihm den Mund mit fiebrigen Küssen. Ihre Hände strichen über seine Hüften, zerrten ihn mit sich auf die Laken, und seine Haut schmeckte nach dem Regen, der draußen vor dem Fenster niederging.
Die Lampe war kurz vor dem Verlöschen und warf einen flackernden Schein über das Bett.
Paul betrachte Georgina, die neben ihm schlief, die Schläfe auf ihrem angewinkelten Arm ruhend und die Knie angezogen. Sein Blick zeichnete die Konturen ihres Gesichts nach und die dichten Fächer ihrer Wimpern. Die Biegung ihres Halses und die Wölbung ihrer Schultern. Ihre Brüste, die so weich waren unter seinen Händen, ihre sanft gerundeten Hüften, ihre Schenkel, voller als früher.
Schweißperlen auf ihrer Haut wie Tautropfen, sah sie wie eine frisch aufgesprungene, fremdartige Blüte aus. Jetzt. Danach.
»Du bist wahrhaftig eine Tigerin«, raunte er aus enger Kehle.
Trunken war er, immer noch, von der Leidenschaftlichkeit, mit der sie ihn mit sich gerissen hatte wie ein Tropensturm. Wie ein Schiffbrüchiger kam er sich vor, der einmal vom salzigen Wasser des Meeres gekostet hatte und nun nach immer mehr verlangte.
Er wünschte sich, die Zeit anhalten zu können, um nicht erleben zu müssen, wie quälend der Durst am Morgen sein würde.