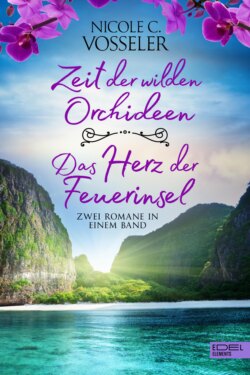Читать книгу Zeit der wilden Orchideen / Das Herz der Feuerinsel: Zwei Romane in einem Band - Nicole-C. Vosseler - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
___________
ОглавлениеPaul Bigelow saß auf der Veranda und starrte in den Regen hinaus. Ein ungleich leichterer Regen als in den vergangenen Monaten, in denen der Wintermonsun sich mit brachialer Gewalt über die Insel ergossen hatte, aber dennoch nickten die Blätter der Bäume und Sträucher heftig unter dem Schauer, der vom grauen, blitzüberflackerten Himmel stürzte.
Das neue Jahr stand für die Chinesen im Zeichen des eisernen Schweins. Was Ah Tong nicht unzufrieden stimmte; ein ungestümes Jahr, gewiss, eines, das viele Wagnisse bereithielt, aber ein Jahr, das dem Mutigen und Tüchtigen Reichtum versprach, und eines, auf das man später mit einem guten Gefühl zurückblicken würde.
Paul Bigelow indes hegte Zweifel an Ah Tongs vielversprechenden Aussichten für dieses Jahr 1851, das ähnlich stürmisch begonnen hatte, wie das letzte zu Ende gegangen war.
Die gewaltigen Wassermassen, die im Januar niedergegangen waren, hatten den Kanal von Bras Basah und den Rochor River über ihre Ufer treten lassen und waren bei Flut in die Stadt geströmt. Straßenzüge standen unter Wasser, Erdreich wurde weggespült und die zutage geförderten Steine machten sie unpassierbar. In der Bencoolen Street und der Middle Road wurden malaiische Häuser mitgerissen, und Reis und Gemüse aus den Gärten fand sich später auf weit entfernten Straßen angeschwemmt. Holz, Kokosnüsse, tote Schweine und ertrunkene Hunde trieben durch die Stadt, und die Ufermauer an der Esplanade, die die offene Fläche vor dem Meer schützen sollte, war an vielen Stellen eingestürzt. Es würde noch einige Zeit dauern, bis auch die letzten Spuren des Monsuns nicht mehr sichtbar waren.
Die Cholera war auf der Insel wieder aufgeflammt, und die indischen Sträflinge wurden vom Hausbau abgezogen, um die Tiger zu jagen, die die Plantagen im Herzen der Insel heimsuchten und dort eine blutige Spur hinterließen.
Es waren diese Plantagen, auf denen Pfeffer und Gambir angebaut wurden, der einzige gewinnträchtige Ertrag der Insel, auf denen die Kongsis, die chinesischen Triaden, im Februar wie Tiger gewütet und mit chinesischem Blut die rote Erde dunkel gefärbt hatten. Das Blut ehemaliger Mitglieder, die sich aus dem engmaschigen Netz der Geheimgesellschaft gelöst hatten, nachdem sie von Pater Jean-Marie Beurel zum katholischen Glauben bekehrt worden waren. Die fortan in ihre eigenen Taschen wirtschafteten, nicht mehr in die Schatullen der Triaden, und nun deren Rache zu spüren bekamen.
Fünf Tage dauerte der rote Sturm zwischen Kranji und Bukit Timah, der Hunderte Tote forderte und Scharen von Flüchtlingen in die Stadt strömen ließ, und in den Nächten gloste der Widerschein der brennenden Plantagen am Himmel, roch die Luft nach Rauch. Bis einmal mehr die indischen Häftlinge und die Soldaten der kleinen Garnison der Stadt ausrückten und durch die Vermittlung des mächtigen Towkays Seah Eu Chin, dem König des Gambir, selbst Gründer und Kopf eines Kongsis, wieder Frieden einkehrte.
Ein brüchiger Friede, denn die Verwaltung unter Gouverneur Butterworth zögerte noch immer, die Macht und den Einfluss der Triaden zu beschneiden. Aus Angst, wie manche Kaufleute der Stadt meinten; aus wirtschaftlichem Interesse, wie andere befanden, die selbst gute Geschäfte mit Mitgliedern der Kongsis machten.
Aus China trafen neuerdings ebenfalls besorgniserregende Nachrichten ein. Gut zehn Jahre nach dem Ende des Opiumkriegs, aus dem die Briten als Sieger hervorgegangen waren, erschütterten Unruhen das Kaiserreich: Eine Bewegung, die sich die Taiping nannte, erhob sich gegen die Mandschuherrscher und gegen den Einfluss westlicher Mächte.
Ein Bürgerkrieg schien unausweichlich, mit möglicherweise katastrophalen Folgen für den Handel. Denn der Vertrag von Nanking, der seinerzeit die chinesischen Märkte öffnete und den Opiumhandel erlaubte, brachte einen äußerst lukrativen Kreislauf in Schwung. Das in der britischen Kolonie Indien in rauen Mengen und billig gewonnene Opium floss nach China, und die dafür erworbenen, in aller Welt begehrten Schätze ließen sich weiterverkaufen. Mit gigantischen Gewinnspannen – gerade für die Händler in Singapur. Auch für die Firma von Findlay, Boisselot & Bigelow.
Noch zumindest. Nicht wenige der Kaufmänner, mit denen Paul Bigelow gelegentlich bei einem Glas zusammensaß, rieten ihm, so viel wie möglich aus dem Handel herauszupressen, solange es noch ging. Denn obwohl der Handel in diesem Hafen, in dem keine Zölle, keine Steuern erhoben wurden, mehr als profitabel war – auf Dauer würde der Erfolg Singapurs nicht anhalten. Nicht ohne eigenständige Verwaltung, als bloßer Ableger der Regierung in Calcutta. Nicht ohne ordentlichen Hafen, mit einem Fluss als Umschlagplatz, der allen Anstrengungen zum Trotz zunehmend verschlickte und versandete. Nicht in Konkurrenz mit den neuerdings der Welt geöffneten Häfen von Shanghai und Hongkong, nicht in unmittelbarer Nachbarschaft von Malakka und dem holländischen Batavia.
Ein paar gute Jahre stünden ihnen wohl noch bevor, danach würde Singapur als Freihafen bedeutungslos werden.
Mit den Handballen rieb sich Paul Bigelow über die brennenden Augen, fuhr sich dann über das Gesicht; er hatte sich heute Morgen noch nicht einmal rasiert.
Manchmal zweifelte er daran, ob es gut gewesen war, sein Glück hier in Singapur zu versuchen, und oft plagte ihn Heimweh. Er vermisste die Nüchternheit Englands und die verlässliche Ordnung des Lebens dort. Eine gewisse Sicherheit und weite, offene Felder, die gedämpften Farben; sogar das Grau. Und er vermisste die Jahreszeiten, hätte einiges darum gegeben, einmal wieder einen Winter zu erleben, mit Schnee und klirrendem Frost.
Doch solange die Geschäfte so gut liefen, wie sie es derzeit noch taten, wäre es töricht, hier die Zelte abzubrechen.
Er zündete sich eine Zigarre an und blickte mit zusammengekniffenen Augen dem Rauch hinterher.
Das Prasseln des Regens, das Gurgeln der Kaskaden vom Dach und der Bäche, die sich durch die rote Erde des Gartens wühlten, dämpften kaum die Geräusche im oberen Stockwerk. Nur wenn der Donner krachend über das Haus hinwegrollte, verstummten die Frauenstimmen oben im Haus für einige wenige Augenblicke. Bevor die Klagelaute wieder zu hören waren, das Weinen und das Stöhnen, das ihn tief in Mark und Bein traf.
Seine Hand zitterte, als er sich nachschenkte und das Glas zum Mund führte.
Vermutlich wäre es klüger gewesen, in aller Frühe mit Gordon Findlay in den Godown zu fahren, um sich dort mit Arbeit abzulenken. Zur Not auch dort die Nacht zu verbringen, bis die Nachricht eintraf, alles sei überstanden. Doch er hatte sich entschieden hierzubleiben, und sei es nur, um im Ernstfall wie der Teufel loszureiten und Doktor Oxley zu holen.
Er misstraute der mak bidan, der Hebamme, die Cempaka vor Wochen aus ihrem Dorf geholt und im Dienstbotenquartier untergebracht hatte. Dass diese Georginas geschwollenen Leib und ihre Beine jeden Tag ölte und knetete, sie eng in einen Sarong wickelte und mit Bändern verschnürte wie ein Paket, störte ihn nicht weiter, schien ihm sogar Sinn zu machen. Argwöhnisch hingegen betrachtete er die Kräuter, die sie in Georginas Nähe verbrannte, die Lieder, die sie dabei sang und die für ihn nach faulem Zauber klangen. Die Tränke, die sie ihr verabreichte und wie sie Georginas Speisen streng überwachte und eigenhändig nachwürzte.
Dabei litt Georgina unter dem Kind, das sie auszuhöhlen schien. Bleich war sie geworden, das Gesicht spitz und mit eingefallenen Wangen, ihr Haar stumpf und strohig. Eine groteske Gestalt aus gewaltig vorgewölbtem Bauch mit Armen und Beinen, dünn wie Stöckchen. Als trüge sie ein Monstrum unter ihrem Herzen, das sie von innen her auffraß und bis zuletzt so wild in ihrem Bauch getobt hatte, dass sie sich immer wieder übergeben musste.
Bei Gordon Findlay stieß er mit seinem Misstrauen, seiner Sorge auf taube Ohren; er überließ seine Tochter ganz Cempakas Obhut, die ihre Befehlsgewalt mit Zähnen und Klauen verteidigte. Dagegen war Paul machtlos, schließlich war er nur der Schwiegersohn, nur der zweite Herr im Haus, und das Ganze ohnehin Frauensache.
Er verzog das Gesicht und trank noch einen Schluck.
Während sein Verhältnis zu Paul Bigelow fast wieder das alte war, manchmal fast noch eine Spur freundschaftlicher als früher, hatte Gordon Findlay seiner Tochter noch immer nicht verziehen. Wie zwei Fremde, die zufällig unter einem Dach lebten, wirkten Vater und Tochter, beide gleichermaßen in sich gekehrt und einsilbig, beide gleichermaßen unversöhnlich, und ohne dass es Paul gelang, zwischen ihnen zu vermitteln.
Er hatte Georgina nie gefragt, wer der Vater ihres Kindes war; er wollte es auch nicht wissen. Singapur war eine kleine Stadt, die Gefahr, dass er dem Mann, der Georgina geschwängert hatte, früher oder später über den Weg lief und ihm dann womöglich das Gesicht zu Brei schlug, zu groß.
Es hätte ohnehin nichts geändert. Er hatte gewusst, worauf er sich einließ, als er sich entschieden hatte, Gordon Findlay um ein Gespräch unter vier Augen zu bitten, und er hatte bekommen, was er wollte.
Ein hoher, dünner Schrei drang zu ihm herunter, der ihm in seiner Qual einen kalten Schauder den Rücken hinablaufen ließ.
Fahrig drückte er die Zigarre aus und kippte den Rest Scotch in seinem Glas hinunter; er konnte das nicht länger mitanhören.
Georgina ertrank in einem blutroten Ozean aus Schmerz. Flammender, beißender Schmerz, der sich durch ihre Eingeweide fraß. Und schwarz und schwer war der Leib des Kindes, der ihren Unterleib entzweiriss, ihre Beckenknochen zu sprengen drohte. Welle um Welle kam und ging, glühend und gewalttätig; Wehe um Wehe saugte mehr Kraft aus ihren Muskeln, ohne dass sie auf diesem qualvollen Weg auch nur einen einzigen Schritt vorwärtskam.
Die Stimmen von Bethari, der Mak Bidan, von Cempaka und Kartika, die sie seit den frühen Morgenstunden umsummt und umgurrt hatten, steigerten sich unvermittelt zu einem aufgebrachten Geschnatter, in das eine Männerstimme hineinpolterte.
»Schluss jetzt! Keine Widerrede! Ich bin der Herr im Haus, und ich will es so!«
Die plötzliche Stille traf mit einem Wellental zusammen und ließ Georgina befreit durchatmen, das Rauschen des Regens vor dem Fenster so wohltuend kühl auf ihrem heißen Gesicht, dass es ihr Tränen in die Augen trieb.
»Georgina.«
Eine kräftige Hand schloss sich um ihre verschwitzten Finger, und sie blinzelte. Ein unrasiertes Männergesicht, blass unter der Sonnenbräune, der Mund angespannt und das Weiß um die blaue Iris rotgeädert.
»Paul?«, hauchte sie langgezogen, und ein Schluchzen ruckte durch ihren Leib. »Paul.«
»Ich bin da«, stieß er hervor. »Ich lass dich jetzt nicht allein. Ich bleibe bei dir, ja?«
Georgina wollte den Kopf schütteln; stattdessen nickte sie und begann kläglich zu weinen.
»Ist ja gut«, sagte er, seine Stimme rau vor Hilflosigkeit, und drückte ihre Hand.
Ein Händedruck, den sie schwach erwiderte. »Wenn ich das nicht überlebe …«
»Red keinen Unsinn«, fiel er ihr barsch ins Wort und zwängte sich zwischen sie und das Kopfteil des Betts. »Natürlich überlebst du das!«
Georgina schluckte jedes weitere Wort hinunter. Den Kopf gegen Pauls breite Brust gestemmt, ihre Hand von seiner umklammert, holte sie tief Luft und stürzte sich kopfüber zurück ins rote Meer.
Das Hemd klebte ihm auf der Haut, seine Hosen hafteten feucht an seinem Hintern und an den Schenkeln. Paul Bigelow hatte sich noch nie zuvor so schmutzig gefühlt, so ausgelaugt. So aufgewühlt.
Die zittrigen, kraftlosen Hände, von roten Halbmonden und blutigen Kratzern übersät, in den Hosentaschen vergraben, stand er vor der Wiege, staunend darüber, wie klein so ein Kind war. Wie riesig für einen Leib wie den Georginas.
Ein Junge war es, unübersehbar. Schlank und zäh und mit langgestreckten Gliedern, mit seiner ohrenbetäubend kräftigen Stimme gleich zu Beginn jeden Zweifel ausräumend, wer der neue Herr im Haus war.
Friedlich lag er jetzt da, nackt bis auf eine weiße Stoffbahn, die um sein Bäuchlein gewickelt war, die winzigen Finger zu Fäusten geballt, mit denen er in die Luft boxte. Sein rotes Gesicht sah zerdrückt aus, die Partie um die zugekniffenen Augen verschwollen. Ein Gesicht, das auf anrührende Weise noch so jung war und zugleich die Weisheit von Ewigkeiten in sich trug.
Das Köpfchen mit dem dichten schwarzen Haarschopf wandte sich hin und her, sein voller Mund verzog sich, und unwillig kickte er in die Luft.
Ein Lächeln zuckte um Pauls Mund und verlosch sogleich. Die Brauen zusammengezogen, fasste er nach einem Fuß des Jungen, dann nach dem anderen. Das bedauernde Zungenschnalzen und Geflüster der Hebamme, der Blick, den sie mit Cempaka getauscht hatte, ergaben mit einem Mal einen Sinn.
»Armer kleiner Kerl«, murmelte er.
Ein Schock war es, dieses gerade geborene Menschlein unter seiner Hand zu spüren. Seine unbändige Lebenskraft und wie zart und weich die faltigen Fußsohlen waren.
Das Erlebnis der Geburt, dessen er gerade Zeuge geworden war, überrollte ihn; eine Naturgewalt, brutal und verstörend und Ehrfurcht gebietend, die ihn sich beinahe dafür schämen ließ, ein Mann zu sein. Der Geruch nach saurem Schweiß und schwerem, süßem Blut, der noch in der Luft hing, machte ihn benommen, und die jähe Angst, dem nicht gewachsen zu sein, was vor ihm lag, ließ ihn nach Atem ringen.
Er stolperte aus dem Zimmer, die Treppen hinunter und rannte ins Freie. In die zähe Gallertmasse der Regenluft hinein, die erstickend nach Moder roch und ihm den Magen umdrehte.
Gleich hinter den Stufen der Veranda sackte er auf die Knie, in den aufspritzenden Schlamm hinein und erbrach sich, bis er Galle schmeckte. Keuchend rang er nach Atem und hielt das Gesicht in den Regen, der ihn bereits bis auf die Haut durchnässt hatte.
»Kommen Sie, Tuan.« Die schlaksige Gestalt Ah Tongs kniete neben ihm und zog ihn an den Schultern hoch. »Kommen Sie ins Trockene.«
Sanft, aber bestimmt führte er ihn auf die Veranda hinauf und drückte ihn auf der obersten Stufe nieder. »Warten Sie hier, Tuan. Ich bin gleich zurück.«
Schnaufend und am ganzen Leib zitternd starrte Paul ins Leere, rieb sich über das bärtige Gesicht, wischte sich mit dem Ärmel über den ausgedörrten Mund.
Er sah auf, als Ah Tong ein Handtuch über seinen Schultern ausbreitete, bevor er sich neben ihn auf die Treppe hockte und ihm eine Tasse dampfenden Tees reichte.
»Vorsichtig trinken. Ist sehr heiß.«
Der Tee schmeckte nach Kräutern und Gewürzen, spülte den schlechten Geschmack hinunter und machte seinen Kopf wieder klar.
»Danke«, sagte er zwischen zwei Schlucken.
Ah Tong nickte nur.
»Die Frauen in diesem Haus …«, begann er nach einer Weile und sah zum Vordach hinauf, von dem der Regen hinuntertroff. »Es ist etwas Seltsames mit den Frauen in diesem Haus. Lange glaubt man, Schmetterlinge vor sich zu haben. Schillernd und zart und zerbrechlich. Und dann, eines Tages, ohne dass man vorher etwas geahnt hat, begreift man, dass sie in Wahrheit wilde Tigerinnen sind. Die einem ohne mit der Wimper zu zucken die Klauen in den Leib schlagen und das Herz herausreißen können.«
Paul dachte an Georgina, die oft so still wirkte, wie nicht ganz von dieser Welt, ihn aber mit dem blauen Feuer ihrer Augen versengen konnte. Die heute brüllend und mit gefletschten Zähnen einen Sohn zur Welt gebracht hatte, Paul dabei die Hände zerkratzte und ihren Kopf so fest in seine Brust bohrte, dass er wohl ein blaues Brustbein davontragen würde. Georgina, die mit ihm unter demselben Dach lebte, im selben Bett schlief und ihm dennoch immer fern war. Die er auch nach fast einem halben Jahr Ehe noch kaum kannte, geschweige denn verstand.
»Ja«, würgte er hervor.
»Man kann einen Tiger jagen und schießen. Ihn einfangen und in einen Käfig sperren. Aber man kann einen Tiger niemals zähmen. Man kann sich nur ganz behutsam mit ihm anfreunden. Ihm seine Freiheit und seine Wildheit lassen. Manchmal kommt dann der Tiger von alleine zu einem. Weil auch ein Tiger ab und zu Nähe und Schutz braucht.«
»Und man kann vermutlich nur hoffen, dass der Tiger es sich nicht doch noch anders überlegt und einen zerfleischt?«
»So ist es.«
Ah Tong schmunzelte, und Paul lachte.
»Ein Junge«, rief Ah Tong mit breitem Grinsen aus und rüttelte Paul Bigelow an der Schulter. »Ein gesunder, kräftiger Junge, Tuan!«
»Ja«, erwiderte Paul mechanisch. Ein Schatten legte sich auf sein Gesicht, und er versenkte den Blick in der fast leeren Tasse. »Ja. Ein Junge.«
Das durchdringende Gebrüll bohrte sich schmerzhaft in Georginas Ohren und hallte grell in ihrem Kopf wider.
»Bethari!«, rief sie. »Bethari! Das Kind!«
Für einen Augenblick war es still im Zimmer, dann hob das Geheul erneut an.
»Bethari! Cempaka! Kartika!«
Niemand kam, um nach dem Kind oder ihr zu sehen.
»Bethari!« Georginas Stimme überschlug sich, und auch das Kind verfiel in eine höhere Tonlage.
»Sei still! So sei doch endlich still!«
Weinend vergrub sie ihr Gesicht in der Kissenrolle, presste die Enden gegen die Ohren. Das Brüllen des Kindes war nur noch gedämpft zu hören, und trotzdem fand sie keine Ruhe. Als nähme ihr Leib die Schwingungen aus der Luft auf, zog sich Georginas Unterleib schmerzhaft zusammen, pochte es quälend in ihren übervollen Brüsten.
Zornig schleuderte sie das Kissen von sich und kroch aus dem Bett. Jeder Schritt war ein Gang über Glasscherben; ihr ganzer Unterleib fühlte sich aufgerissen und wund an. Sie war dankbar, dass Bethari sie von der Taille bis zu den Knien eng in einen Sarong geknotet hatte, der ihre Organe an ihren angestammten Platz zurückdrängen, ihren Körper wieder formen sollte, ihr jetzt aber vor allem Halt gab.
Keuchend stützte sie sich auf den Rand der Wiege.
»Was willst du?«, herrschte sie das Kind an, das stramm in bunte Tücher gewickelt war.
Für einen Augenblick hielt es inne, blinzelte suchend umher. Dann schnappte es nach Luft und fing sogleich wieder zu brüllen an, das Gesicht rot und zerknittert wie eine Hibiskusblüte, den zahnlosen Mund mit der rosigen Zunge wütend aufgerissen.
»Er hat Hunger.«
Cempaka stand in der Tür, mit gestrenger Miene, aber so etwas wie Mitgefühl in den Augen.
Georgina richtete sich auf und strich sich das strähnige Haar aus dem Gesicht.
»Warum habt ihr keine Amme geholt?«
Cempaka schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Du hast mehr als genug Milch für ihn. Kein Grund, die zu verschwenden.«
Georgina sah auf das Kind hinab, das sie durch die Hölle hatte gehen lassen. Das ihr Leben zerstört hatte. Sie wollte es nicht nähren. Sie wollte es nicht einmal in ihrer Nähe haben.
Sie wollte keine Mutter sein.
Ein seltsames Ziehen breitete sich in ihrer Magengegend aus und wanderte aufwärts, in Richtung ihres Brustbeins. Ein Gefühl zwischen Weh und Sehnsucht, das sie schmelzen ließ wie Wachs, über den Rand der Wiege tröpfelnd, dann zerfließend.
»Ich … ich weiß nicht, wie …« Furchtsam sah sie ihre Ayah an. »Hilf mir, Cempaka.«
Cempaka nickte zum Bett hinüber. »Setz dich hin. Ich bring ihn dir.«
Gehorsam humpelte Georgina durch das Zimmer und ließ sich ächzend auf der Matratze nieder. Mühselig rückte sie sich zurecht und lehnte sich mit dem Rücken an; sie kam sich vor wie eine alte, gebrechliche Frau.
Erstaunt sah sie zu, wie liebevoll Cempaka den Kleinen aus den Tüchern wickelte und dabei zärtlich mit ihm flüsterte. Sie konnte sich nicht erinnern, Cempaka je so milde erlebt zu haben, nicht daran, ihre Züge so beglückt gesehen zu haben.
Von selbst ahmten ihre Arme die Haltung nach, mit der Cempaka den Jungen in Windeln und Hemdchen vor sich her trug und ihn ihr schließlich übergab, bevor sie ihr mit weichen Fingern dabei half, das Kind anzulegen.
»Nein, schau, so muss das sein. Ja, besser. So ist’s richtig. Ja. Genau so.«
Georgina schrie leise auf, schockiert über den scharfen Schmerz, der durch ihre Brust schoss und sich bis in ihre Zehen fortsetzte. Über die heißen Wellen, die bis tief in ihren Bauch schwappten.
»Hört gleich auf«, murmelte Cempaka und legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. »Ist gleich besser. Wirst sehen.«
Der Schmerz ebbte ab, und Georgina atmete erleichtert durch. Aufseufzend legte sie den Kopf zurück und schloss die Lider, genoss das leichte Ziepen, das Prickeln und Kitzeln und die Wärme, die durch ihren Leib strömte.
Als sie die Augen wieder öffnete, war Cempaka verschwunden.
»Danke«, hauchte Georgina in den Raum hinein und senkte den Blick auf das Kind an ihrer Brust.
In höchster Konzentration hielt er die Brauen zusammengezogen, ein mit feinem Pinsel hingetuschter Schattenflaum. Seine schmalen Augen waren grau, fast silbern, wie das Meer an einem stürmischen Tag. Zaghaft hob Georgina eine Hand und strich behutsam über sein schwarzes Haar. Über seine Wange, die so weich war wie die Blütenblätter der Kemboja, und ein seliger Laut tröpfelte aus ihrem Mund.
Verzückt betastete sie die Finger der kleinen Faust, die vollkommenen, so winzigen Fingernägel aus Perlmutt, und sie strich lächelnd über die Furchen an den Gelenken seiner Beine, fuhr einzeln über jeden Zeh.
Sie schaute genauer hin, entfaltete ängstlich erst die eine Faust, dann die andere, Fingerchen für Fingerchen. Besah sich wieder seine Zehen, zählte sie mehrmals hintereinander ab, rieb schließlich so kräftig darüber, wie sie es gerade noch wagte.
»Nein«, hauchte sie entsetzt. »Nein, bitte nicht.«
Bis fast zur Spitze hinauf waren an beiden Füßen die zweite und dritte Zehe zusammengewachsen. Ein Häutchen spannte sich dazwischen. Schwimmhäute. Wie die eines Otters oder einer Robbe.
Der Selkie hatte ein Zeichen auf seinem Sohn hinterlassen.
Ein langgezogener Klagelaut floss aus Georginas Mund, und der pochende Schmerz, den die Geburt in ihrem Leib hinterlassen hatte, war wie ein Echo ihres zerrissenen Herzens.
Tränen rollten aus ihren Augen und tropften auf ihren Sohn.
Den dunklen Mutterkuchen und die silbrige Nabelschnur, den Seelenzwilling des Neugeborenen, vergrub Cempaka im Garten unter einer jungen Mangostane, eigens von Ah Tong dafür gepflanzt. Wie es hier Brauch war, damit die Seele des Kindes Wurzeln schlagen konnte in der roten Erde Singapurs.
Während er in St. Andrew’s auf die stolzen Namen seiner schottischen Vorfahren getauft wurde, plitschte Gewitterregen durch das schadhafte Dach der Kirche auf die Stirn des Säuglings.
Seine erste Taufe jedoch hatte Duncan Stuart Bigelow, der Sohn des Selkie, gezeugt unter dem Südwind, geboren in der Zeit des Ostwinds, mit den Tränen seiner Mutter erhalten.
Salzig wie das Meer, aus dem sein Vater gekommen war.