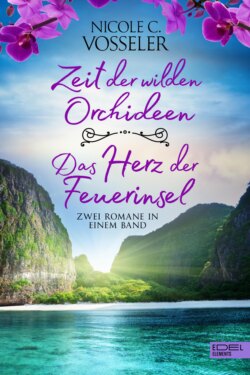Читать книгу Zeit der wilden Orchideen / Das Herz der Feuerinsel: Zwei Romane in einem Band - Nicole-C. Vosseler - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
___________
ОглавлениеViswanathan bildete sich viel auf sein Wissen über Gold und Steine ein. Mindestens ebenso viel bildete er sich auf seinen Geschäftssinn ein und auf sein Gedächtnis, in dem er nicht nur lange Zahlenkolonnen behielt, sondern auch jedes noch so kleine, noch so unwichtige Detail. Und auf seine Menschenkenntnis.
Aus dem Mann jedoch, der ihm am Tisch gegenübersaß, wurde er nicht schlau. Immer noch nicht, obwohl sie nun schon so oft Geschäfte miteinander gemacht hatten. Gute Geschäfte.
Während vor den Fenstern der Monsunregen herabrauschte, schlürfte Viswanathan geräuschvoll den Tee aus der Untertasse, den sie nach dem Abschluss eines jeden dieser Geschäfte zusammen tranken, und beobachtete verstohlen sein Gegenüber, das an seiner Tasse nippte.
Man musste genauer hinschauen, um zu erkennen, dass sein schlichtes weißes Hemd und die hellen Hosen aus erlesenen Stoffen und von sorgfältiger Hand geschneidert waren. Kunstvoll ziseliert waren auch die Griffe des Dolches und der Feuerwaffe, die in seinem Hosenbund steckten. Ungeachtet dessen, dass er stets von drei bis vier bewaffneten Männern begleitet wurde, die die Kisten ins Haus trugen und dann im Schatten der Veranda teetrinkend und betelkauend darauf warteten, bis ihr Herr wieder aufbrach.
Malaien waren es, so wie er selbst vermutlich; manches an ihm war anders, als Viswanathan es von den Malaien kannte, denen er bislang begegnet war, bis hin zu seinem eigenwilligen Zungenschlag.
Hoch erhobenen Hauptes betrat er jedes Mal das Haus, selbstbewusst, fast überheblich, obwohl er sich Viswanathan gegenüber nie herablassend zeigte. Seine Rede hielt er aufs Nötigste beschränkt; ernst, ohne unfreundlich zu sein, lachte er nie und deutete nur selten so etwas wie ein Lächeln an. Und sobald er über die Schwelle trat, schien er stets den salzigen Hauch des Meeres mitzubringen.
Er war schwer auf ein bestimmtes Alter zu schätzen. Sein Auftreten war das eines Mannes, der viel gesehen und viel erlebt, der es zu etwas gebracht hatte. Schlank und hochgewachsen, bewegte er sich mit der geschmeidigen Kraft jüngerer Jahre. Jung war auch noch sein Gesicht, aber bereits mit Linien von Enttäuschung und Bitternis darin, die ihm auf den ersten Blick einige Jahre mehr aufluden. Ein hartes Gesicht war es, mit einer schweren Kinnlinie und scharfen Wangenknochen. Hart wirkten auch seine Augen, steinern beinahe; nachtschwarz waren sie wie sein kurzgeschnittenes, welliges Haar. Ein Mann, den Frauen offenbar gutaussehend und anziehend fanden. Überaus anziehend sogar, und Viswanathan unterdrückte ein Seufzen.
Schattenmann nannten ihn viele, weil man kaum etwas über ihn wusste, außer, dass er reich war und ein großes Haus hatte. In der Serangoon Road, weit hinter den Viehweiden und Ziegelbrennereien, den Feldern und Bauernhöfen, den Sümpfen und Wäldern. Irgendwo am Fluss, unterhalb der Behausungen der Coolies mit ihren Schweinepferchen und der malaiischen Dörfchen und hinter hohen Bäumen verborgen. Manche erzählten sich, dass die umherstreifenden Tiger sich nie bis an dieses Haus wagten, weil sie die Macht seines Besitzers fürchteten; Viswanathan jedoch hielt das für den Aberglauben schlichter Gemüter.
Ungreifbar und flüchtig war er, verschwand von Zeit zu Zeit spurlos an Bord seines wendigen Schiffs, um mit Gold und manchmal einer Handvoll Diamanten aus Borneo zurückzukehren, die ihn noch reicher machten. Mit Perlen, Perlmutt und Korallen aus dem Meer. Mit honigleuchtendem Bernstein aus Kalimantan, seltener mit Bernstein aus Sumatra, der golden war, wenn man durch ihn in die Sonne schaute, aber olivgrün, wenn das Licht auf ihn fiel, und für den Viswanathan hohe Preise erzielt hatte. Und zwei Mal hatte er etwas so Seltenes, Kostbares mitgebracht, dass es selbst einem Händler wie Viswanathan, der schon alles gesehen zu haben glaubte, die Sprache verschlagen hatte: Bernstein, blau wie geschmolzener Lapislazuli. Ein gefrorener Tropfen aus dem tiefsten Ozean.
Wie ein Strandräuber kam er Viswanathan dabei vor, der sich ziellos über die Meere treiben ließ und unterwegs einfach aufsammelte, was er im Sand fand.
Dieser Mann, den Viswanathan unter dem Namen Raharjo kannte. Ein Name wie ein Glücksbringer, der Reichtum verhieß.
Puppenspieler nannten ihn andere, weil er längst nicht überall selbst in Erscheinung trat, sondern im Hintergrund die Fäden zog, manchmal über eine lange, verzweigte Kette von Mittelsmännern hinweg. Und nicht wenige waren überzeugt, dass manch ein Faden durch seine Finger lief, wenn wieder einmal eine chinesische Dschunke, ein europäisches Handelsschiff in die Hände von Piraten fiel, die allen Anstrengungen der Briten zum Trotz weiter ihr Unwesen auf den Meeren vor Singapur trieben, Malaien, Bugis, aber zunehmend auch Chinesen.
Wo es ein Meer gibt, gibt es auch Piraten, sagte man in Singapur.
Geräuschlos schob sich die Tür am anderen Ende des Raumes auf. Seine Frau steckte den Kopf herein, bereits einen Anflug von Verärgerung auf ihrem mondrunden, sonst sanftmütigen Gesicht. Sie winkte ihm in einer Geste, die ihre Ungeduld verriet.
Viswanathan unterdrückte abermals ein Seufzen und setzte sein gewinnendstes Lächeln auf.
»Ich weiß, Ihr seid ein vielbeschäftigter Mann … Aber vielleicht findet ihr dennoch die Zeit, zum Essen zu bleiben? Es wäre meiner Frau und mir eine Ehre, Euch zu Gast zu haben.«
Es entsprach ihm nicht, einen solchen Besuch über den obligatorischen Handschlag zum Abschluss des Geschäfts und die Tasse Tee oder Kaffee danach hinaus auszudehnen. Er legte keinen Wert auf nähere Bekanntschaft mit den Händlern, auf persönliche oder gar freundschaftliche Beziehungen. Seine Waren und der Preis, den er dafür bekam, waren alles, was für ihn zählte; falls jemand ihm sie nur dann abnehmen wollte, wenn er ihm schöntat, bot er sie lieber woanders an.
Dennoch nahm Raharjo diese Einladung Viswanathans an. Vielleicht, weil er es für angebracht hielt, diese für beide Seiten mehr als gewinnbringende Geschäftsbeziehung wenigstens ein einziges Mal zu feiern; vielleicht aber auch, weil er witterte, dass der Händler dabei etwas im Sinn hatte, das über den Erwerb von Perlen und Korallen hinausging, und damit seine Neugierde weckte.
Dafür sprachen auch die unzähligen Schüsseln auf dem Tisch, und dass Viswanathans Frau Sujata, die er noch nicht oft gesehen hatte, ihn ehrerbietig begrüßte und ihm die aufgetragenen Speisen aufzählte.
Reis mit Schalotten, Knoblauch, Cashewnüssen und Rosinen, gewürzt mit Zimt, Koriander und Kreuzkümmel. Reis mit Kurkuma, Reis pur. Ikan Pindang, Huhn in Kokosmilch und Tamarindensaft, scharf durch Chilis und frisch durch Zitronengras. Verschiedenen Fisch, Garnelen, Hummer. Bunte Chutneys und Sambals und Currys. Früchte wie Mango, Nangka, Papaya, Mangostanen.
Ein Festmahl wie für einen Sultan.
»Greift zu, greift zu!« Mit lebhaften Gesten wies Viswanathan auf die dampfenden Schüsseln. »Eine kleine Auswahl aus unserer Küche, in der sich neue und alte Heimat mischen.«
Über die Sträflinge und die kleine Garnison der Sepoys hinaus lebten viele Inder in Singapur: Die Orang Kling, nach dem alten Königreich Kalinga, das in früheren Zeiten mit der malaiischen Halbinsel und den Inseln Nusantaras Handel getrieben hatte.
Tausende mussten es inzwischen sein, die meisten aus dem Südwesten, aber auch aus Ceylon und dem Sindh, aus Gujarat und Kerala; Hindus, Muslime, eine Handvoll Christen. Angestellte und Schreiber in den Kontoren der Godowns und der Verwaltung, Arbeiter in den Ziegelbrennereien und auf den Feldern, Viehzüchter und Hirten, Bauern und Handwerker, und die Unberührbaren mischten sich als Coolies unter die Chinesen. Viele eröffneten kleine Läden oder versuchten sich im Handel, und manche wurden reich damit wie Viswanathan.
Besonders augenfällig waren die Chettiars, eine Händlerkaste aus Südindien, mit ihren markanten Gesichtszügen und der dunklen Haut, gegen die der helle Sarong und Schal grell abstachen, oft noch weiße Streifen auf Gesicht, Arme, Brust gemalt. Hier auf der Kling Street hatten sie ihre schmalen Geschäftshäuser, in denen sie Geld an kleine Geschäftsleute, Arbeiter, fliegende Händler und Pflanzer verliehen und davon sehr gut lebten, wie auch in der Market Street, in der Nähe des Marktes von Telok Ayer, dem pulsierenden Herzstück des chinesischen Viertels.
»Als ganz junger Mann bin ich hierhergekommen, nach Singapur. Aus Cuddalore. Über Malakka, wo Verwandte von mir leben. Stammt Ihr von hier? Aus dieser Gegend?«
Raharjo nickte.
»Ah.« Viswanathan lächelte breit, und sein gepflegter graugestromerter Bart, halb verborgen unter der vorspringenden Nase, zitterte vergnügt. »Meine Frau ebenfalls. Aus Johor.«
Er sah zu Sujata hinüber, die sich in einen Winkel des Raumes zurückgezogen hatte, die Stirn mit dem roten Tupfen der verheirateten Frau demütig gesenkt, die Hände vor dem Schoß ihres purpurfarbenen Saris ineinandergelegt.
»Seid Ihr Muslim? Oder Christ?«
»Weder noch.«
Eine Antwort, die Viswanathan zufriedenzustellen schien; zumindest fragte er nicht weiter nach.
Die Tür öffnete sich leise und schloss sich wieder, und ein zarter Duft wie von Rosen wehte zu Raharjo herüber.
»Möchtet Ihr noch Tee, Tuan?« Eine sanfte Frauenstimme neben ihm, jung und zittrig.
Raharjo nickte.
»Meine Tochter Leelavati.«
Für gewöhnlich kümmerte es ihn nicht, wer ihm in diesem Haus den Tee eingoss, meistens irgendein spilleriges Bürschlein, von dem er nicht einmal wusste, ob es stets derselbe war; erst Viswanathans Bemerkung ließ ihn aufblicken.
Mit gesenktem Scheitel und unsicherer Hand schenkte ihm das junge Mädchen nach; die Goldreifen an ihren kräftigen Armen klimperten, während der Tee in einem wackeligen Strahl die Tasse füllte. Der Sari in der Farbe reifer Aprikosen ließ ihre Haut, die kaffeebraun war wie die ihres Vaters, noch dunkler wirken, und obschon der Ausschnitt ihres Choli züchtig gehalten war, ließ das eng anliegende Leibchen frauliche Rundungen erkennen. Ihr Gesicht glich dem ihrer Mutter: rund und flach wie der Mond, mit einem übergroßen, vollen Mund in einem satten Rosenholzton. Die Flügel ihrer breiten Nase bebten, als sie sich verneigte, dabei einige Tropfen verschüttete und sich mit der Kanne in der Hand neben ihre Mutter stellte.
»Habt Ihr auch Kinder?«
Raharjo verneinte.
»Dann werden die Götter Euch und Eurer Frau sicher noch welche schenken.«
»Ich bin nicht verheiratet.«
Nicht mehr.
»Ah.«
Das Strahlen auf Viswanathans Gesicht erhellte den kleinen Raum mit den geweißelten Wänden und dem schweren, dunklen Mobiliar. Er nickte den beiden Frauen zu, die sich auf leisen Sohlen und unter dem Geraschel ihrer Saris entfernten und die Tür hinter sich schlossen.
»Falls ich alter Mann Euch einen Rat geben darf … Wartet nicht zu lange mit der Ehe. Nicht so wie ich. Als ich noch jung war, verwendete ich all meine Aufmerksamkeit und Kraft auf das Geschäft. Erst fehlte mir die Zeit, mich nach einer Frau umzuschauen, dann fand ich lange keine. Als ich meine Sujata endlich gefunden hatte, waren wir beide nicht mehr die Jüngsten. Lange haben wir auf ein Kind gewartet, und am Ende ist uns nur eine Tochter vergönnt gewesen. Nun bin ich alt und in Sorge, wer nach mir mein Geschäft übernehmen wird. Es einem tüchtigen Schwiegersohn oder einem Kindeskind zu hinterlassen wäre mir bedeutend lieber, als aus Indien einen Neffen oder den Sohn eines Vetters dafür herzuholen.«
Stumm hörte Raharjo ihm zu, bereits vorausahnend, welchen Kurs Viswanathans Rede einschlagen würde.
»Siebzehn ist Leelavati jetzt. Schon längst im heiratsfähigen Alter. Oh, an Bewerbern um ihre Hand mangelt es nicht! Ihr habt sie gesehen, sie ist ein liebreizendes Mädchen! Aber ich muss mit Bedacht vorgehen, was meinen künftigen Schwiegersohn angeht. Vieles muss ich dabei in Betracht ziehen. Nicht zuletzt, weil es natürlich auch um Geld geht.« Er senkte seine Stimme zu einem bedeutungsschwangeren Flüstern. »Viel Geld.«
Seinen erwartungsvollen Blick beantwortete Raharjo mit einem auffordernden Heben der Brauen.
»Leelavati ist gut erzogen. Behütet und zurückgezogen aufgewachsen, wie es sich gehört.« Viswanathans Miene verdüsterte sich. »Ich will allerdings ganz offen zu Euch sprechen. Ich fürchte, wir haben unser einziges Kind zu sehr verwöhnt. Zu nachgiebig sind wir wohl gewesen, wo sie eine starke Hand gebraucht hätte.«
Er fing den Blick auf, den Raharjo ihm zuwarf, und wedelte abwehrend mit den Händen.
»Nicht, was Ihr womöglich denkt! Sie ist ein sittsames Mädchen, von makellosem Ruf und Benehmen. Nur manchmal ein wenig … eigenwillig.« Er kratzte sich hinter einem seiner abstehenden Ohren. »So hat sie sich in den Kopf gesetzt, Euch zum Mann zu bekommen.«
Raharjo starrte ihn an.
»Sie muss Euch wohl von den Fenstern hier oben aus gesehen haben, wenn Ihr kamt oder gingt.« Beschämt schielte Viswanathan ihn über seine markante Nase hinweg an. »Seitdem liegt sie uns damit in den Ohren, dass sie keinen anderen will als Euch.« Er seufzte. »Ich weiß nicht viel über Euch, aber ich weiß, dass Ihr mir gegenüber immer rechtschaffen gehandelt habt. Dass Ihr ein guter Geschäftsmann seid. Und von untadeligem Leumund. Könnte ich mir einen besseren Mann für meine Tochter wünschen? Noch dazu, wenn ihr ganzes Herz daran hängt? Leelavati wird Euch eine geschickte und verständige Hausfrau sein. Euch viele Söhne schenken. Und sie wird einen großzügigen Brautschatz mit in die Ehe bringen.«
Mit den glänzenden Augen eines gewieften Händlers, der ein besonders lohnendes Geschäft wähnt, setzte er eifrig hinzu: »Was sagt Ihr?«
Raharjo schwieg.
Es war nicht das erste Angebot dieser Art, das Raharjo erhalten hatte, aber mit Abstand das beste: Viswanathan war nicht nur vermögend, sondern dazu noch ein angesehener Bürger der Stadt. So verwurzelt, wie man in Singapur nur sein konnte, mit einem weit verästelten Netz an Beziehungen.
Drei Mal kam er noch zum Essen in die Kling Street, jedes Mal saßen Sujata und Leelavati mit am Tisch, ohne mitzuessen. Schweigend, mit gesenkten Lidern und glühenden Wangen das Mädchen, ein kaum verhohlenes glückliches Lächeln auf den Lippen. Redseliger und neugieriger ihre Mutter, die vor allem erleichtert schien, dass im Haus in der Serangoon Road keine Schwiegermutter auf ihre Tochter warten würde.
Raharjo kam nicht mehr oft an den Kallang River. Nicht, seit auch seine jüngste Schwester geheiratet und sich irgendwo auf der Insel niedergelassen hatte, wie fast alle Orang Laut seines Stammes nach und nach vom sesshaften Leben der Malaien aufgesogen wurden wie Wasser von einem unglasierten Ziegelstein. Nicht, seit sein Vater im vergangenen Jahr gestorben war, friedlich, an Bord seines Bootes, was Raharjo kaum berührt hatte. Wie ihn kaum noch etwas berührte.
Unangenehm waren ihm die Fragen seiner Mutter, seines jüngeren Bruders und dessen Frau, wann er endlich seine Braut mitbrächte, ob sie nicht endlich ein Kind erwarteten. Er schämte sich, zugeben zu müssen, wie sehr er getäuscht worden war.
Er wollte nicht von Nilam erzählen, die ihn an der Nase herumgeführt hatte wie einen Fisch, dem man mit Federn eine Mücke vorgaukelte, und ihn damit fing. Nicht von Georgina, der schönen weißen Frau, die ihn verraten und ihm kaltblütig das Herz herausgerissen hatte. Es kränkte ihn in seinem Stolz, dass sie das Geld nicht nahmen, das er ihnen geben wollte, weil sie nach wie vor vom Tauschhandel lebten, es gegen ihre Ehre als Orang Laut verstieß, sein Geld zu nehmen, für das sie ihm nichts zurückgeben konnten. Erst jetzt, so viele Jahre später, bekam er zu spüren, dass er seiner Wurzeln verlustig gegangen war, indem er in eine andere Richtung wuchs als seine Brüder, seine Schwestern.
Es war Zeit, eine eigene Familie zu gründen.
Als Viswanathan zu guter Letzt noch etwas mehr zum Brautschatz dazugab, Raharjo schulterzuckend zustimmte, dass Leelavati weiter ihren Glauben frei ausüben und die zu erwartenden Kinder als Hindus erziehen durfte, war man sich einig, und die beiden Männer besiegelten die Verlobung mit einem entschlossenen Händedruck.
Ein Astrologe wurde geholt, der das Horoskop des Paares erstellen und einen günstigen Tag für die Vermählung bestimmen sollte. Was bei Raharjo schlichtweg nicht möglich war, da er weder das genaue Jahr kannte, in dem er geboren worden war, geschweige denn Monat oder Tag oder gar die Stunde. Nur die Jahreszeit und den Ort: in der Zeit des Nordwinds, in einem Boot östlich der Küste Singapurs.
Der Astrologe stöhnte und schimpfte, schätzte und rechnete und präsentierte schließlich für viel, viel Geld ein Horoskop voll ehelicher Harmonie, Glück und Kindersegen. Für die Hochzeit empfahl er einen besonders verheißungsvollen Tag: in der Zeit des Ostwinds, im Monat Pankuni des tamilischen Kalenders, dem April.
Die Nacht war still.
Nur der Wind war zu hören, der durch die Blätter der hohen Bäume raunte, die er hatte stehen lassen, der Setzlinge, die er im noch jungen Garten hatte pflanzen lassen. Drei neue waren frisch hinzugekommen, von Feige, Banyan und Neem, für die drei Gottheiten Shiva, Vishnu und Shakti.
Leise murmelte der Fluss jenseits des Gartens, sprudelte munterer die Anlegestelle aus Stein und Holz entlang, die er für sein Boot hatte bauen lassen. In den feuchten Wiesen schnalzten gedämpft die Ochsenfrösche, und irgendwo über seinem Kopf keckerte ein Gecko im Gebälk der Veranda.
Ein großes Haus hatte er sich gebaut, beinahe so groß wie der Istana, der Palast des Sultans von Johor.
Blendend weiß waren die hohen, weiten Räume auf beiden Stockwerken, mit dunklem, glänzend poliertem Holz für Böden, Balken und Treppen, schlicht und sparsam eingerichtet, fast spärlich. Ein Haus, durchflutet von einem Licht, das gewichtslos war, zart eingefärbt vom Grün der Bäume und Sträucher und flirrend in den Sonnenstrahlen, die auf dem Wasser funkelten. Ein luftiges Haus, durchzogen vom Atem des Flusses, einer Ahnung des nahen Meeres. Von Flügelschwirren und Vogelgesang, dem Knistern der schillernden Libellen.
Kulit Kerang hatte er sein Haus genannt. Wie sein Schiff. Muschelschale.
Eine köstliche Stille war es in dieser Nacht, wohltuend nach dem Trubel der vergangenen vier Tage.
Ein rauschendes Fest war diese Hochzeit gewesen, im über und über geschmückten und zur Kling Street hin mit einem Pandal, einem Baldachin aus Seide und Blumenschmuck, versehenen Haus der Braut. Halb Singapur hatte Viswanathan eingeladen, zumindest den indischen Teil, und viele Chinesen. Raharjos Gäste, eine Handvoll seiner besten Männer, Orang Laut wie er, hatten sich in dieser lärmenden, feiertaumeligen Menschenmenge vollkommen verloren.
Vier Tage, die von früh bis spät mit feierlichen Ritualen und Gesten angefüllt waren und am Abend des vierten Tages in einer großen Zeremonie ihren Höhepunkt fanden. Nach rituellen Waschungen, Opfergaben und Anrufungen der Götter hatten Braut und Bräutigam einander prächtige Kleidungsstücke überreicht, hatte Raharjo seine Braut vom Schoß ihres Vaters übernommen. Blütengirlanden hatten sie einander um den Hals gelegt, und gemeinsam waren sie sieben Mal ums Feuer geschritten, später dann in einem festlichen Zug mit einem offenen, blumengeschmückten Wagen quer durch die Stadt gefahren, von der Kling Street über den Singapore River bis hierher.
Sein Kopf schwirrte von den monotonen Gesängen und Gebeten in einer Sprache, die er nicht verstand, von einer schrillen, scheppernden Musik, die ihm in den Ohren schmerzte. Von all den Stimmen, dem schallenden Lachen und Händeklatschen und dem Lärm, den viele Menschen auf engem Raum verursachten. Vom Glitzern und Funkeln von Gold und geschliffenen Edelsteinen, den leuchtenden Farben von Rot und Gelb und Weiß. Den verschwenderischen Mustern überall, die ihm Schwindel verursacht hatten.
Übel war ihm von all dem Räucherwerk und Blütenduft, von den intensiven Gerüchen nach Safran und Kurkuma, von den Ausdünstungen vieler Leiber und von Panaham, Wasser mit Rohrzucker, Kardamom und schwarzem Pfeffer, das das Brautpaar gemeinsam getrunken hatte.
Er sehnte sich nach der Ruhe des offenen Meeres. Nach dem Rauschen der Wellen und des Windes, das eins war mit seinem Herzschlag, seinem Atem. Nach der klaren, frischen Luft an Deck und nach endloser, einsamer Weite.
Danach, nicht von der Erinnerung an eine andere Hochzeit gemartert zu werden.
Eine Hochzeit unter dem Wind, in einem Boot zwischen kühlem Meer und freiem Himmel. Blut und Nässe und Fischschuppen unter den Händen und die weiche, hellgoldene Haut einer Frau, die sich ihm für immer versprochen hatte.
Leelavati wartete bereits auf ihn. In dem Zimmer im oberen Stockwerk, in dem sie von nun an als Mann und Frau beieinanderliegen würden.
Auf der Kante des breiten Brautbetts saß sie, ihr schwarzes Haar glänzend über ihre Schultern ausgebreitet. Sie schrak zusammen, als er eintrat. Ihre Hand, wie die Füße von filigranen Ornamenten aus Henna geziert, flog zum Ausschnitt ihres rotseidenen Morgenrocks und zog ihn enger zusammen, und die Reifen in Rot und Silber, die ihre Arme bis fast zu den Ellbogen hinauf bedeckten wie der Teil einer Rüstung, klirrten scharf. Dabei lächelte sie jedoch, und ihre dunklen Augen strahlten.
»Heute ist der glücklichste Tag in meinem Leben«, hauchte sie.
Wenig hatten sie miteinander gesprochen in den Wochen seit der Verlobung, kaum mehr als ein paar Sätze.
Ist es dir recht, wenn ich eine Frau einstelle, die für dich da ist, oder bringst du jemanden von zu Hause mit?
Oh, das wäre mir sehr recht, vielen Dank!
Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich in einem Winkel des Hauses einen Schrein aufstelle? Ist auch ein ganz kleiner, vielleicht fällt er dir nicht einmal so sehr ins Auge.
Wie du willst.
Er wünschte, sie würde aufhören, ihn auf diese Weise anzuschauen. Als wäre er ein Prinz, von einer Wolke herabgestiegen, die Jungfrau vor einem Ungeheuer zu erretten. Ein Jungmädchentraum, zu Fleisch und Blut geworden. Und dennoch erwachte in ihm der Hunger, ihren jungfräulichen Leib zu besitzen.
Er drehte ihr den Rücken zu und zog sich das lange, bestickte Hemd über den Kopf.
»Soll … soll ich mich auch entkleiden?«, wisperte es hinter ihm. »Und hinlegen?«
Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Eine solche Hochzeitsnacht war etwas anderes als seinem Begehren auf irgendeiner Insel nachzugeben. Mit einem Mädchen, einer Frau, die ihm fremd war und es auch bleiben würde. Die ihm fernblieb, auch wenn er sich körperlich in ihr verlor, für wenige, viel zu kurze Augenblicke eines lustvollen Rausches. Eines Vergessens, das linderte, aber nicht zu heilen vermochte.
Es hatte viele davon gegeben, in den letzten vier Jahren.
»Wie du willst.«
Ein dumpfes Pochen kroch ihm den Nacken hinauf, in Richtung seines Schädels.
Er hörte es rascheln und drehte sich um. Den Morgenrock mit beiden Händen zusammengeklammert, hatte sie sich auf dem Bett ausgestreckt und lächelte ihm entgegen, Aufregung und Angst, vor allem aber erwartungsvolle Sehnsucht im Blick.
»Soll ich das Licht löschen?«, fragte er und stieg auf das Bett.
»Wie du es lieber hast.«
Er zögerte. Die Götterstatue auf dem Tischchen neben dem Bett entschied schließlich für ihn. Sujata hatte sie heute Abend mit ins Haus gebracht, bevor sie sich tränenreich von ihrer Tochter verabschiedete. Ein hässlicher Kobold von blauer Hautfarbe, einen selbstzufriedenen Ausdruck auf dem Gesicht.
Das Licht verlosch, Nacht füllte den Raum.
Er schlüpfte aus seinen Hosen und schlug ihren Morgenrock auseinander, beugte sich über sie. Der Duft der ausgestreuten Jasminblüten mischte sich mit dem ihres Haares, nach Rosenöl und Sandelholz. Mit dem schweren, würzigen ihrer Haut, wie tief aufgewühlte, feuchte Erde, und das Pochen in seinem Kopf wurde stärker.
Nur kurz streifte sein Mund über ihren; er mochte es nicht, wie willig ihre Lippen sich unter seinen öffneten. Ihre Brüste waren voll und schwer unter seinen Händen, ihre Taille schmal, und ihr strammer kleiner Bauch, ihre runden Hüften liefen in ein weiches Vlies aus, unter dem eine leise Glut schwelte.
Sie zitterte, atmete schwer, streichelte unbeholfen über seine Schulter und murmelte etwas, das lockend klang.
Etwas riss in ihm. Ein roter Blitz, der hinter seinen Augen aufflammte. Hunger, der in eine triebhafte Gier umschlug.
Grob packte er ihre Hand und drückte sie auf das Laken, zwängte ihre Schenkel auseinander und stieß in sie hinein. Er genoss es, als ihr Jungfernhäutchen riss, wie sie sich verkrampfte und aufschrie, genoss das Reiben, das Scheuern. Berauschte sich an seiner eigenen Gewalt und brüllte auf, als sich dieser Rausch in einer grellen Explosion entlud.
Keuchend ließ er sich auf die andere Seite des Bettes fallen. Funken pulsierten hinter seinen Augen, schmerzhaft hämmerte es in seinem Schädel, und erst ein schwarzer, bleischwerer Schlaf brachte Erleichterung.
Unbeweglich starrte Leelavati in die Dunkelheit, zwischen ihren Beinen aufgeschürft und wund, klebrig von Samen und Blut. Ihre Träume zerdrückt wie die Blüten unter ihr, ihr Herz zertreten. Bis sie die Kraft aufbrachte, sich umzudrehen und leise in ihre Kissen zu weinen.