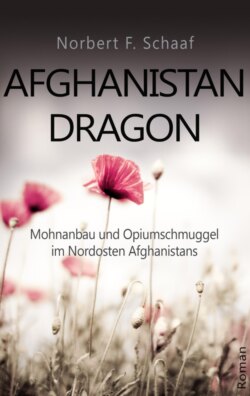Читать книгу Afghanistan Dragon - Norbert F. Schaaf - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление8
Die Schlucht lag einen Kilometer westlich von Karambar. Der Trampelpfad, der von der Siedlung zu ihr führte, zweigte kurz vor den ersten Felsen nach Norden ab und verlief dann über langsam ansteigendes Gelände in die Gegend, in der die Bewohner ihre Mohnfelder angelegt hatten. In der Schlucht war es kühl, und es herrschte selbst am hellen Tag ein dämmeriges Licht, weil die Sonne von den flachen ausladenden Kronen der niedrigen Büsche abgefangen wurde, die oberhalb der Felsen wuchsen. Es war einer jener Schluchten, deren safranfarbige, rötlich und violett schimmernde Felsmassen sich fast berührten und nur einen schmalen Spalt knallblauen Himmels freigaben. In der schwindelerregenden Höhe drohten mächtige Steinklötze, als warteten sie nur darauf, von irgendwelchen Unholden auf fremde Eindringlinge hinabgeschleudert zu werden. Ging man durch die Schlucht weiter, einige hundert Meter, gelangte man wieder in offenes Gelände, das stetig anstieg, bis dorthin, wo die Grenze zu Pakistan zum Greifen nahe schien. Es war kein weiter Weg dorthin, kaum eine halbe Stunde musste man gehen, doch die Leute aus Karambar konnten nicht sagen, wo genau die Grenzlinie verlief. Sie war nicht markiert, und wenn sie einmal markiert gewesen sein sollte, so hatte der dschangal diese Markierungen längst überwuchert. Ein breiter werdender Pfad verlief in südlicher Richtung, in das Gebiet, von dem die Leute aus Karambar wussten, dass dort ein oder zwei Tagesmärsche entfernt die ersten Siedlungen der Nuristani lagen. Kleine Dörfer, verlassen wirkend, in tiefem Gehölz versteckt, fast ohne jede Verbindung mit der Umwelt.
Auch die Lage dieser Dörfer war nur ungenau zu bestimmen, denn die Nuristani verfuhren ebenso wie die Paschai, die weiter im Norden lebenden Gujar und andere bei der Anlage ihrer kleinen Felder, auf denen sie lebensnotwendige Nahrungsmittel zogen, immer noch nach der alten Methode der Brandrodung. Sie zündeten in der trockenen Jahreszeit ein Stück Dornenbuschland an, ließen es abbrennen, arbeiteten die Asche in die Erde ein und bebauten dann später diesen Boden. Sie ackerten den Boden nicht um, und sie düngten ihn auch nicht. Nach spätestens zwei oder drei Jahren gaben die Felder keine nennenswerten Ernten mehr her. Dann pflegten die Nuristani einfach ein weiteres Stück Buschwald abzubrennen und darauf neue Felder anzulegen. Einen geeigneten Platz fanden sie oft erst mehrere Kilometer von der alten Ansiedlung entfernt; daraus hatte sich die Sitte entwickelt, die alte Siedlung einfach zu verlassen und in der Nähe der neuen Felder eine neue Siedlung anzulegen. Da sie stets mit dem Namen der verlassenen bezeichnet wurde, verschob sich so im Verlaufe von Jahren die Lage eines einmal auf der Landkarte festgehaltenen Dorfes ganz erheblich, und es war von Leuten, die sich nach der Landkarte orientierten, einfach nicht mehr zu finden. Selbst in Karambar ließe sich derzeit über die Lage der nächsten Siedlung auf pakistanischer Seite nur sehr ungenaue Angaben machen. Im Grunde interessierte das auch niemanden. Die nomadischen Nuristani waren eigen. Ihre Sprache war anders. Ihre Sitten unterschieden sich von den anderen. Handel mit ihnen zu treiben lohnte kaum. Man hatte keine Feindschaft mit ihnen, denn es gab für eine Feindschaft keinen Grund. Sie waren Grenzgänger zwischen Afghanistan und Pakistan. Erst in den letzten Jahren war man wieder darauf aufmerksam geworden, dass es jenseits der Grenze Vorgänge gab, die sich auf die Siedlungen diesseits der Grenze auswirkten.
Das Dutzend Männer, das am Nachmittag, von Pakistan kommend, in die Schlucht zog, die zwischen Karambar und der pakistanischen Grenze lag, führte Kamele mit, die in Plastiksäcke verpacktes Rohopium trugen. Der Anführer, ein kleiner, säbelbeiniger Mann von einem Stamm der Panjshiri, war mit einem M-16-Gewehr bewaffnet, die übrigen trugen Maschinenpistolen. Sie waren in Uniformen gekleidet, wie sie von den US-amerikanischen Soldaten im Irakkrieg getragen wurden. Nur Abzeichen wiesen sie nicht auf. Die Kameltreiber, die ihre Kopfbedeckungen über Stirn und Ohren gezogen und die Gesichter in den Pelzkragen vergraben hatten, wechselten kein Wort miteinander, als müssten sie ihre Kräfte sparen, um gegen die Kälte der Höhe und der Freveltat zu bestehen.
Der Anführer öffnete einen Sack und streute eine Wegspur über die ihren Pfad kreuzende Gletscherzunge, die so glatt war, dass die Kamele sich sonst nicht darauf wagen konnten. Der Berg war äußerst steil. Die Tragtiere mit ihren schaukelnden vorderen Höckern sträubten sich, und die Kameltreiber mussten sie anfeuern. Die Karawane hielt alle fünfzig Meter an, um Atem zu schöpfen. Urplötzlich stürzte das letzte Kamel am Rand des Abgrundes, wälzte sich jedoch instinktiv zur Seite und einen Meter zurück. Unter Einsatz ihres Lebens befreiten die Kameltreiber das Tier von seiner Last, damit es wieder aufstehen konnte. Am östlichen Ausgang der Schlucht hob der Anführer die Hand und ließ den Trupp halten. Er blickte sich in der Gegend um und vergewisserte sich, dass keine Menschen in der Nähe waren.
Banshef Mehdoor war ein vorsichtiger Mann, obwohl er noch jung war, vielleicht neunundzwanzig Jahre. Das Dorf, aus dem er stammte, lag mehr als hundert Kilometer von dieser Schlucht in Afghanistan entfernt. Banshefs Vater Hamud, ein gesuchter Autobusräuber, hatte schon den US-Amerikanern als Pfadfinder ihrer Kommandotrupps gedient, damals, als die Russen Afghanistan besetzten. Mittlerweile führte sein Sohn einen Trupp Bewaffnete, wiederum im Dienst der US-Amerikaner. Er zog mit seinen Leuten nicht planlos durch die Berge. Zu Hause, in Irshad, lebte Kaplan Gabriel. Sein Name war für die Einheimischen irreführend. Er arbeitete als Heilpraktiker und Entwicklungshelfer, war aber tatsächlich ein Pater und lehrte die Paschai ebenso heimlich wie gesetzwidrig das Evangelium, worauf der Koran beruht, seit mehr als zwanzig Jahren. Wer ihn allerdings näher kannte, der wusste, dass in Kaplan Gabriels Lehmhaus ein kleines, leistungsfähiges Fernsprechgerät stand, mit dem er täglich Verbindung zu einer US-amerikanischen Dienststelle in Kabul hatte. Diese Dienststelle war es, die den Trupps der Panjshiri die Waffen lieferte und die Munition, zuweilen auch Reis oder andere Lebensmittel, Tabak und jenes Getränk, das zwar sowohl schneller berauschte als die einheimische vergorene Stutenmilch, freilich auch besser schmeckte, den Whisky.
Kaplan Gabriel besaß genaue Karten von Nordpakistan, auf denen jede Straße, jeder Brückensteg und selbst die kleinste Siedlung verzeichnet waren. Er empfing mit seinem Satellitentelefon regelmäßig Nachrichten aus Peschawar und auch aus Eshkashem am Eingang des Wakhan-Korridors zu China, und immer wenn von irgendeinem Stützpunkt Soldaten ausrückten, um gegen die Marodeure und Schmuggler in den Bergen eingesetzt zu werden, erfuhr Kaplan Gabriel das einige Tage vorher. Von Zeit zu Zeit wählte Kaplan Gabriel aus den jungen Burschen, die zu den Banditentrupps gehörten, die intelligentesten aus und brachte ihnen das Alef-beh bei, wobei er ihnen gleichzeitig die Fähigkeit vermittelte, sich in der Sprache ihrer Ausbilder einigermaßen zu verständigen. War das getan, verschwanden diese jungen Burschen für etliche Monate. Durch Afghanistan wurden sie nach Usbekistan gebracht, wo sie auf US-amerikanischen Truppenübungsplätzen militärisches Training absolvierten. Wenn sie heimkehrten, übernahmen sie die Führung weiterer Trupps von bewaffneten dozds.
Auch Banshef war in Usbekistan ausgebildet worden, was ihm unter seinen Männern unbegrenzte Autorität eingebracht hatte. Als er ihnen jetzt befahl, die Tiere im Schutz der Schlucht festzubinden, sie abzuladen und zwei Posten oberhalb der Schlucht aufzustellen, befolgten sie seine Anweisung ohne Widerrede. Einer öffnete einen Behälter mit Rationspackungen, und der Trupp ließ sich zur Rast in der Schlucht nieder. Doch die Ruhe dauerte nicht lange, denn schon nach einigen Minuten meldete der Posten am östlichen Zugang das Nahen eines Mannes.
Banshef kletterte auf einen Felsen und hob sein Fernglas an die Augen. Bald konnte er die Gestalt erkennen, die sich durch das fast mannshohe Buschwerk näherte. Es war Jalaluddin. Der Anführer ging ihm entgegen. Als er nahe genug heran war, rief er ihn an: „He, Jalaluddin!“
Der Alte blieb erschrocken stehen. Schließlich erkannte er Banshef und sagte vorwurfsvoll: „Du bist das! Warum lauerst du mir auf?“
Der Anführer grinste vergnügt. „Wir sind eben angekommen. Hatten noch keine Zeit, einen Mann ins Dorf zu schicken.“
„Was wollt Ihr?“
„Austausch“, antwortete Banshef knapp, aber mit einem Blick, der eine gewisse Entschlossenheit in Dingen des eigenen Vorteils erkennen ließ.
Jalaluddin gab einen mürrischen Laut von sich. Wie immer, dachte er. Sie kommen hierher, und wir wissen nichts. Dann kommt eine Maschine, und wir haben die Arbeit. Sie machen das mit den Nordamerikanern über ihre Funkgeräte ab, und wir spielen die Handlanger. Wir decken sie. Was für ein widerliches Spiel das geworden ist! „Ich will auf die Felder“, sagte Jalaluddin.
Der Anführer entgegnete: „Dann geh nur. Wir machen das mit Mir Khaibar ab.“
Als er hörte, dass Mir Khaibar nicht da war, zuckte er die Schultern.
Jalaluddin erzählte ihm nichts von Mir Khaibars Schicksal. Er sagte nur brummig: „Ich werde zurückgehen. Es ist sonst weiter niemand im Dorf.“
„Auch nicht euer einbeiniger, armloser Dschinn?“ erkundigte sich Banshef.
„Nein, nein“, beeilte sich Jalaluddin zu schwindeln, „heute nicht. Ist heute unten im Tal.“
Banshef grunzte zufrieden, griff in die Brusttasche seiner Tarnfleckjacke und zog ein Päckchen US-amerikanischer Zigaretten heraus. Als Geste der Friedfertigkeit hielt er Jalaluddin die Packung hin, der sich einen Stängel nahm und ihn anrauchte. Er war gewohnt, starken, grobgeschnittenen Landtabak in einer aus Bambus gefertigten Pfeife zu rauchen, doch er schätzte den Duft, der aus diesen amerikanischen Zigaretten aufstieg. Manchmal hatten die Piloten ihm ein paar Päckchen zugesteckt. Die dozds von jenseits der Grenze trugen stets einen großen Vorrat davon bei sich. Jalaluddin wusste, dass die Banditen sie meist dazu benutzten, schnell einen Zug Opium zu machen.
Auch jetzt tat der Anführer das. Er nahm aus der anderen Tasche eine kleine Dose, die mit einem schmutzigweißen Pulver gefüllt war, tupfte das Ende seiner Zigarette in dieses Pulver und brannte sie mit seinem tchaqmaq, dem im Hochgebirge als wertvollsten Besitz geltenden Flintstein, an. Er machte einen tiefen Zug und lächelte. Bei dem Pulver handelte es sich um minderwertiges Heroin, das die Panjshiri in primitiven Laboratorien herstellten. Obwohl sie von chinesischen Chemikern dazu angelernt worden waren, gelang ihnen das Endprodukt nicht vollkommen. Es war nicht mit dem hochwertigen Heroin zu vergleichen, das in den großen Zentren der Opiumverarbeitung hergestellt wurde, und es diente den dozds nur zum eigenen Gebrauch.
„Du jagst den Drachen am helllichten Tag?“ fragte Jalaluddin mit gerunzelter Stirn. Für gewöhnlich rauchten die Leute den chandu, das Rauchopium, nur am Abend, jedenfalls hier in den Bergen, und sofern sie es überhaupt taten.
„Ein bisschen“, erwiderte Banshef. „Ein Zug jetzt, ein Zug in ein paar Stunden. Es erleichtert den Marsch über die Berge.“
Jalaluddin bezweifelte das, denn obgleich die Droge imstande war, das körperliche Befinden für kurze Zeit zu heben, ließ sie doch die Leistung schon bald erheblich absinken. Doch Jalaluddin sagte nichts. Er erkundigte sich nur: „Du sagst, ihr wollt austauschen. Habt ihr etwas mit?“
„Zehn Säcke.“
„Ihr könnt sie jetzt gleich ins Dorf tragen“, schlug Jalaluddin vor. „Mir Khaibars Keller ist leer.“
Es wiederholte sich jedes Mal das gleiche. Die Piloten hatten von ihrem Boss in Kabul die strenge Anweisung, mit den Panjshiri-Leuten nicht in Kontakt zu kommen. Das war vor langer Zeit so vereinbart worden, und jeder hielt sich daran. Sie brachten mit dem Hubschrauber ihre Fracht, die Panjshiri-Leute deponierten zuvor ihr Opium in dem Keller unter Mir Khaibars Haus. Wenn die Piloten sich überzeugt hatten, dass das Opium in dem Erdkeller bereitstand, zogen sie sich zurück. Den Rest erledigte Mir Khaibar mit den Panjshiri-Leuten. Er schaffte das Opium zum Helikopter, und die Panjshiri-Leute luden die mitgebrachte Ladung selbst aus.
Mr. Oates, der vor Jahren mit Mir Khaibar diese Art des Austausches vereinbart hatte, wusste wohl, weshalb er so verfahren ließ. Niemand sollte je behaupten können, dass die Piloten der Air America mit den Panjshiri-Rebellen handelten. Das tat Mir Khaibar. Keiner der Panjshiri-Rebellen würde jemals, falls er gefangengenommen und verhört würde, beweisen können, er habe einen amerikanischen Piloten auch nur gesehen. Und keiner der Piloten würde seinerseits einen der Banditen beschreiben können, mit denen Mr. Oates Handel trieb. Selbst wenn man einen der Piloten zu einer Aussage über seine Tätigkeit brächte, würde er nur erklären können, er habe Kisten mit unterschiedlichem Inhalt in eines der notleidenden Dörfer in den Bergen des Nordens geflogen und sie dort an den Dorfvorsteher übergeben. Das war klug ausgedacht. Nichts war zu beweisen. Wenn man Mr. Oates nach dem Inhalt der Kisten fragte, würde er sogar behaupten können, es habe sich dabei um Hilfsgüter gehandelt.
Jalaluddin rauchte die Zigarette zu Ende, während Banshef zehn Leute bestimmte, die die Säcke zum Dorf tragen sollten. Als sie damit abzogen, folgte Jalaluddin ihnen. Banshef blieb zurück. Er sah auf seine Uhr und entschloss sich, noch ein wenig zu schlafen, bis die Maschine kam.
Die Panjshiri-Leute hielten sich nicht lange im Dorf auf. Sie luden die Säcke mit dem Opium ab und machten sich wieder davon. Es dämmerte und die Berge schienen ins Unermessliche zu wachsen, während alles andere zusammenschrumpfte. Jalaluddin blickte Banshefs Trupp nach. Menschen und Tiere drängten sich immer kleiner werdend an die Flanke des Berges, bis sie außer Sicht gerieten. „Die Berge sind so hoch“, bedachte Jalaluddin das hiesige Sprichwort, „dass sogar die Vögel ihren Gipfel nur zu Fuß überwinden können.“
Jalaluddin begann indes die Säcke zurechtzustellen. Der Keller war leer, bis auf einen nicht ganz vollen Sack Rohopium, der in einer Ecke stand. Man hatte ihn zurückbehalten, weil der Stoff minderwertig war. Er stammte noch von der letzten Ernte, damals hatte ein unerwartet auftretender Sturm in der Nacht zwischen dem Anritzen der Kapseln und dem Abschatten des ausgetretenen Saftes eine Menge Schmutz und Laubreste über ein Feld geweht. Als die Frauen am Morgen mit dem Abkratzen begonnen hatten, hatte es sich gezeigt, dass so viele Fremdkörper an dem ausgetretenen Seim haftengeblieben waren, dass der Stoff für den Handel unbrauchbar war. Man hatte das Feld trotzdem abgeerntet, doch seitdem stand der Sack mit dem Rohopium in Mir Khaibars Keller. Jalaluddin rückte ihn beiseite, so dass er später nicht etwa aus Versehen mit verladen werde, und legte auch noch ein paar herumliegende leere Plastiksäcke ordentlich zusammen. Als er wieder hinaufstieg, begann die Sonnenscheibe gerade hinter den Bergkämmen im Westen zu versinken. Violettes Grau überzog bereits die Osthänge.
Jalaluddin horchte in den Himmel, doch noch war kein Flugzeuggeräusch zu vernehmen. Dafür erschien auf der Ebene, auf der sich der Landeplatz befand, Sanaubar. Sie hatte sich beeilt und den Weg von der Poststation in Shari-i-Buzurg ohne längere Rast zurückgelegt. Nun schlenderte sie mit lächelnden Augen auf Jalaluddin zu, und der Alte nahm wahr, dass sie vergnügt war wie immer, wenn sie einen Ausflug dieser Art gemacht hatte.
„Ich bin leichtsinnig gewesen“, sagte sie lachend. „Ich hatte noch ein paar Afghani. Dafür habe ich eine bunte Postkarte gekauft, mit einem Bild vom Buzkashi-Feld in der Neustadt und dem letzten Hammelziehen in Faïzabad. Ich habe sie an Khaled geschickt.“
„Soso, an Khaled“, sagte Jalaluddin. „Was hast du ihm geschrieben?“
„Dass wir auf ihn warten – und dass er bald kommen soll.“
Jalaluddin hörte die Flugmaschine, lange bevor Sanaubar sie wahrnahm. Düster brummte er: „Das wäre sehr gut. Wir werden den Jungen brauchen.“
Sanaubar nahm seine Hand und wollte mit ihm zum Haus gehen. Sie hatte die Gewohnheit, an seiner Hand zu gehen, seit ihrer Kinderzeit nie ganz aufgegeben. Oftmals, wenn sie es tat, war es ihr gar nicht mehr bewusst. Nun aber erinnerte Jalaluddin sie daran: „Ich muss auf den Platz, mein Kind. Geh allein ins Haus.“
Sie wollte eine Frage an ihn richten, doch da hörte auch sie das Triebwerk. Die Felswände warfen das Echo ihres Lärms zurück. Es klang wie ferner Donner, der schnell näher rollte.
„Sie kommen wieder?“
Jalaluddin machte eine Handbewegung in Richtung der entschwindenden Sonne. „Die Panjshiri waren schon da. An der Schlucht.“ Und er drängte Sanaubar: „Lauf ins Haus. Die Piloten brauchen dich nicht zu sehen. Wir sind allein, und man weiß nicht, auf welche Gedanken diese Kerle kommen, wenn sie wissen, dass du da bist.“