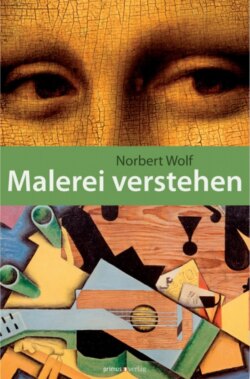Читать книгу Malerei verstehen - Norbert Wolf - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеMaurice Denis
Im Jahre 1890 wandte sich der französische Maler Maurice Denis mit einer revolutionären Maxime an die Öffentlichkeit. Ein Gemälde sei, so schrieb er, bevor es ein Schlachtpferd oder eine nackte Frau darstelle bzw. irgendeine Anekdote illustriere, eine plane Fläche, die der Maler in einer von ihm gewollten Ordnung mit Farbe bedeckt. Diese Aussage war janusgesichtig. Denn sie geht zum einen von genau bestimmbaren Bildinhalten, einem Pferd, einem weiblichen Akt, einer Story aus, hat also die Entwicklungsgeschichte der Malerei im Blick, die seit dem 15. Jahrhundert ihre Motive eng einem Naturvorbild anglich und die Bildgeschichten abwechslungsreich inszenierte. Zum anderen aber blickt Denis, Cheftheoretiker der avantgardistischen Künstlergruppe der Nabis, voraus in die Zukunft. Er ahnt, dass sich gemalte Bilder bald kaum noch um Naturalistik und um literarisch fixierte Inhalte bemühen, dass sie sich im Gegenteil auf das ihnen eigene Potenzial konzentrieren würden: auf die „illusionslose“ Fläche und den eigenwertigen Reiz der Farben.
Die Malerei der Nabis war an der Wende zum 20. Jahrhundert und somit an der Grenzscheide zur Moderne angesiedelt. Sie blieb insofern traditionsverhaftet, weil sie identifizierbare Themen und Motive aufwies. Aber sie war zugleich bahnbrechend, weil sie stilisierend, d.h. formal vereinfacht und extrem flächenhaft komponierte – wodurch sie sich der Abstraktion annäherte, die spätestens seit Kandinskys erstem ungegenständlichen Aquarell von 1910 auf literarische Inhalte und naturalistische Illusionen verzichtete.
Wie ist das Untersuchungsfeld des vorliegenden Buches zu definieren? Muss man es überhaupt definieren? Ist das Feld der Malerei nicht von vornherein klar konturiert?
Zweidimensionalität
Farben, in wahlweisen Mustern auf einem flächigen Bildträger angeordnet – diese Formel von Maurice Denis scheint auf den ersten Blick eine ausreichende Eingrenzung des Mediums Malerei zu bieten. Sie betont ja mit der Zweidimensionalität ein Hauptkriterium, durch das sich die Malerei von der dreidimensional operierenden Bildhauerkunst und von der realräumlichen, begehbaren Architektur unterscheidet. Das darf man zweifellos feststellen, ohne parallel dazu eine weitergehende Bestimmung von Skulptur und Architektur vornehmen zu müssen. Schwieriger wird es beim zweiten Aspekt, den Denis in seiner Formel anspricht, nämlich bei der auf die Fläche aufgetragenen Farbe. Zweifellos setzt das Medium Malerei die Farben und ihre unterschiedliche Lichtwirkung voraus, sogar noch in der monochromen Reduktion. Speziell über die Farbdominanz unterscheidet sich ein Gemälde, wie immer wieder zu lesen, von den grafischen Künsten, deren Erscheinungsweise von Linien bestimmt wird. Doch ganz so eindeutig ist der Sachverhalt nicht.
Grafik
Beide, Malerei und Grafik, liefern Flächenbilder. Doch worin besteht die entscheidende Differenz? Die Kunstwissenschaft fasst unter „Grafik“ alle Tätigkeiten und Resultate zeichnerischer Bildgestaltung zusammen. Darunter fallen also Handzeichnungen wie drucktechnisch vervielfältigte Bilder – letztere versammelt unter dem Dachbegriff „Druckgrafik“ – etwa Holzschnitt, Kupferstich, Radierung oder Lithografie.
Obwohl Druckgrafik meist dem Prinzip des Schwarz-Weiß gehorcht, verfügt sie auch über das Mittel der Mehrfarbigkeit und konkurriert nicht selten mit der Malerei: sei es durch nachträgliche Kolorierung, sei es durch die Erfindung von Farbdruckverfahren. Insbesondere die Farblithografie (Chromolithografie) eroberte nach ihrer Patentierung 1837 und mit dem Aufkommen der Schnellpresse 1852 in Gestalt des Plakats auch den öffentlichen Raum, ein Prozess, der Ende des 19. Jahrhunderts seinen ersten Höhepunkt erlebte, als Henri de Toulouse-Lautrec mit seinen Plakaten Gebrauchsgrafik und Künstlergrafik ästhetisch und funktional zur Deckung brachte. Folgerichtig ordnen die meisten Kunsthistoriker Lautrecs Farblithografien ebenso der Gattung Malerei zu wie seine Ölgemälde, von denen sie sich im Aussehen ja nicht gravierend unterscheiden. Auch das im Vergleich zur Druckgrafik sehr viel ältere Darstellungsverfahren der Zeichnung verfügt, je nachdem, ob Stifte, Tinte, Kohle oder Kreiden verwendet werden, über beide Optionen, das Schwarz-Weiß und die Buntfarbigkeit.
Wenn also der Faktor Farbigkeit nicht allein, zumindest nicht immer, ausreicht, um die Malerei von der Grafik abzugrenzen, hilft dann wenigstens die zitierte Modalität des Linearen weiter? Nur bedingt. Denn weite Strecken der Kunstgeschichte werden von der Auffassung bestimmt, dass auch in der Malerei die Linie den Primat zu beanspruchen habe und dass das Kolorit ihr gegenüber nur eine sekundäre Qualität sei.
Reproduzierbarkeit – Zeichnungen
Eine genauere Spezifizierung muss demnach weitere Kriterien berücksichtigen. So definiert sich die Druckgrafik in erster Linie durch ihre technische Reproduzierbarkeit, also die mechanische Vervielfältigung des Originalentwurfs, wogegen ein Produkt der Malerei, ein Gemälde, immer ein singuläres Werk darstellt (auch Kopien sind mit dem Vorbild nicht deckungsgleich). Aus technischen Gründen erreichen druckgrafische Stücke im Übrigen nie jene gewaltigen Formate, die Malereien an Wänden, auf Leinwänden usw. erreichen können (freilich nicht müssen) – selbst dann nicht, wenn man beispielsweise mehrere separat gedruckte Blätter zu Riesenholzschnitten zusammenklebte. Mit Ausnahme der Künstlerplakate besetzt die Druckgrafik deshalb keine Position im öffentlichen Raum und ist nicht imstande, wirklich repräsentativen Zwecken zu dienen. Eine, gemessen an der Malerei, intimere Funktion kommt auch der Zeichnung zu. Zeichnungen bedürfen zu ihrer Herstellung keines vergleichbar großen Aufwands wie Fresken oder Staffeleibilder. Im Gegenzug gelten sie dem genießenden Betrachter als spontaner und privater, als eine Formgestalt, die die Absicht ihres Schöpfers unmittelbarer zum Ausdruck bringt – bringen kann – und dessen persönlichen Stil nicht dem Diktat eines offiziellen Auftraggebers zu unterwerfen hat.
Berücksichtigt man allerdings, dass auch die Malerei das kleine, gar das intime Miniaturformat kennt und dass sie oft genug für den nichtoffiziellen, den privaten Bedarf arbeitet, dann steht man wieder in einer definitorischen Grauzone. Um wenigstens zwei Beispiele für solche Grenzüberschreitungen zu bringen, gehe ich später auf das Pastell und das Aquarell ein: Techniken, die zwischen Malerei und Zeichnung sowie zwischen Intimität und Repräsentanz oszillieren. Die Buchmalerei, ebenfalls ein Übergangsmedium, wird dagegen nur nebenbei zur Sprache kommen, da sie ihrer vielen Besonderheiten wegen einer eigenen Untersuchung bedürfte. Das Gleiche gilt für andere Domänen der zweidimensionalen Bildnerei, etwa das Mosaik oder die Bildteppiche, die ich nur in Randbemerkungen streife. Dagegen werde ich ausführlicher auf die Glasmalerei eingehen, nicht nur deshalb, weil sie in der Gotik oft die Wandmalerei ersetzte, sondern auch, weil sie allgemeine Rückschlüsse auf das Zusammenwirken von Farbe und Licht ermöglicht.
Bild als Zeichensystem
Malerei als Teil der bildenden Künste erzeugt Bilder. Warum diese Umschreibung? Wäre es nicht einfacher zu sagen, Fresken, Gemälde, Aquarelle sind Bilder? Im materiellen Sinne hat sich diese Gleichsetzung in der Tat längst eingebürgert. Im philosophischen Sinne aber sind Bilder anderes und mehr als ein Fresko oder Tafelgemälde. Unter solchem Vorzeichen ist ein Bild ein spezifisches Zeichensystem, es entsteht sozusagen im Wirkungsraum zwischen dem materiellen Bildträger und dem Betrachter. Der Betrachter sieht, indem er die Materialität des Bildträgers vergisst, im Bild ein Etwas, das nicht real vorhanden, sondern nur künstlich gegenwärtig ist: ein Pferd, eine nackte Frau, eine Landschaft, ein ungegenständliches Muster. Ein so verstandenes Bild ist immer ein virtuelles Ereignis, das sich, vom Künstler entsprechend konzipiert, an die Vorstellungs- und Reflexionskraft eines Betrachters wendet. Je mehr sich in der Moderne das Interesse der Künstler auf die Diskussion des philosophischen Bildbegriffs verlagerte, desto mehr verschob sich das Gestaltungsziel von der illusionistischen Naturnachahmung zur Veranschaulichung jener Virtualität: Bilder überschritten zunehmend die traditionellen Grenzen der Gattungen – war die besagte Virtualität doch in der Werbeoptik, in Videoinstallationen, in der Computergrafik, in Lichtinstallationen zeitgemäßer, multimedialer, zu verdeutlichen als in den herkömmlichen Gattungen.
Verdinglichung des Bildes
Gegen eben jene Künstlichkeit des als Zeichen generierten Bildes opponierten und opponieren jene Maler, die mit ihren Werken nicht mehr auf Wirklichkeit reagieren, sondern mit ihnen eine Wirklichkeit erfinden wollen. Beginnend mit den kubistischen Collagen und den konstruktivistischen Objekten des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zu den unregelmäßigen Bildumrissen etwa der shaped canvases (vgl. Abb. 19) wurde ein Weg eingeschlagen, der das Gemälde radikal verwandelte: vom Spiegel einer illusionistischen bzw. virtuellen Welt zum objektiven Gegenstand, den man im Grunde genommen gleichermaßen der Plastik oder dem Relief zurechnen könnte. Die Verdinglichung des Tafelbildes ist mehr als jene plumpe Banalisierung, die viele Betrachter in ihr sehen. Denn zum einen beseitigt auch sie die gewohnten Gattungsgrenzen. Die „minimalistische“ Umwandlung zum konkreten, gleichsam betastbaren Gegenstand, der angeblich nicht mehr sein will als er ist, hebt ja die Unterschiede zwischen Zwei- und Dreidimensionalität auf. Zweitens unterwirft sie alle einschlägigen Objekte dem Ziel, das einst so erhabene Kunstwerk auf einen optischen und symbolischen Nullpunkt zurückzuführen, dorthin, wo es sich selbst, seine Künstlichkeit aufhebt, um mit der Wirklichkeit identisch zu werden: Die Austauschbarkeit von Kunst und Wirklichkeit bezweckt utopisch nicht mehr und nicht weniger, als das reale Leben zum permanenten Kunstwerk zu erheben. Dann bräuchten, so die logische Konsequenz, die Menschen nicht länger eine außerhalb der gesellschaftlichen Praxis angesiedelte Kunst.
Gattungsmerkmale
Im Rahmen der skizzierten Entwicklungen ist zu betonen, dass sich ein Buch mit dem Titel „Malerei verstehen“ vor allem jenen Phänomenen widmen muss, die so lange galten, wie die Malerei als eigenständige Kunstgattung auftrat und als Gattung noch nicht in Frage gestellt war. Ein sich darauf beschränkendes Buch ist nun keineswegs altmodisch oder überholt. Aus zwei Gründen nicht. Zum einen, weil seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert und gegenwärtig wieder ein neuer Hunger nach dem Gemalten, nach der Handschrift des von Menschen gemachten, sei es abstrakten, sei es figurativen Bildes, nach „wiedergewonnener Sinnlichkeit und freigewordener Farbe“ (Heinrich Klotz) wächst – wodurch naturgemäß die alten Gattungsmerkmale erneut an Gewicht gewinnen; zweitens, weil auch die „Entgrenzung“ der Malerei zugunsten neuer Medien ohne das Fundament der Tradition nicht verstehbar wäre. Denn das Neue in der Kunst überschreitet, wie u.a. Boris Groys gezeigt hat, nur dann den Status des bloß beliebigen oder modischen Wechsels, wenn es sich kritisch mit den ins kulturelle Gedächtnis eingegangenen alten Werten vergleicht.
Deshalb ist es sinnvoll, den historischen Standort der Gattung Malerei im Rückblick zu beschreiben und die oben zitierte Maxime von Maurice Denis zum Ausgangspunkt zu nehmen: Ich werde also mit der Farbe beginnen und über mehrere Zwischenschritte die Anordnung von Formen und Farben auf der Fläche, ferner die kompositorisch daraus resultierenden Möglichkeiten untersuchen. Ich werde allerdings auch über das Statement von Denis hinausgehen, indem ich ikonografische, soziologische und vertiefende mediale Probleme vorstelle.