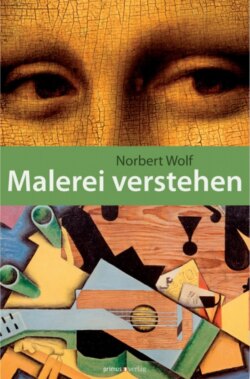Читать книгу Malerei verstehen - Norbert Wolf - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Die Farben
ОглавлениеPaletten
In zahllosen Selbstbildnissen stellen sich Maler seit der Renaissance vor der Staffelei dar, mit dem Pinsel in der einen, der Palette in der anderen Hand. Die Palette, eine tragbare Unterlage, auf der die farbigen Malmittel bereitgehalten und wahlweise ineinander verrieben werden, scheint in der Antike nicht bekannt gewesen zu sein. Vermutlich deshalb nicht, weil bei den alten Griechen und Römern eine Abneigung gegen das Mischen von Farben bestand. Und auch die relativ wenigen Farben, die in der Buch- und Tafelmalerei des europäischen Mittelalters zum Einsatz kamen, befanden sich in Schälchen und Tiegeln, das Malergold, also der mit flüssigen Bindemitteln versetzte Goldstaub, oft auch in Muschelschalen, deshalb die Bezeichnung „Muschelgold“. Die europaweit frühesten Darstellungen von Paletten finden sich in zwei illustrierten burgundischen Handschriften aus den Jahren um 1400. Ebenfalls aus dem mäzenatischen Umfeld der burgundischen Herzöge stammt die älteste erhaltene Beschreibung von Paletten. Sie datiert in die späten sechziger Jahre des 15. Jahrhunderts und formuliert ausdrücklich, dass die „tragbaren Holzbretter“ für Ölfarben bestimmt waren, die, wie man hinzusetzen darf, aufgrund ihrer pastosen Konsistenz problemlos hafteten. Die eigenartigerweise bis gegen 1500 nur nördlich der Alpen bekannten Abbildungen von Paletten verdeutlichen freilich, dass man trotz dieser Instrumentarien zunächst weitgehend auf Farbmischungen verzichtete. Das änderte sich erst im Lauf des 16. Jahrhunderts. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde es schließlich zur Selbstverständlichkeit in akademisch geschulten Kreisen, eine Vielzahl unterschiedlicher Farbpasten auf der Palette zu nuanciertesten Zwischentönen zu verreiben.
Stofflichkeit der Farben – Rembrandt
Doch an dieser Stelle soll nicht die Wahl reiner respektive gemischter Farben interessieren und auch nicht die Tatsache, dass die Anzahl der auf der Palette vorhandenen Farben und die Art und Weise ihrer Anordnung wertvolle Rückschlüsse auf die von wechselnden Vorlieben geprägte Geschichte des Kolorits erlaubt. Im Folgenden geht es vielmehr um die Stofflichkeit der Farben. Egal, ob die Farben in Schälchen oder auf der Palette bereitgehalten wurden, immer stand den Malern die Konsistenz der Farben vor Augen. Sie waren sich bewusst, dass sie im Malvorgang Substanzen transformierten oder veredelten und dass farbige Materie wie in einem alchimistischen Vorgang zu letztlich „geistiger Form“ mutierte. Viele Maler veranschaulichten im Laufe der Kunstgeschichte diesen Verwandlungsprozess nachgerade demonstrativ, indem sie die Farben dick, pastos, auf den Malgrund setzten, sodass sich eine fast reliefartige Struktur ergab. An Rembrandts Gemälden etwa hoben schon Zeitgenossen die imposante Dicke der Farbschichten hervor (Abb. 1). Eines seiner Porträts, so hieß es, habe man an der Nase des Dargestellten vom Boden aufheben können, Edelsteine und Perlen habe der holländische Barockmeister so plastisch angelegt, dass sie Reliefs glichen. In der Tat hat Rembrandt die hellsten Partien seiner Bilder in extremem Impasto ausgeführt, und zwar nicht nur mit dem Pinsel, sondern nicht selten mit dem Palettmesser oder mit dem Finger. Gemalte Details in und mit der Farbe zu modellieren, wurde zu seinem Markenzeichen. Er und seine Schüler verankerten Geist und Idealität des Bildes im Schoß der Materie. Der Spanier Antoni Tàpies, um noch ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert zu bringen, vermengte oft Farbpigmente mit Sand oder gefärbtem Zement. In dem auf die Farbfläche gegossenen Farb-Sand-Brei lassen Gerinnungsprozesse Verwerfungen entstehen und im Zuge des Trocknens Risse, Sprünge und Abbröckelungen. Tàpies verwendet dieses kalkulierte Chaos, um die Dinglichkeit seiner abstrakten Kompositionen zu steigern und Assoziationen zu naturhaft elementaren oder kunstgeschichtlich archaischen Strukturen herzustellen.
Rembrandt und das Impasto
Vor allem an den Gewandpartien demonstriert Rembrandt in seinem Spätwerk Die Judenbraut (vgl. Abb. 1) die Kühnheit seiner Maltechnik in Form eines virtuosen Impasto, in der geradezu physisch greifbaren Konsistenz der Farbmaterie. In einem extrem langsamen Arbeitsprozess, nicht, wie man meinen könnte, in virtuoser Geschwindschrift, hat der holländische Barockmaler solche Farbreliefs erzeugt, oft mithilfe des Palettmessers, gelegentlich auch direkt mit dem Finger auf die Leinwand gesetzt.
Die Dicke des Farbauftrags haben schon Rembrandts Zeitgenossen rühmend beschrieben. Sie konnten sich dabei auf Ausführungen Giorgio Vasaris aus der Mitte des 16. Jahrhunderts berufen, wonach die scheinbar grobe Manier pastoser Farbbehandlung der Fantasie des Betrachters ein weites Betätigungsfeld eröffne, sei diese doch veranlasst, die mit dieser Malweise verbundenen Hell-Dunkel-Reflexe zu einem Gesamteindruck zusammenzusehen. Freilich bevorzugte Vasari letztlich doch die feine Malweise und ihren subtilen Strich, ihre präzise Linienführung. Diese Unterscheidung findet sich noch um 1650 in der niederländischen Kunstliteratur, die die rembrandtsche Farbdicke mit der Glätte eines Anthonis van Dyck kontrastiert. Das dramatisch wirkende Impasto Rembrandts, sozusagen das Markenzeichen seiner Werkstatt, wurde häufig nachgeahmt – so mussten beispielsweise Spezialisten 1985 den berühmten Mann mit dem Goldhelm in der Berliner Gemäldegalerie, in dessen Helm das Impasto zu besonders suggestiver Kraft gesteigert ist, dem Meister ab- und einem Schüler oder Nachahmer zuerkennen.
Abb. 1 Rembrandt: Isaak und Rebekka, genannt Die Judenbraut, um 1665, Öl auf Leinwand, 121,5 × 166,5 cm, Amsterdam, Rijksmuseum.
Wenn ich im vorhergehenden Passus auf die Alchimie hingewiesen habe, war das mehr als eine bloße Metapher. Denn die Farbenherstellung und der materielle Umgang mit den Farbstoffen wurden in den technologisch orientierten Kunst- und Malereitraktaten des Früh- und Hochmittelalters häufig in einen solchen Zusammenhang gerückt. So auch in der Abhandlung Mappae Clavicula, einer Handschrift mit annähernd dreihundert Rezepten zur Metallkunde, Alchimie und Kunsttechnik, einschließlich gesonderter Anweisungen für Buchmaler. Das am vollständigsten erhaltene Manuskript der Mappae aus dem 12. Jahrhundert geht inhaltlich auf einen wesentlich älteren Traktat zurück, nämlich auf den um 800 in Lucca verfassten Titel Compositiones ad tingenda musiva. Eine noch wichtigere Quelle als die genannten Werke stellt die von einem gewissen Theophilus Presbyter – identisch wahrscheinlich mit dem niedersächsischen Priester und Bronzegießer Roger von Helmarshausen – um 1100 geschriebene und viele Kunstbereiche berührende Untersuchung De diversis artibus dar. Nicht zu vergessen ist auch der sogenannte Heraklius-Traktat, den eine Fassung des 13. Jahrhunderts überliefert, der aber sicher Anweisungen bereits des 11. Jahrhunderts rekapituliert.
Farbrezepturen – Cennino Cennini
In solchen Schriften wird deutlich, wie stark sich damals das Wissen um Farbrezepturen auf alchimistische Experimente, stellenweise auch auf medizinische, aus der Antike herrührende und von arabischen Wissenschaftlern weitergegebene Erkenntnisse berief. Das im 12. Jahrhundert dem Arzt Matthaeus Platearius aus Salerno zugeschriebene arzneikundliche Buch Circa instans – das noch im 18. Jahrhundert gelesen wurde – zählt eine ganze Reihe Pflanzen und Mineralien auf, die auch für die Farbenzubereitung eingesetzt wurden. Bis tief ins Hochmittelalter war es eine Selbstverständlichkeit, die Praxis der Farbenaufbereitung mit naturwissenschaftlichen und naturmagischen Vorstellungen in Einklang zu bringen. Erst seit dem Spätmittelalter beschritten die Regieanweisungen in Malerbüchern Wege, die zunehmend weniger mit alchimistischen, pflanzen- oder steinmagischen Überzeugungen zu tun hatten. Schon um 1390 beispielsweise löste Cennino Cennini in seinem bekannten Trattato della Pittura (Traktat über die Malerei) die technische Seite der Malerei weitgehend von außerkünstlerischen Standards und fügte den Technologiekapiteln ästhetische Fragestellungen an. Auch das für die byzantinische Kunst so aufschlussreiche Handbuch der Malerei vom Berge Athos, dessen späteste Fassung ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts datiert, das inhaltlich jedoch stellenweise tief ins Mittelalter zurückreicht, enthält zwar ausgiebige maltechnische Passagen, etwa zur optimalen Herstellung von Farben, zur Vorbereitung des Malgrunds bei den Ikonen oder zu Wandmalereitechniken, verlässt dabei aber nicht den Bereich kunstspezifischer Technologie.
Farbe und Alchimie
Allerdings, ganz verschwand die Alchimie aus den Spekulationen um die Farben noch lange nicht. Dafür nur ein Beispiel, das ich dem wichtigen Buch von John Gage zur Kulturgeschichte der Farbe entnehme: Die Gnostiker des 2. nachchristlichen Jahrhunderts, deren Gedankengut wesentlich die späteren alchimistischen Theorien inspirierten, betonten das Mysterium, dass aus einem einzigen weißen Ei die unergründlich und so vielfältig schillernde Farbskala des Pfauenschweifs hervorgehe. Sie verglichen dieses Wunder mit Gottes Schöpfung des Mannigfaltigen aus dem Prinzip des Einen. Im 13. Jahrhundert ist ihnen der große scholastische Denker Albertus Magnus gefolgt (zumindest wird ihm eine einschlägige Abhandlung zugeschrieben), wenn er behauptet, dass im Weiß sämtliche Farben potenziell vorhanden seien. Vierhundert Jahre später hat Isaac Newton nachweislich diese Zeilen gelesen. In einem Heft mit Notizen zur Alchimie entwickelt er den verwandten Gedanken, dass sämtliche Farben, unabhängig von der Einwirkung der Dunkelheit auf das Licht, im weißen Licht angelegt, in ihm also präexistent seien.