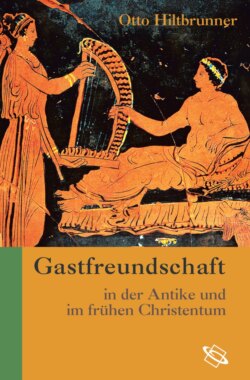Читать книгу Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum - Otto Hiltbrunner - Страница 13
Оглавление[Menü]
III. Griechisch-römische Gastfreundschaft in historischer Zeit
1. Private Gäste und Gastgeber
Theoretische Grundzüge
Sowohl in Griechenland wie, seit Rom im 3. Jahrhundert v. Chr. sich verstärkt der griechischen Kultur geöffnet hat, im römischen Imperium orientiert man sich an den aus Homer bekannten Normen. Noch im 4. Jahrhundert n. Chr. zitiert der Kaiser Julian Homer und fordert seine heidnischen Anhänger auf, sich nach dessen Vorbild zu richten und damit der christlichen Wohltätigkeit etwas Ebenbürtiges entgegen zu setzen.13 Schon Hesiod, neben Homer der früheste griechische Dichter, stellt denjenigen, der einen Schutzflehenden oder einen Fremden übel behandelt, auf dieselbe Stufe wie den, der sich durch Raub und Betrug bereichert, der das Weib seines Bruders schändet, Waisen übervorteilt, den alten Vater beschimpft (Erga 327 ff.). Im klassischen Athen versetzt der Komödiendichter Aristophanes den, der sich gegen den Gast vergeht, an die erste Stelle unter den Verdammten, die auf dem Weg zur Hölle in Sumpf und Kot stehen, noch vor den Kinderschändern, die die Missbrauchten um den versprochenen Lohn betrügen, vor denen, die ihre Mutter verdreschen und den Vater ins Gesicht schlagen, und vor den Meineidigen (Frösche 147). Die Gastfreundlichkeit ist ein Kennzeichen, an dem man den zivilisierten Menschen erkennt und misst. Sie wird zu einem Hauptthema der Sozialethik.
Die Stoiker definieren sie als die Kunst des Umgangs mit Gästen, und als solche stellt sie der Christ Klemens von Alexandria unter den Oberbegriff der Agape, der Nächstenliebe. Besondere Aufmerksamkeit widmet ihr die Schule des Aristoteles: Gastfreundlichkeit gehört ebenso wie die Liebe zum Schönen zu den begleitenden Tugenden des freigesinnten Menschen, den seine Liberalität (Eleutheriótes) vor aller Kleinlichkeit bewahrt (Ps. Aristot. peri areton 1250 b 34). In die Gedankenwelt der philosophischen Erbauungstraktate hellenistischer Zeit gehört auch ein dem Charondas, einem sizilischen Gesetzgeber aus früher Zeit, zugeschriebene Vorschrift: jeden Fremden, der in seiner Heimat geachtet ist, auch den eigenen Bräuchen des Gastlandes entsprechend mit freundlichen Segenswünschen und wie zum Hause gehörig aufzunehmen und wieder zu verabschieden im Gedanken an Zeus xenios, der bei allen als ein gemeinsamer Gott wohnt und ein Wächter ist über Fremdenfreundlichkeit und Fremdenhass (Stobaios 4,2 p. 151). Wie es der Ordnung nach beim Empfang in der Praxis zuzugehen hat, darüber macht sich bei Plautus (Bacch. 183–188) der Sklave Chrysalus lustig; um dem Bekannten lange Reden zu ersparen, spielt er das Ganze als Monolog ab: Du freust dich über mein Kommen. Ich glaub es dir. Du versprichst gastliche Aufnahme und ein Abendessen, wie es sich gehört, wenn jemand aus fernem Land anreist. Ich sage mein Kommen zu und richte dir einen herzlichen Gruß von deinem Freund aus. Du fragst mich, wo der sei. Ich: Er lebt. Du: Es geht ihm gewiss gut? Und jetzt die überraschende Pointe: Genau das wollte ich dich fragen.
Griechischen Lehren der Stoiker und der Aristoteliker schließt sich der Römer Cicero an. Ungastlichkeit definiert er (Tusc. 4,27) als eine die Vernunft überwältigende, tief eingewurzelte und verhärtete falsche Vorstellung, dass man den Kontakt mit einem Fremden unbedingt vermeiden müsse. Ein Mann, der in der Gesellschaft Anerkennung finden will, ist zu entsprechender Repräsentation verpflichtet, freilich so, dass nicht das Haus, das er bauen lässt, den Besitzer ehrt, sondern der Herr das Haus: Er soll nicht an seine persönlichen Bedürfnisse denken, sondern an die anderer, das heißt, dass man für Geräumigkeit sorgen muss im Hause eines vornehmen Mannes, wo viele Gäste aufzunehmen sind und eine Menge von Personen jeglicher Art Zutritt finden soll (off. 1,139). Ausdrücklich auf den Aristoteles-Schüler Theophrast beruft er sich, wenn er der Gastfreundschaft hohe politische Bedeutung beimisst: Mit Recht hat Theophrast die Gastfreundschaft gerühmt. Es bringt hohe Ehre, meine ich, wenn die Häuser vornehmer Persönlichkeiten vornehmen Gästen offen stehen. Es hebt auch das Ansehen des Staates, wenn Fremde in unserer Stadt auf ein solches Entgegenkommen zählen dürfen. Für jemanden, der mit ehrbaren Mitteln politischen Einfluss zu gewinnen wünscht, ist es von unschätzbarem Wert, durch seine Gastfreunde in auswärtigen Staaten Einfluss und Beziehungen zu haben. Theophrast schreibt, Kimon habe in Athen sich auch gegenüber den Bürgern seines Stimmbezirks gastfrei gezeigt. Er habe angeordnet und den Verwaltern seiner Güter eingeschärft, jedem Lakiaden, der in einem seiner Landhäuser einkehre, solle alles geboten werden (off. 2,64).