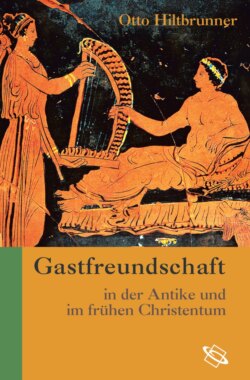Читать книгу Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum - Otto Hiltbrunner - Страница 16
Sýmbolon, das Erkennungszeichen
ОглавлениеWie zu Homers Zeiten gilt das einmal begründete Verhältnis der Gastfreunde auf Dauer und ist übertragbar auf die andern Familienmitglieder und auf Freunde, die von den Partnern aneinander empfohlen werden. Bei dem vergrößerten Personenkreis werden die Erkennungszeichen, griechisch symbola, lateinisch tesserae hospitales, immer wichtiger. Mit ihnen weist sich der Ankommende, wenn er dem Gastgeber noch nicht von früher her bekannt ist, als berechtigter Gastfreund aus. Die primitive Form des auseinander gebrochenen Knöchelches, von dem jeder Partner eine Hälfte bei sich behält, so dass, wenn die Teile wieder aneinander gefügt werden, das Zusammenpassen als Beweis dient, diese Urform des Symbolon wird mehr und mehr durch gefälligere Stücke ersetzt: Marken, die das gleiche Zeichen tragen, aus dauerhaftem Material, zum Beispiel Elfenbein, Metall, Knochen mit eingeritzten Figuren. Beliebt ist die Form einer Hand oder zweier ineinander gelegter Hände, eines Tierkopfes, besonders die Gestalt eines Delphins, des freundlichen Geleiters der seefahrenden Fernhändler. Symbola heißen schließlich auch Schrifttäfelchen mit den Namen der Gastfreunde; sie sind die kürzeste Form des Empfehlungsschreibens, doch das Wort symbolon („das Zusammenfügbare“) hat hier seinen wörtlichen Sinn verloren.
Üblicherweise bringt der Ankommende seine Erkennungsmarke mit und der ihn Aufnehmende hat sie bei sich im Hause. Es gibt Ausnahmen. In der Tragödie ›Medea‹ lässt Euripides den Jason seiner verstoßenen Frau Unterstützung auf der Flucht anbieten mit den Worten (613): Ich bin bereit, Symbola an meine Gastfreunde zu senden, die dir freundlich helfen werden. Er weiß voraus, was Medea antworten wird (616): Nie würde ich deine Gastfreunde in Anspruch nehmen wollen. Ihre Weigerung macht es Jason unmöglich, ihr die Erkennungszeichen mitzugeben, er kann sie nur im Voraus überbringen lassen. Die Symbola haben also die Aufgabe von Empfehlungsbriefen.
Eine andere Situation ergibt sich, wenn der Gastgeber außer Haus angetroffen wird. Das zeigt eine Szene aus dem ›Poenulus‹ des Plautus (1044 ff.). Der Karthager Hanno kommt in die Stadt Kalydon auf der Suche nach seinen von Seeräubern entführten Töchtern und Agorastokles, dem Sohn seines verstorbenen Gastfreundes, dessen Symbolon er auf die Reise mitgenommen hat. Er trifft einen jungen Mann und fragt ihn, ob er in der Stadt einen Altersgenossen namens Agorastokles kenne. Der Angesprochene erklärt, der sei er selber. Darauf Hanno: Wenn dem so ist, lass uns, bitte, die Freundschaftsmarke vergleichen. Hier habe ich die meine mitgebracht. – Lass sehn! Zeig sie her! Sie ist genau gleich wie die, die ich zu Hause habe. – Oh mein Gastfreund, sei mir vielmals gegrüßt! Denn dein Vater Antidamas war mir von meinem Vater her ein Gastfreund. Was ich hier habe, ist die Marke der Freundschaft mit ihm. – Dann wirst du also hier bei mir als Gast wohnen. Denn ich entziehe mich nicht der Gastgeberpflicht und habe nichts gegen Karthago. Bin ich doch dort geboren. – Mögen die Götter dir alles gewähren, was du wünschest! Was du nicht sagst! Wie kommt es denn, dass du in Karthago geboren bist? Du hattest doch hier einen Aetoler zum Vater. – Ich bin von dort geraubt worden. Hier hat mich Antidamas, dein Gastfreund, gekauft, und der hat mich als Sohn adoptiert. – Er war selber gleichfalls ein Adoptivsohn des Demarchus. Aber nichts mehr von mir; ich komme wieder auf dich zurück. Sag mir, hast du irgend eine Erinnerung an die Namen deiner Eltern? – An Vater und Mutter. – Dann nenne sie mir, ob ich sie vielleicht kenne und sie mit mir verwandt sind. – Ampsigura war meine Mutter, Jahon der Vater. – Ach, wie sehr wünschte ich dir, dass dein Vater und die Mutter noch lebten. – Sind sie gestorben? – Leider, zu meinem großen Kummer. Deine Mutter Ampsigura war nämlich meine Base von Mutterseite, und dein Vater, der war mein Vetter, Sohn meines Onkels. Der hat mich, als er starb, zu seinem Erben eingesetzt. Dass ich ihn durch den Tod verloren habe, das tut mir besonders weh. Doch wenn es so ist und du Jahons Sohn bist, dann musst du an deiner linken Hand ein Zeichen haben, das dir der Biss eines Affen, mit dem du als Kind spieltest, hinterlassen hat. Zeig her, lass mich sehen, mach die Hand auf! Da ist’s! – Sei gegrüßt, lieber Onkel! – Und du, sei gegrüßt, Agorastokles! Hanno führt auf seiner Reise die Ausweismarke mit sich, Agorastokles lässt die seine, weil er sich in seinem Alltag bewegt, zu Hause. Er kann Hannos Marke als echt erkennen. Hanno dagegen braucht, weil der Dichter den jungen Mann nicht von der Szene wegschicken kann, damit er von Hause seine Marke hole, ein anderes Erkennungszeichen, die Bissnarbe. Mit der Gastfreundmarke aber verbindet sich die Identifikation der ganzen Verwandtschaft.
Auch das Gegenstück findet sich bei Plautus. Die Hausherrin, aufs Schwerste gekränkt durch den Verrat, den der junge Liebhaber an ihr und ihrer Tochter begangen hat, wirft diesen aus dem Haus mit den Worten (Cistellaria 503): Hier bei uns hast du jetzt, Alcesimarchus, die Freundschaftsmarke zerbrochen. Der vor den Augen des Schuldigen symbolisch vollzogene Akt des Zerbrechens des Zeichens ist die radikalste und unwiderrufliche Form der Aufkündigung.
Von den erhaltenen Stücken sind bemerkenswert: Ein Elfenbeintäfelchen aus dem einst karthagischen Westsizilien, dessen Text besagt, der Karthager Imylch habe mit dem Griechen Lyson Gastfreundschaft geschlossen (IG 14,279). Eine Bronzehand aus dem mit der griechischen Kolonie Massalia (Marseille) Handel treibenden Südgallien trägt die Inschrift (IG 14,2432): Symbolon gegenüber den Velauniern (einem Keltenstamm). Ein römischer Widderkopf aus Bronze (CILI2,23) trägt die Beschriftung: Atilies Saranes, die Söhne des Gaius und des Marcus, sie gilt also als Ausweis für die Angehörigen von zwei Linien der Adelsfamilie, in der man den Namen Atilius Sarranus führt. Ein kleiner halbierter bronzener Widderkopf aus dem marsischen Gebiet Italiens ist mit dem Wort hospes ausdrücklich als Freundschaftsmarke gekennzeichnet (CILI2,1764; die beiden Namen des Römers Titus Manlius Titi filius und des Marsers Titus Staiodius N. sind beigefügt. Die Gestalt eines Delphins hat die eherne Ausweismarke, die den Bürgern von Fundi ihre Gastfreundschaft mit dem römischen Konsul Marcus Claudius bezeugt (CILI2,611); hier übernimmt der Römer eine Schirmherrschaft über eine ihm in Clientelschaft verbundene Stadtgemeinde, ein Patronat (vgl. unten S. 85). Ebenfalls Delphingestalt haben die Bronzemarke mit dem Namen des Aulus Hostilius Mancinus, eines Römers aus consularischer Familie (CILI2,828), und die durch die Beschriftung hospitium fecit quom Elaudorianis eindeutig als Gastfreundschaftszeichen sich erweisende spanische Marke; der Text besagt: Er (der auf dem nicht erhaltenen Gegenstück Genannte) hat Gastfreundschaft geschlossen mit den Angehörigen des Elaudus (CILI2,2825).