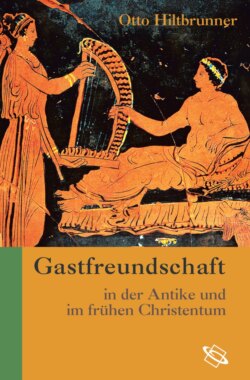Читать книгу Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum - Otto Hiltbrunner - Страница 17
Verletzung der Gastfreundschaft
ОглавлениеDie Gastfreundschaft steht unter dem Schutz der Götter. Von ihnen und nicht einem von Menschen eingeführten Gesetz wird ihre Verletzung gestraft, sie ist eine verabscheuenswerte Verfehlung gegen ein für alle Menschen bindendes Grundgebot (griechisch themis), nicht gegen das Gesetz (griechisch nomos) oder das Recht (griechisch dike), die in jedem Volk verschieden sein und von Fall zu Fall zu anderem Urteil führen können.14 Dem griechischen Zeus xenios entspricht in Rom der Juppiter hospitalis, der aber keinen offiziellen Kult hat. Mehr römischer Religiosität entspricht die Mehrzahl der di hospitales, die recht oft als Hüter der Gastfreundschaft angerufen werden,15 auch sie sind keine Gottheiten des Staatskultes. Die Hausgötter (Lares) übernehmen zwar die Rolle von di hospitales, sind ihnen aber nicht gleichzusetzen, sondern haben einen weiteren Aufgabenkreis und genießen eine eigene Verehrung mit Opfergaben. Erst in der späten Kaiserzeit weiht ein Kohortenpräfekt in Britannien einen Altar für Juppiter, di deaeque hospitales und die Penaten zum Dank für seine Errettung (CIL VII,237).
Schon das ruhende Verhältnis verbietet jeden unfreundlichen Akt. Besonders schwer aber wiegt der Bruch, sei es vonseiten des Gastgebers oder vonseiten des bei ihm wohnenden Gastes, wenn die Gastfreundschaft aktuell ausgeübt wird und wenn die Freunde einander leibhaft gegenüberstehen.
Nach der Eroberung Troias verschonen die Sieger, wie Livius im ersten Satz seines Geschichtswerkes schreibt, nur zwei Troianer, Aeneas und Antenor, auf Grund ihres von alters her bestehenden Rechtes der Gastfreundschaft. Beide finden dann in Italien nach dem Willen der Götter eine neue Heimat. Wie bei Homer gilt, dass nicht einmal der Krieg ein privates Gastverhältnis aufhebt. Livius widmet der exemplarischen Darstellung solcher Vertragstreue eine Erzählung aus dem Hannibalkrieg (25,18):
Der Campaner Badius war ein Gastfreund des Römers Titus Quinctius Crispinus, ihm verbunden durch engste Freundschaftsbande. Ihre Gemeinsamkeit war noch gewachsen, weil Badius einst, vor dem Abfall Capuas, in Rom krank geworden und im Haus des Crispinus mit aller Liebe und Hingabe gepflegt worden war. Dieser Badius kam jetzt heraus zu den Vorposten, die vor dem Tor des römischen Lagers Wache hielten, und verlangte, man solle den Crispinus rufen. Als das dem Crispinus mitgeteilt worden war, ging der in der Meinung, es werde ein freundschaftliches und vertrauliches Gespräch gesucht, und die Erinnerung an das private Gastrecht bestehe fort, auch wenn die staatlichen Verträge gebrochen seien, ein Stück weit vor die römischen Posten hinaus. Als sie einander ansichtig wurden, rief Badius: Ich fordere dich, Crispinus, zum Kampf heraus. Auf, zu Pferd, und schicken wir die andern weg. Lass sehen, wer im Streit der Überlegene ist. Darauf Crispinus: Weder mir noch dir fehlt es an Feinden, bei denen wir unsere Tapferkeit beweisen können. Ich werde, auch wenn du mir in der Schlacht begegnen solltest, ausweichen, damit ich nicht meine Hand besudle mit dem Mord am Gastfreund. Damit kehrte er ihm den Rücken und wollte weggehen. Doch jetzt geriet der Campaner erst recht in Wut, schalt ihn einen Weichling und Feigling und warf ihm, der keine Schuld trug, Beleidigungen an den Kopf, die eher er selber verdient hätte. Er sei ein Gastfreund-Feind, ein Heuchler, der vorgebe, einen zu schonen, von dem er genau wisse, er sei ihm nicht gewachsen. Wenn er noch nicht ganz begriffen habe, dass mit dem Bruch der staatlichen Bündnisse auch zugleich die privaten Rechtsbeziehungen zerrissen seien, so kündige er, der Campaner Badius, dem Römer Titus Quinctius Crispinus in aller Form und so laut, dass beide Heere es hören könnten, die Gastfreundschaft auf. Es gebe nichts Gemeinsames mehr zwischen ihnen, keine Rede von Bund zwischen Feind und Feind, ihm, der gekommen sei, um gegen seine Heimatstadt und ihre heiligen Stätten, staatliche wie private, Krieg zu führen. Wenn er ein Mann sei, solle er zum Zweikampf antreten. Crispinus hielt sich lange zurück. Doch seine Kameraden drängten ihn, er solle sich die Schimpfreden des Campaners nicht ungerächt gefallen lassen. So wartete er also nur noch so lange, als er die Vorgesetzten um Erlaubnis gefragt hatte, ob sie ihm mit Sondergenehmigung gegen den feindlichen Herausforderer zu kämpfen gestatteten. Nach erteilter Zustimmung griff er zu seinen Waffen, stieg zu Pferd und forderte Badius unter Aufruf seines Namens zum Kampf heraus. Der zögerte keinen Augenblick. Mit gespornten Pferden ritten sie gegeneinander an. Crispinus verwundete über den Schildrand hinweg den Badius mit seiner Lanze an der linken Schulter, und als dieser verwundet herabsank, sprang er über ihm vom Pferd, um ihm zu Fuß den Rest zu geben. Doch bevor Badius niedergemacht werden konnte, ließ er Schild und Pferd im Stich und flüchtete zu den Seinen. Crispinus wurde, indem er seine ruhmvollen Beutestücke, das erbeutete Pferd und den blutbespritzten Schild, vorzeigte, unter lautem Beifall und Glückwünschen vor die Consuln geleitet und erhielt auch dort eine spezielle Belobigung und Ehrengaben. Valerius Maximus (5,1,3) hat die Geschichte in seine Sammlung denkwürdiger Begebenheiten übernommen und lässt den Römer sagen: Dein Verbrechen möge es sein, dass du einen Gastfreund hast morden wollen, aber dass du als mein Gastfreund getötet wirst, das wirst du mir nicht als mein Verbrechen aufladen.
Livius steht für die allgemein anerkannte Unverbrüchlichkeit. Eine gegenteilige Wertung ist ungewöhnlich. Sie findet sich bei Cornelius Nepos. In der Biographie des athenischen Feldherrn Timotheos (4,3) erzählt er, unter den Gastfreunden, die eigens angereist seien, um dem Angeklagten in Athen Prozessbeistand zu leisten, habe sich auch der thessalische Tyrann Jason von Pherai befunden. Dennoch habe in einem von den Athenern gegen Jason beschlossenen Krieg Timotheos das Heer gegen ihn angeführt. Er habe die Rechte des Vaterlandes für heiliger gehalten als die der Gastfreundschaft. Dieser angebliche Kriegszug ist unhistorisch, erfunden, um den Patriotismus des Helden über alle Maßen gesteigert erscheinen zu lassen.
Ein anderer Aspekt zeigt sich in der Verantwortung des Gastgebers für Wohlergehen und Unversehrtheit seines Gastes. Der römerfreundliche Sohn des Calavius, in dessen Haus Hannibal in Capua wohnt, gibt den Plan auf, diesen gefährlichsten Feind Roms zu ermorden, weil der Vater ihn beschwört, nicht den Tisch des Gastmahls mit dem Blut des Gastes zu beflecken (Livius 23,8 f.). Piso, das Haupt der Verschwörung gegen den Kaiser Nero, weigert sich, seine Villa zum Ort der Ermordung des Kaisers werden zu lassen. Wäre der getötete Gast auch ein noch so schlechter Herrscher, der Mord bliebe als unauslöschlicher Makel am Gastgeber haften (Tacitus, Annales 15,52,1). Der Vorwurf des Mordes steht versteckt hinter dem bitter ironischen Kompliment des Horaz an die Hexe Canidia: Du hast ein Herz für deine Gäste (Epode 17,49); der Dichter spielt damit auf einen in ihrem Hause verübten Ritualmord an, den er ihr in einem früheren Gedicht (Epode 5) nachgesagt hatte.
Dem Gast wird kaum je ein Mord am Gastgeber zugetraut, doch er hat seinerseits nicht nur alles zu unterlassen, was dem Gastgeber schaden könnte, sondern ihm, soweit er es vermag, in Treue beizustehen. Es charakterisiert ein vollendetes Paar von Schurken, wenn in der Komödie ›Rudens‹ des Plautus (883f.) der Gast seinen Gastgeber, den Kuppler, zu einem fehlgeschlagenen Betrug angestiftet hat, diesen aber in dem Augenblick im Stich lässt, wo der zur Rechenschaft gezogene und vor Gericht geschleppte Kuppler an seinen Beistand appelliert: Gastfreund! – Ich bin dein Gastfreund nicht! Fort mit deiner Gastfreundschaft! – So missachtest du mich? Nur zum Spott besinnt er sich am Schluss auf seine Pflicht (890f.): Ich will gehen, um ihm Fürsprecher zu sein. Will mal sehen, ob ich ihm dazu verhelfe, dass er schneller verurteilt wird.
Keinesfalls darf ein Gast den Gastgeber, bei dem er zuvor zu wohnen pflegte, wechseln und anderswo am Ort seine Unterkunft suchen. Er würde durch solche Handlung den früheren Gastfreund aufs Schwerste kränken und ihn bei den Leuten in den Ruf eines schlechten Gastgebers bringen, was dem Verlust des gesellschaftlichen Ansehens gleichkäme. Caesar, der in Verona den Vater des Dichters Catull zum Gastfreund hatte, nahm, auch nachdem der Sohn ihn mit Schmähversen schwer beleidigt hatte, demonstrativ weiterhin bei jenem Quartier, sooft er nach Verona kam, und lud den Dichter noch am selben Tage, an dem dieser Abbitte geleistet hatte, an seine Tafel (Sueton, Julius 33). Sogar der vom Ankläger Cicero als skrupellos geschilderte Verres bleibt, obwohl er sich gern bei einem andern Bürger, dessen Tochter er begehrt, ins Haus setzen möchte, bei seinem Quartiergeber Janitor wohnen, als dieser, weil er nicht als schlechter Gastgeber dastehen will, ihn anfleht zu bleiben, und Verres keinen ausreichenden Vorwand findet, das Verhältnis zu lösen (II 1,64). Derselbe Verres scheut sich allerdings nicht, als er die Macht eines Statthalters von Sizilien besitzt, dem angesehensten Mann von Himera, Sthenius, die Gastfreundschaft aufzukündigen, weil dieser ihn hinderte, aus der Stadt Kunstwerke zu rauben. Sthenius muss nach Rom flüchten, um nicht von Verres in einem widerrechtlichen Verfahren zum Tod verurteilt zu werden. Sogar der eigene Vater schämt sich des Verhaltens seines Sohnes und sucht die Affäre aus der Welt zu schaffen. Der Vorfall bildet später einen der gravierendsten Anklagepunkte in der Rede des Cicero gegen Verres (II 2, 89–101).
Eine witzige Schilderung der vielen Misslichkeiten, die ein Gast in Kauf nehmen muss, wenn er die mancherlei gebotenen Rücksichten beachtet, gibt Apuleius in seinem Roman ›Metamorphosen‹ (1,21–26 und 2,2–5). Lucius erfährt an der ersten Schenke beim Stadttor, dass sein Empfehlungsschreiben ihn an den Geizhals Milo in einem ärmlichen Hause verweist. Selbstverständlich klopft er dennoch dort an, wird von der einzigen Magd zunächst als Pfandleihkunde angesprochen, dann aber dem Herrn gemeldet und empfangen. Milo ist gerade beim Essen, der angekommene Gast wird an ein leeres Tischchen gesetzt. Nachdem der Hausherr das Empfehlungsschreiben gelesen hat, muss die Hausfrau ihm ihren Sitz als den Ehrenplatz einräumen, der Gastgeber weist ihm mit höflichen Worten ein Zimmer an, in dem keine Stühle und nur wenig andere Möbel stehen, aus Angst vor Dieben, wie Milo entschuldigend sagt. Das Bad muss Lucius außer Haus aufsuchen. Als er, immer noch hungrig, zurückkommt, bittet ihn die Magd zum Hausherrn. Doch statt des erwarteten Essens verwickelt ihn dieser in ein endloses Gespräch, erkundigt sich nach allen Dingen so lange, bis der Gast vor Erschöpfung nicht mehr zu sprechen vermag. Am andern Tag wird er auf einem Spaziergang in der Stadt überraschend von einem alten Ehepaar erkannt. Die Frau, deren Reichtum schon an ihrem Goldschmuck erkennbar ist, erweist sich als seine Tante und lädt ihn in ihr sehr schönes Haus ein. Aber Lucius weiß, was sich gehört: Das sei ferne von mir, liebe Tante, dass ich meinen Gastfreund Milo ohne ernsten Grund zur Klage verlasse! Doch gewiss, soweit es ohne Verletzung meiner Pflichten geschehen kann, will ich mein Möglichstes tun. Sooft sich wieder ein Anlass zur Reise hierher ergibt, werde ich nie versäumen, bei dir einzukehren. Zu einem kurzen Besuch betritt er immerhin das Haus seiner Tante, dessen Pracht der Dichter in höchsten Tönen vorführt. Die um ihn besorgte Tante warnt ihn auch vor dem Weggehen vor der Frau seines Gastgebers Milo, einer berüchtigten Meisterhexe. Gerade damit allerdings reizt sie die Neugier des Lucius, die ihm dann zum Verderben wird.
Hannibal hatte, nachdem er in seiner besiegten Heimat nicht mehr leben konnte, schutzflehend beim König Prusias in Bithynien Zuflucht gefunden. Als seinem Gastgeber jede Möglichkeit genommen war, die römische Aufforderung, den Gast auszuliefern, zurückzuweisen, war Hannibals Selbstmord das, was ein sich korrekt verhaltender Gast dem Gastgeber an Rücksicht schuldete: Er ersparte dem König die unauslöschliche Schande des Gastverrats.