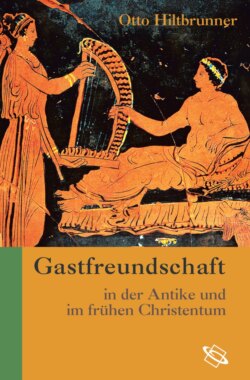Читать книгу Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum - Otto Hiltbrunner - Страница 9
4. Xenos, ein Fremdwort im Griechischen
ОглавлениеDie Griechen, durch ihre Sprache dem indoeuropäischen Kreis zugehörig, haben bei ihrer Einwanderung aus dem Binnenland zu den Küsten und Inseln des Mittelmeers von der überlegenen Kultur, die sie dort antrafen, eine Menge von Sachen und Wörtern übernommen. Dazu gehört unter anderem das Wort xenos für den Gast. Alle Versuche, xenos etymologisch mit ghostis zu verknüpfen, sind misslungen. Das Erbwort Gast ist in der Sprache der Griechen schon früh verloren gegangen. Bis ins 20. Jahrhundert war es Homer, von dem man die älteste Wortform xeinos (entstanden aus xenwos) kannte. Die Entdeckung und Entzifferung von Tafeln in Silbenschrift aus der von Homer besungenen Vorzeit hat in der Form ke-se-nuwo ein Zeugnis beigebracht, das noch ins zweite Jahrtausend v. Chr. zurückreicht. Wir wissen jetzt mit Gewissheit, dass die Übernahme des Fremdworts schon sehr bald nach der Einwanderung stattgefunden hat. Was wir nicht kennen, ist die Sprache, aus der xenos entlehnt wurde. Sie muss im Ostmittelmeerraum heimisch gewesen sein und offenbar einen Begriffsinhalt geboten haben, der den Einwanderern nützlicher vorkam als das, was sie mitbrachten.
Was war das Neue? Im alten Orient spielen von jeher neben Bauern und Nomaden die Händler eine wichtige Rolle, die mit ihren Esel- und später Kamelkarawanen von weither ihre Waren in die Städte bringen. Ihr Weg führt sie oft tagelang durch Wüsten, in denen ein Mensch nicht überlebt, wenn er nicht für sich und seine Tiere in Oasen Obdach und Versorgung findet. Die Natur des Landes macht Arabien zur Wiege der Gastfreundschaft in einer Tradition, die sich aus vorislamischer Zeit bis in die Gegenwart fortsetzt. Auch hier geht es zuallererst um ein Sittengebot, in der Grundmotivation nicht anders als in dem schon betrachteten Kulturkreis.
Gastfreundschaft (diyāfa, qirā) ist eine Ehrenpflicht, die Freigebigkeit gegenüber dem Gast (daif) geht bis zur Verschwendung. Dichter vergleichen den großzügigen Gastgeber mit der Regenwolke oder dem Meer, verständlich in einem Land, in dem Wasser die köstlichste Gabe ist. Wer nicht in den schändlichen Ruf eines Geizhalses geraten will, wartet die Gäste nicht einfach ab, er sucht sie. Bei Nacht werden weithin sichtbare Feuer angezündet, um den Fremden den Weg zu den Zelten anzuzeigen; das Gebell der Hunde um den Lagerplatz soll sie einladen. Auch der Ärmste entzieht sich nicht der Pflicht. Vor dem Stadttor trifft der aus der Wüste kommende Prophet Elias auf eine Brennholz sammelnde arme Witwe.11 Er bittet um einen Schluck Wasser. Auf seinen weiteren Wunsch nach einem Stück Brot antwortet sie, sie habe nichts mehr als eine Handvoll Mehl und einen letzten Tropfen Öl; die wolle sie mit ihm und ihrem Sohn teilen und dann Hungers sterben. Gott lohnt ihre Gastfreundlichkeit mit einem Wunder: Der Mehltopf wird von jetzt an immer voll bleiben und das Öl in der Flasche nicht weniger werden. Die Witwe hat nach der im Orient herrschenden Sitte gehandelt, die nicht allein unter den Beduinen, sondern ebenso in den Städten gilt. Kein Unterschied wird bei der Person des Gastes gemacht, jeder ist willkommen und es ist unschicklich, ihn sogleich zu fragen, wer er sei, woher er komme und was er für ein Ziel habe.
Deutlich unterscheidet sich allerdings Altägypten. Hier ist es nicht die Wüste, sondern der Uferstreifen am Nil, der das Verhalten der Anwohner prägt. Als Mitmenschen trifft man weniger mit dem Ankömmling aus der Fremde zusammen als mit dem der Hilfe bedürftigen Landsmann. Die Regeln sind daher stärker vom Mitleid motiviert als vom Wunsch nach Kommunikation. So lehrt der Schreiber Anii um 1400 v. Chr. seinen Sohn: Iss nicht Brot, wenn ein anderer Mangel leidet und du ihm nicht die Hand mit dem Brote reichst. Oft wiederholt erscheint die Formel des Totenlobs: Ich habe dem Hungernden Brot gegeben und dem Dürstenden Wasser (oder Bier), dem Nackten Kleider, dem Schifflosen eine Fähre. Wenn es in der Lehre des Amenenope heißt: Weise nicht den Fremden von deinem Ölkrug ab; so verdoppelt er sich vor deinen Brüdern. Gott liebt den, der den Geringen erfreut, mehr als den, der den Vornehmen ehrt, so ist mit dem Fremden zunächst wohl der nicht zum eigenen Haushalt Gehörende gemeint. Aber die Integrationskraft der überlegenen Kultur Ägyptens war in der Frühzeit stark genug, um auch Ausländer einzugliedern. „Gastarbeiter“, zumeist als Söldner in den ägyptischen Heeren und als Beamte wie der Israelit Joseph am Hof des Pharao, wurden, wenn sie sich in Sitten und Lebensweise des Landes einfügten, nicht als Fremde abgelehnt. Sogar die libyschen und äthiopischen Herrscherdynastien wurden nicht als drückende Fremdherrschaft empfunden. Als fremd blieb isoliert, wer auf seiner nicht ägyptischen Lebensform bestand, wie es die Israeliten mit der Verwerfung der ägyptischen tiergestaltigen Gottheiten taten. Daher antwortet Moses (Gen. 2,26) auf das Verlangen des Pharao, sie sollten ihrem Gott opfern: Das kann nicht geschehen, denn dann würden wir die Götzen der Ägypter unserem Gott opfern. Wenn wir das, was die Ägypter verehren, vor ihren Augen schlachten, werden sie uns steinigen. Die grundsätzlich tolerante Haltung gegenüber Fremden änderte sich, als mit Griechen und Persern den Ägyptern nicht integrationswillige Vertreter eigenständiger Hochkulturen gegenüber traten. Der Pharao Psammetich I. hat im 7. Jahrhundert v. Chr. griechische Söldner angeworben, als er das Land nach langen Abwehrkämpfen gegen Herrscher aus Nubien und Syrien im saitischen Reich einigte, und er gestattete die Gründung von Naukratis im Nildelta als Kolonie der griechischen Stadt Milet. Doch das Statut, das Naukratis im 6. Jahrhundert durch den als Griechenfreund bekannten Pharao Amasis erhielt, verlieh der milesischen Niederlassung zwar ein Monopol für den Handel mit den Griechen, hielt aber zugleich streng die Fremden vom Landesinneren fern, so dass in der griechischen Literatur Ägypten mit dem Schlagwort Xenelasía (Fremdenvertreibung) verbunden wurde. Dass dann doch der Grieche Herodot das Land bereisen und beschreiben konnte, war nur möglich, weil es zu jener Zeit unter der Herrschaft der Perser stand. Frühestens aus der Perserzeit, eher wohl aus der ihr folgenden Zeit unter den makedonischen Ptolemäern, stammt das Demotische Weisheitsbuch (Papyrus Insinger), in dem Gott mit den Worten gepriesen wird: Er lässt den Fremdling, der von auswärts kommt, wie die Einheimischen leben. Da wirkt eine altägyptische Einstellung fort, aber derselbe Text warnt davor, die Heimat zu verlassen, und schildert das Ungemach, das ein Ägypter in der Fremde, rechtlos und auf Mitleid angewiesen, erdulden muss.
Handelstransporte finden in Ägypten mit Schiffen auf dem Nil statt. Der Händler übernachtet auf seinem Kahn oder im Freien am Uferstreifen, er ist nicht auf Obdach bei Gastgebern angewiesen. Das erklärt die Ausnahmestellung Ägyptens. Was für die Xenía (Gastfreundschaft) in Griechenland vorbildhaft gewirkt hat, waren die Karawanenhandel treibenden Völker des Ostens. Handel ist auf die Institution der Gastfreundschaft angewiesen. Denn wer den gesicherten Aufenthaltsort bei seinem Stamm verlässt, ist schutzlos. Auf seinem Weg ist er Überfällen und Plünderungen ausgesetzt, wird Opfer von Blutrache, wenn sie von irgendeinem Angehörigen seines Stammes gefordert wird, stets in der Gefahr, in der Wüste einsam zu verderben. In die gleiche Lage konnte jeder geraten, wenn er zu reisen genötigt war, und wer jetzt Gastgeber war, konnte bald einmal seinerseits auf die Gastfreundschaft des anderen angewiesen sein. Es musste daher feste Regeln des Gastrechts geben. Sobald der Schutz suchende Fremde die Zeltstricke berührt hatte oder von dem Angebot an Speise und Trank gekostet, eine Bittformel gesprochen hatte, war der Gastherr verantwortlich für seine Unverletztheit und hatte ihn vor Verfolgern zu schützen, selbst wenn er dadurch selber in äußerste Gefahr geriet. Die Garantie bezog auch das Eigentum mit ein. Der Gastgeber durfte ebenso wenig sich an dem vergreifen, was der Fremde eingebracht hatte, wie der Gast am Eigentum des Schutzherrn. Starb allerdings der Gast im Hause des Gastgebers, war dieser sein Erbe. Schon früh war das Gastrecht so institutionalisiert, dass es nicht bloß im Verhältnis zwischen Einzelpersonen galt, sondern zwischen Stämmen und Völkern vertraglich abgeschlossen werden konnte. Die nicht israelitischen Einwohner im Lande Israel werden mit dem Wort für Gast (ger = arabisch ğār) bezeichnet und sind als Mitglieder dieser Gruppe geschützt. Als Mohammed mit seinen Anhängern den eigenen Stamm in Mekka verließ, um nach Medina auszuwandern, schloss er vorher einen Schutzvertrag mit den dortigen zwei arabischen Stämmen ab.
Ein frühes Beispiel für ein Zusammentreffen der Händler aus Mesopotamien mit einer sesshaft bäuerlichen Bevölkerung im Hochland Kleinasiens gibt schon zu Beginn des 2. Jahrtausends v.Chr. die dortige Handelsniederlassung der Assyrer in der Stadt Kanes in Kappadokien. Sie steht unter assyrischer Verwaltung und assyrischem Recht, eine eigene Stadt vor den Mauern der inneren Stadt der Einheimischen. Deren Fürst begnügt sich mit der Erhebung der von den Eselkarawanen der Assyrer zu entrichtenden Zölle.12
In einer solchen Kontaktzone muss die Übernahme des Wortes und des Begriffs xenos durch die Griechen stattgefunden haben. Sie waren vor ihrer Einwanderung Ackerbauern und Hirten gewesen, haben sich aber gelehrig der neuen maritimen Umgebung angepasst. Doch bis sie zu einem Volk von Seefahrern wurden, dauerte es eine Übergangszeit, während der ein Zustand eintrat, wie er ähnlich in Kanes zu sehen ist. Den Seehandel im Mittelmeer beherrschten die Phönizier mit ihren Faktoreien in den Häfen. Am mächtigsten wurde Karthago, allerdings erst zu einer Zeit gegründet, als auch die Griechen schon im Seehandel aktiv wurden mit Hauptrichtung zum Schwarzen Meer, während die Phönizier von Karthago aus, bald im Wettstreit mit den Etruskern, im Westmittelmeer so stark dominierten, dass die Römer erst viel später als die Griechen mit dem Handel zur See beginnen konnten. Sie haben das ererbte Wort hospes bis in die Zeit der kriegerischen Auseinandersetzung mit den Karthagern in seiner ursprünglichen, auf den Gastgeber beschränkten Bedeutung bewahrt; die Griechen dagegen, die viel früher in regen Handelsverkehr eintraten, haben mit der Landnahme alsbald auch den doppelgesichtigen Begriff xenos und das Wort übernommen. Denn für den Handelsaustausch taugt ein Verhältnis, in dem der Gast dem Gastherrn deutlich untergeordnet ist und seiner Hausgewalt untersteht, nicht. Vielmehr ist eine unentbehrliche Voraussetzung das Prinzip der Gegenseitigkeit.
Der Kaufmann muss sich darauf verlassen können, vom Geschäftspartner aufgenommen zu werden, und nimmt ihn seinerseits bei sich auf, wenn er in Geschäften zu ihm kommt. Der Unterschied zwischen dem Aufnehmenden und dem Aufgenommenen ist damit keine Dauerqualität mehr, die Rollen wechseln. Entscheidend ist vielmehr die Teilhabe an einem fest geregelten und für beide verbindlichen Dauerverhältnis gleichberechtigter Partner, das auf jederzeitige Wiederholbarkeit angelegt sein muss. Da ist es zweckmäßig, die Partner, welche einander gegenüber dieselben Rechte und Pflichten haben, mit demselben Wort zu bezeichnen. Xenos ist dieses Wort. Es könnte, wie so vieles andere auch, dem Vokabular, das die einwandernden Griechen neu aufnahmen, über die minoischen Kreter vermittelt sein, die bis zu den katastrophalen Seebeben des 15. Jahrhunderts v. Chr. eine große Seehandelsmacht waren; doch minoisch ist das Wort nicht. Phönizisch gleichfalls nicht; seine Herkunft liegt im Dunkeln. Der von ihm ausgedrückte Sachverhalt jedenfalls ist das, was den östlichen Handelsverkehr von dem durch indoeuropäische Tradition bestimmten Wortgebrauch im westlichen Europa unterscheidet. Und der Sachverhalt ist so wichtig, dass auch die Römer, sobald sie sich vom latinischen Bauernvolk zur Handelsnation entwickelten, die alten Wortbedeutungen von hostis und hospes preisgaben und hospes zu einem Synonym des griechischen xenos werden ließen. Nicht das Wort xenos selbst entlehnten sie, wohl aber dessen Bedeutung: hospes ist ein Musterfall dessen, was wir Bedeutungslehnwort nennen. Bedeutungslehnwörter klingen ebenso wie Fremdwörter immer ein wenig vornehmer, und das wirkt in der weiteren Wortgeschichte. Als den gewerblichen Herbergswirten ihre in republikanischer Zeit allein übliche lateinische Bezeichnung caupo zu gering vorkam, verbesserten sie ihr Image, indem sie sich hospes nannten.