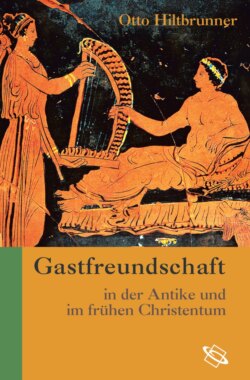Читать книгу Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum - Otto Hiltbrunner - Страница 14
Gastfreundschaft der Reichen
ОглавлениеAls der Syrakusaner Chromios bei dem Dichter Pindar das Festlied zur Feier seines Sieges in den Nemeischen Spielen bestellt hatte, sang der Dichter (Nem. 1,19–24): Ich stehe am Tor zur Halle eines gastfreundlichen Mannes, ein wohlklingendes Lied singend. Dort ist mir die Tafel geschmückt zu einem dem festlichen Anlass gemäßen Mahl. Die Gemächer sind wohlvertraut damit, oft fremde Gäste zu empfangen. Dann lässt er den Auftraggeber sprechen (31–33): Ich bin nicht darauf erpicht, großen Reichtum im Haus zu besitzen und ihn versteckt zu halten, sondern es mir mit dem, was ich habe, gut gehen zu lassen und mir einen guten Namen zu machen, großzügig gegenüber Freunden. Denn Hand in Hand gehen die Erwartungen der vielgeplagten Menschen. Zu einem reichen und angesehenen Mann gehört ganz selbstverständlich ein gastfreies Haus.
Sokrates führt bei Xenophon (Oikonomikos 2,5) die Standespflichten eines reichen Mannes in der Reihenfolge ihres Gewichtes an: Auf die an erster Stelle stehenden reichlichen Opfer für die Götter folgt sogleich die splendide Gastfreundschaft für viele Gäste. Sie steht noch vor den Leistungen für den Staat (Leiturgiai) und die Mitbürger. Das Ansehen, das ein Mann in der Öffentlichkeit genießt, hängt nicht zuletzt ab von der Zahl seiner Gastfreunde. Durch sie dringt sein Ruf über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus in die ganze Welt, überall dorthin, woher seine Besucher kommen. Freilich sind diese, dem Gegenseitigkeitsprinzip in der Gastfreundschaft zufolge, in aller Regel seine Standesgenossen. Von einer seltenen Ausnahme berichtet Herodot (6,127): Der Tyrann Kleisthenes von Sikyon wünschte sich den edelsten aller Griechen zum Schwiegersohn und lud alle Bewerber um die Tochter Agariste an seinen Hof. Unter ihnen befand sich Laphanes aus der Stadt Paion, von dessen Ahnherrn Euphorion man sich in der Heimat Arkadien erzählte, er habe einst die Dioskuren, die Zeus-Söhne Kastor und Pollux, in seinem Haus zu Gast gehabt und habe von da an alle Menschen gastlich bei sich aufgenommen. Euphorion bleibt aber dabei ein Xenodókos, ein Reicher, der unentgeltlich Gastfreundschaft gewährt, keineswegs gleichzusetzen mit einem Pandokeús, dem Wirt, der zwar jedermann, aber nur gegen Bezahlung, aufnimmt. Euphorion beweist eine Großzügigkeit, die sich sonst selbst der Allerreichste nicht leisten kann, und es ist das unüberbietbare und kaum vorstellbare Höchstmaß, wenn jemand in dieser Weise alle gastfrei hält.
Neben der Anzahl ist für das Prestige vor allem der Rang der Beherbergten wichtig. Im gesellschaftskritischen Roman des Petronius (Sat. 77,5) prahlt der eitle Freigelassene und Parvenu Trimalchio mit der Pracht seines Palastes. Unter den aufgezählten Räumen ist das Prunkstück der Gästetrakt, er bietet Platz für hundert Gäste. Und überhaupt, wenn Scaurus hierher gekommen ist, hat der nirgendwo lieber zu Gast sein wollen, und hat doch in Strandnähe eine vom Vater her begründete Gastfreundschaft. Dass es ihm gelungen ist, den mit der Familie des vornehmen Herrn aus Rom bisher verbundenen Gastfreund auszustechen, und Scaurus es vorgezogen hat, Gast Trimalchios zu sein, darauf ist dieser mächtig stolz. Denn die höchst unschickliche und kränkende Hintansetzung eines alten Gastfreunds durch Scaurus ist ihm ein Beweis seines eigenen sozialen Aufstiegs.
Die in sagenhafter Vorzeit liegende Gastfreundschaft eines Euphorion und die der homerischen Adeligen wird in den demokratischen Staaten von den politisch und gesellschaftlich führenden Familien als unverzichtbare Tradition weiter gepflegt. Ganz in diesem Sinne schreibt der athenische Gesetzgeber und Dichter Solon, und der athenische Aristokrat und Philosoph Platon zitiert wörtlich seine Verse (Lysis 212 E), wo es um die Gegenseitigkeit in der Freundesbeziehung geht: Glücklich, wer liebe Kinder um sich hat und einhufige Pferde und Hunde zur Jagd und einen Gast aus der Fremde. In seinem Dialog Protagoras lässt Platon das Gespräch stattfinden im Haus des Kallias, wo der berühmte Sophist aus Abdera gleichzeitig mit anderen berühmten Philosophen wie Hippias aus Elis und Prodikos von Kos während ihres Aufenthalts in Athen Wohnung gefunden hatte und wo sich nun die gesamte lernbegierige Gesellschaft der Stadt zusammenfand. Kallias, der Stiefsohn des Perikles, war der reichste Mann Athens, von den Komödiendichtern Aristophanes und Eupolis verspottet als Verschwender, von Gelehrten und Künstlern hochverehrt als Mäzen. Jeder Winkel des Hauses, bemerkt Platon (315 D), war für die Gäste in Anspruch genommen: Prodikos hielt sich in einer Kammer auf, die vorher Hipponikos (der Vater des Kallias) als Vorratsraum benutzt hatte. Jetzt aber hatte Kallias der Menge der einkehrenden Fremden wegen auch diese ausräumen lassen und zur Unterbringung seiner Gäste hergerichtet. Auch der Sokrates-Jünger Xenophon wählt das Stadthaus des Kallias zum Schauplatz seines „Symposion“. Wenn man den Zeugnissen der Späteren glaubt, war allerdings Kallias am Ende seines Lebens finanziell völlig ruiniert.
Er und die es ihm gleichtuenden Reichen begünstigten das Aufkommen der „Parasiten“, einer Klasse von Leuten, die ganz davon lebten, von ihnen eingeladen zu werden und sich an ihrem Tisch satt zu essen. Der Parasit wird alsbald zu einer Typenfigur in den Komödien, mit denen er als beliebte Lachnummer von Athen nach Rom wanderte und in den Stücken des Plautus und Terenz das Publikum erheiterte. Im Gegensatz zu dem Brauch, dass unter Gleichgestellten jeder Teilnehmer zum gemeinsamen Mahl einen eigenen Beitrag (Symbolé) mitbringt, benimmt sich der Parasit asýmbolos, er hat außer seinen Witzen nichts zu bieten und wird freigehalten. Heißhungrig und immer durstig muss er sich jedoch zuvor mit Bitten und Schmeicheleien die Einladung auf der Straße erbetteln und wird oft enttäuscht, was er wiederum mit übersteigerten Verwünschungen quittiert. Der Komödiendichter Diphilos (Frg. 73,7) gibt die Einstellung des Parasiten treffend wieder mit der Parodie einer Stelle, die angeblich aus einer Tragödie des Euripides stammt: Euripides liebte die Parasiten, spricht er doch: Denn ein Mann, der alles zum Leben hat und nicht mindestens drei Parasiten freihält, der sei verdammt, Heimkehr in seine Vaterstadt bleib ewig ihm versagt.
Das Gegenstück zum Parasiten, der Prahler (Alazón), erscheint zwar in den uns überlieferten Komödien nicht in der vorgespiegelten Rolle des vornehmen Gastgebers, doch kennt sehr wohl die Prosaliteratur eine dieser Figuren. In seinen „Charakterbildern“ beschließt der aristotelische Philosoph Theophrast die Schilderung des Alazon mit der Pointe (23,9): Er wohnt in einem Miethaus, behauptet aber gegenüber allen, die seine Verhältnisse nicht kennen, es sei das Haus seiner Väter. Nur habe er die Absicht, es zu verkaufen, denn für seine vielen Gäste erweise es sich längst als viel zu klein. Eine ausführlich erzählte Szene bietet – aus unbekannter griechischer Quelle ins Lateinische übertragen – die so genannte Rhetorik an Herennius (4,50,63f.): Zufällig kommen Gastfreunde daher, die der Mann früher einmal, als er in der Fremde großspurig aufgetreten war, eingeladen hatte. Natürlich gerät er in nicht geringe Verlegenheit, aber er bleibt seiner Natur treu. Oh, wunderschön, dass ihr kommt, sagt er, aber ihr hättet noch besser getan, hättet ihr mich gleich in meinem Stadtpalais aufgesucht. – Das hätten wir schon getan, antworten sie, wenn wir bloß gewusst hätten, wo es denn steht. – Ist doch ganz leicht zu finden, von jedem Stadttor her. Aber kommt nur gleich mit mir. – Unterwegs flunkert er ihnen alles Mögliche vor, erkundigt sich, wie bei ihnen die Ernte auf den Feldern stehe. Er könne leider nicht aufs Land fahren, denn sein Landhaus sei abgebrannt und er wage sich noch nicht an den Neubau. Doch auf dem Gut in Tusculum, da habe er sich blindlings in das Abenteuer gestürzt und angefangen, es auf den alten Grundmauern wieder zu erstellen. Unter solchen Reden kommen sie zu einem Haus, in dem man gerade Vorbereitungen trifft für eine Vereinsfeier an diesem Abend. Da er mit dem Hausherrn bekannt ist, lässt man ihn mit seinen Begleitern ein. – Hier wohne ich, sagt er zu ihnen, inspiziert das aufgestellte Tafelsilber, die Decken auf den Polstern und spricht herablassend seine Zufriedenheit aus. Auf einmal eilt ein junger Diener herbei und fragt ihn laut und vernehmlich, ob er jetzt gehen wolle, der Herr werde gleich hier sein. – Ach so, gibt er zur Antwort. Nun, meine Freunde, wir wollen uns verabschieden. Mein Bruder ist eben von seinem Falernergut angereist, ich möchte ihn begrüßen gehen. Aber kommt, bitte, heute abend zum Essen, um fünf. – Die so Eingeladenen entfernen sich. Der Prahler macht sich schnell aus dem Staube in seine Mietwohnung. Um fünf erscheinen, wie abgemacht, die fremden Gäste, sie fragen nach ihrem Bekannten. Bald merken sie, wem das Haus wirklich gehört. Sie ernten Gelächter und Spott und müssen im Wirtshaus ein Nachtquartier suchen. Anderntags begegnet ihnen der Mensch auf der Straße. Sie berichten, was geschehen, stellen ihn zur Rede, machen ihm Vorwürfe. Er aber behauptet, sie hätten sich wohl an einer ähnlichen Straßenkreuzung geirrt und seien um eine ganze Gasse zu weit gegangen. (Die Straßen antiker Städte waren nicht ausgeschildert und die Häuser trugen keine Nummern. Das machte einem Ortsfremden die Orientierung schwierig. Auch im Roman des Petronius [Satyricon 6,7 und 79,1–7] findet Encolpius das Gasthaus nur schwer wieder, in dem er sich einquartiert hat.) Er habe seinerseits bis spät in die Nacht hinein gewartet, obwohl ihm doch der Arzt jede Anstrengung verboten habe. Inzwischen hatte er seinen Sklaven herumgeschickt, er solle auf Pump Geschirr, Decken und ein paar Leute zur Bedienung organisieren. Der nicht ungeschickte Diener hatte es mit viel schönen Worten tatsächlich fertig gebracht. Jetzt führte er die Gastfreunde in seine Wohnung. Das große Palais, sagt er, habe ich einem guten Bekannten zur Verfügung gestellt für seine Hochzeitsfeier. Plötzlich platzt der Sklave herein mit der Nachricht, das Tafelsilber werde zurückverlangt. Dem Verleiher waren einige Zweifel aufgestiegen. – Unverschämtheit, ruft der Mensch, das Palais habe ich ihm überlassen, die ganze Dienerschaft, jetzt will er auch noch das Silber! Doch meinetwegen, obwohl ich Gäste habe, er soll’s nehmen. Wir können es uns auch mit einfachem Tongeschirr gemütlich machen.
Während in der Komödie der Parasit zur Figur eines Hanswurst gestempelt ist, malt die Tragödie den freundlichen Gastgeber in den leuchtendsten Farben als Vorbild. In der ›Alkestis‹ des Euripides tut der thessalische Fürst Admetos das Äußerste, um von seinem Gastfreund Herakles alles fern zu halten, was ihn betrüben könnte. Herakles sieht das Haus in tiefer Trauer und will anderswo Unterkunft suchen, doch Admet nötigt ihn zu bleiben und verheimlicht ihm, dass es seine eigene Gattin Alkestis ist, deren Tod man beweint. Der Gast soll unbekümmert Speise und Trank genießen, kein Laut der Totenklage darf zu den Gästezimmern dringen. Dem sich über sein Verhalten wundernden Chor entgegnet Admet: Mein Unglück wäre um nichts geringer, ich aber wäre ein schlechter Gastgeber. Zu allem Übel käme noch das andere hinzu, dass mein Haus in den Ruf der Ungastlichkeit geriete. Ich dagegen fände in diesem Mann hier den besten Gastfreund, wenn ich je einmal in das dürstende Land Argos zu ihm (Herakles) käme. Und als der Chor ihn fragt, warum er denn einem nach seinen eigenen Worten so vortrefflichen Freund den Schicksalsschlag verheimliche, rechtfertigt er sich: Niemals hätte er das Haus betreten wollen, hätte er etwas von meinem Leid erahnt. Es ist nicht die Art meines Hauses, Gastfreunde zu verscheuchen und ihnen die Ehre zu verweigern. Als Herakles dann wieder die Bühne betritt, vom Wein angeheitert und festlich bekränzt, den vergrämten Diener tadelt und von ihm die Wahrheit erfährt, ist er erschüttert von so viel Edelmut und dem Gast erwiesener Rücksicht. Er, der unbesiegte Sohn des Zeus, eilt dem Leichenzug nach und nimmt dem Tod seine Beute ab; die wieder ins Leben zurückgeholte Alkestis ist sein Gastgeschenk an Admet.
Auch in der Alltagswelt der Komödie geht das, was der Gastgeber seinem Gast zuliebe tut, gelegentlich weit über das Maß hinaus. Der Hausherr Periplectomenus im ›Miles gloriosus‹ (Der Maulheld) des Plautus bricht die Trennwand zum Nachbarhaus durch, damit sein Gast, der junge Athener Pleusicles, heimlich mit seinem vom Nachbarn, dem Titelhelden, aus Athen entführten Mädchen zusammenkommen kann. Die Handlung der Verwechslungskomödie lebt davon, dass die Personen über das Mauerloch unbemerkt den Ort wechseln. Der Gastgeber begeht mit dem Durchbrechen der Mauer (Toichorychia) eine Straftat, die das attische Recht ausdrücklich mit Todesstrafe bedroht. Doch als der Gast seine Befürchtung ausspricht, damit die Großzügigkeit des Hausherrn überfordert zu haben, bekommt er die folgenden Lehren über Gastfreundschaft zu hören (672–677): Du bist ein Tor! Was man an Kosten hat für ein böses Weib oder für einen Feind, das sind echte Kosten. Aber was man für einen rechten Gast, für einen Freund aufwendet, das ist Gewinn, und ebenso, was man an Kosten für den Dienst der Götter aufwendet, ist für den verständigen Mann ein Nutzen. Dank der Macht der Götter habe ich genug, um dich bei mir als einen Gastfreund anständig aufzunehmen. Iss, trink, gönne dir mit mir das Vergnügen und füll dir dein Herz mit Freude! Doch der Gast Pleusicles kennt die üblichen Gegenargumente (740–747): Es ist mir wirklich schon beinah zu viel, was ich dir an Aufwand zugemutet habe. Denn kein Gast kann bei einem noch so guten Freund einkehren, dass er nicht, wenn er drei Tage lang geblieben ist, allmählich unerwünscht würde. Ist er aber erst einmal zehn Tage lang geblieben, dann ist’s eine ganze Ilias von Konflikten. Und wenn selbst der Hausherr nichts dagegen hat, so murren doch die Sklaven.
Der römische Architekt Vitruv geht in seiner Beschreibung eines griechischen, vom römischen Atriumhaus sich unterscheidenden großen Stadthauses auf die Unterbringung der Gastfreunde ein (6,7,4): Links und rechts vom Peristyl, dem großen Männersaal, werden kleine Behausungen gebaut mit eigenen Eingangstüren, bequemen Speise- und Schlafräumen, damit die ankommenden Gäste nicht in den Peristylen, sondern in diesen Gastwohnungen untergebracht werden. Denn sobald die Griechen von feinerer Lebensart und reich genug waren, pflegten sie für eintreffende Gäste Speise- und Schlafzimmer einzurichten, sowie Kammern mit Vorrat, und am ersten Tage pflegten sie sie zur Tafel zu laden, am folgenden schickten sie ihnen Geflügel, Eier, Gemüse, Obst und sonstige Erzeugnisse des Landbaus auf ihre Zimmer. Darum nannten die Maler, wenn sie das, was man den Gästen überbringen ließ, in ihren Stillleben malten, Xénia (Gastgeschenke). Auf diese Weise fühlten sich die Herrschaften im gastlichen Hause nicht wie Fremde, weil sie in diesen Gastwohnungen die Freigebigkeit des Gastgebers genossen, aber doch für sich bleiben konnten.