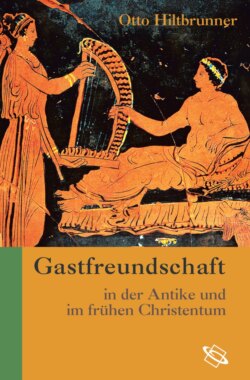Читать книгу Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum - Otto Hiltbrunner - Страница 18
Der Gastfreund im Privatrecht
ОглавлениеAnders als in Asien mit seinen Großreichen waren die Stadtstaaten im frühen Griechenland und ebenso im frühen Italien auf jeweils kleine Territorien beschränkt. Das erschwerte den Handelsverkehr. Denn der Nachbarstaat war schon Ausland, ein Gebiet, auf dem anderes Recht, andere Gesetze galten und nach Beginn der Geldwirtschaft auch andere Münzen. Sicherheit gewährte nur das Recht der Heimat; die hörte auf, sobald deren Grenzen überschritten wurden. Am fremden Ort konnte ein Kaufmann weder einen säumigen Schuldner noch einen Dieb verklagen. Auf See herrschte sogar völlige Rechtlosigkeit. Außerhalb des Heimathafens gab es kein Gesetz mehr, es wog nur noch die Gewalt des Stärkeren. Seeräuberei war gefährlich, aber straflos. In Homers Odyssee fragt der alterfahrene König Nestor seine neu angekommenen Gäste ganz unverblümt (3,71–74): Wer seid ihr, Fremde? Woher fahrt ihr über die nassen Pfade des Meeres? Treibt ihr Handelsgeschäfte oder kreuzt ihr aufs Geratewohl umher auf der See wie die Räuber, die umhersegelnd ihr eigenes Leben wagen und den Menschen aus anderen Ländern Böses bringen? Es waren zu Nestors Zeiten vor allem die Phönizier, die von Tyros und Sidon im Libanon bis nach Gades in Spanien mit allen Küsten Handel trieben. Ihre Schiffe mussten zur Verteidigung gerüstet sein; aber trafen sie auf ein Schiff, das nach guter Beute aussah, taugten ihre Waffen ebenso wohl zum Angriff. So konnten sie in den angelaufenen Häfen sowohl Beutestücke wie auch gefangen genommene Menschen als Sklaven zum Kauf anbieten.
Spielte sich der Seeraub in einem friedlosen Raum ab, war das Faustrecht zu Lande noch folgenschwerer. Denn hier wurde der Anspruch eines Bürgers der Nachbarstadt verletzt, und das forderte Wiedergutmachung und löste eine Reihe von Kriegen aus. Nestor berichtet in der Ilias (11,698–702) von einem solchen vergeltenden Zugriff: Auch ihm (dem König Neleus von Pylos) wurde großer Schadenersatz geschuldet im heiligen Elis, vier preisgekrönte Rennpferde mitsamt dem Wagen, die zu einem Wettkampf gekommen waren. Um einen Dreifuß als Preis sollten sie laufen. Die jedoch nahm der Landesfürst Augeias in Beschlag für sich und schickte den um seine Rosse jammernden Wagenlenker dorthin zurück, woher er gekommen war. Der nach dem Ortsrecht gegen einen Fremden nicht verbotene Zugriff des Machthabers wurde Ursache zu einem Feldzug der Leute von Pylos gegen Elis. Unter Führung des Königssohnes Nestor holten sie sich ganze Herden von Rindern, Schafen und vor allem Pferden als Beute, und alle, die aus früheren Diebstählen Rückforderungen an Elis hatten, wurden zur Verteilung eingeladen. Die Eleer aber rückten mit Heeresmacht an; sie erlitten gerechterweise eine blutige Niederlage. Die Zuhörer, die dem diese Erzählung Nestors von seinen Heldentaten vortragenden Sänger lauschten, müssen die Tat des Eleers Augeias, welche die Unheilskette auslöste, als besonders schnöde empfunden haben. Denn in Elis liegt Olympia, und während der gesamthellenischen Festspiele war der „heilige Friede“ ausgerufen und allen teilnehmenden Griechen die Unversehrtheit ihrer Person und ihrer Habe zugesichert. Zwar hatte es zu Nestors Zeit die Olympischen Spiele mit ihren Wagenrennen noch nicht gegeben, aber die Hörer der Ilias nahmen das Geschehnis aus der Sicht ihrer eigenen Zeit wahr.
Was Augeias getan hatte, war ein Beispiel dessen, was in der griechischen Sprache sylan hieß, der Zugriff auf die Person und das Wegnehmen der Sache eines Fremden, der außerhalb seines eigenen Landes rechtlos war. Der im Beispiel von Nestor geübte gewaltsame Rückgriff drohte nicht nur dem Schädiger selbst; sylan war erlaubt gegen jeden seiner Mitbürger, alle Angehörigen des Stammes hafteten für die ausstehende Schuld des einen. Mit solcher Rechtlosigkeit, die jeden Handel über die engen Stadtgrenzen hinaus zum gefährlichen Abenteuer machte, konnten sich gerade die griechischen Kleinstaaten auf Dauer nicht abfinden. Sie konnten ohne einen geregelten Verkehr mit den Nachbarn wirtschaftlich nicht bestehen. Man schloss also Verträge, in denen man sich gegenseitig Asylia, Nichtberaubung, zusicherte.16 Das Wort Asyl lebt bis heute fort, wenngleich unter Veränderung und Erweiterung seines Bedeutungsinhaltes.
In griechischer Sprache ist ásylos eine Eigenschaft, die Personen und Sachen beigelegt wird, denen ein rechtlicher Schutz vor Zugriff zugesichert ist. Das Wort bezeichnet nicht als Substantiv einen Ort, an dem jedermann vor Zugriff gesichert wäre. Wenn der Dichter Euripides Medea fragen lässt, wo sie als Mörderin ein schützendes Land (ge asylos [Med.387]) finden könnte, ist ein Ort gemeint, an dem sie für ihre eigene Person vor Rächern geschützt würde, nicht ein Ort, an dem jedermann unantastbar bliebe, es sich also um eine Eigenschaft handelte, die dem Ort als solchem zukäme. Zwar kann kein Staat allein Sicherheit über die Grenzen seines eigenen Staatsgebiets hinaus garantieren, und so ist der Schutz von Personen und Sachen auch örtlich begrenzt. Jedoch kann der Bereich ausgedehnt werden, indem zwei oder mehrere Staaten sich gegenseitig durch Abkommen verpflichten. Beispielsweise beruht der Schutz für Besucher der vier gesamtgriechischen Festspiele in Olympia, Delphi, Korinth und Nemea auf Vereinbarung aller beteiligten Staaten. Er wird einerseits am Festort in Bestätigung seiner sakralen Asylia zugesichert, anderseits gilt er für den einzelnen Reisenden auf seinem Weg durch die Staaten zum Festort; bei einer Seefahrt wird er aber erst wirksam mit dem Einlaufen des Schiffes in einen Hafen der Staaten. Neben dem staatsrechtlichen Schutz wirkt bei den Festspielen der sakrale mit. Doch auch bei den Heiligtümern schützt das Tabu zunächst Götterbilder, Bauten, heilige Bäume vor Beraubung (Hierosylia) und Personen deswegen, weil sie innerhalb des Heiligtums als Hilfesuchende und Schutzbefohlene Gäste der Gottheiten geworden sind. Auf diese Weise wird der abgegrenzte Bezirk des Heiligtums als Ort verstanden, dessen sakrale Asylia rechtlich anerkannt ist, und Städte und Tempel lassen ihr ganzes Territorium zum geheiligten Bezirk mit Asylia erklären. Es geschieht durchaus zu ihrem Nutzen, denn aus ihrer Heimat Verbannte bringen in der Regel genügend Vermögenswerte mit, um da als vornehme Gäste zu leben.
In Rom und in lateinischer Sprache bezeichnet dann das Substantiv Asylum von Anfang an einen Ort, eine Fluchtstätte für jedermann. Das Asyl des Romulus wird gegründet zum Zweck, Siedler anzulocken für den Aufbau der neuen Stadt. Doch auch noch im Römischen Reich beschränkt sich das Asyl auf die Garantie der Unversehrtheit, ohne irgendeine darüber hinausgehende Unterstützung der geschützten Personen vonseiten des Asylgebers.
Asylia gewährt passiven Rechtsschutz nur jeweils auf dem Gebiet der Vertragsstaaten. Bis weit in die historische Zeit hinein bleibt die Wegnahme fremden Eigentums auf hoher See, also Piraterie, straffrei. Im 5. Jahrhundert v. Chr. bestimmt ein Staatsvertrag zwischen Oianthea und Chaleion, zweier Handelsstädte am Golf von Korinth17: Fremde Güter vom Meer weg fortzunehmen unterliegt keinen Repressalien, ausgenommen aus dem Stadthafen. Erst Großmächte wie der Athenische Seebund und später das römische Imperium sind imstande gewesen, den Kampf gegen Seeräuber einigermaßen wirksam zu führen. Doch auch zu Lande verbietet der negative Begriff Asylia, Nicht-Beraubung, zwar die Tat und sieht die Bestrafung des Täters vor, gibt aber dem Fremden kein selbständiges aktives Klagerecht. Ein Rechtsstreit entsteht immer dann, wenn der eine Kontrahent den Zugriff als eine seiner Meinung nach rechtmäßige Pfändung vornimmt, der Gegner aber sich dagegen im Rückgriff wehrt. Der eben genannte Vertrag schützt die fremden Händler mit der Vorschrift: Den Fremden soll der Oiantheier nicht aus dem Gebiet von Chaleion noch der Chaleier aus dem Gebiet von Oianthea gewaltsam wegführen noch seine Habe, wenn er etwas beschlagnahmt. Gegen den Beschlagnahmenden Beschlagnahme auszuüben, ist straffrei. Der Streit muss also vor dem Gericht entschieden werden, und zwar jeweils am Ort der Wegnahme, nicht am Wohnort des Pfändenden, sei es, dass der in Oianthea Wohnende in Chaleion pfändet oder der in Chaleion Wohnende in Oianthea. Fremdes Gut auf See wegzuführen, ist asylon, das heißt, es unterliegt nicht den Regeln des sylan. Weder der Raub noch das Rückholen des Geraubten auf See wird geahndet, ausgenommen aus dem Hafen der betreffenden Stadt, was so viel heißt: Wird das Raubgut als Eigentum eines Bürgers einer der Vertragstädte erkannt, unterliegt es der rückgreifenden Beschlagnahme. Unrechtmäßige Beschlagnahme – es gibt also auch ein berechtigtes sylan! – wird belegt mit einer Strafe, deren Höhe vertraglich in beiden Städten gleich angesetzt ist: Vier Drachmen; wenn er das Pfand länger als zehn Tage behält, dann schuldet er den anderthalbfachen Betrag von dem, was er an sich genommen hat.
Ein Bürger der Stadt muss für den Fremden bei allen Rechtshandlungen eintreten und vor Gericht für ihn sprechen. Diesen Beistand leistet der Próxenos; er ist als Stadtbürger legitimiert, die Klage vorzubringen und die Interessen des Ausländers für ihn wahrzunehmen. Er hütet für den Fremden Vermögenswerte, die dieser bei einer Abreise in seinem Gewahrsam zurückgelassen hat.
Ein solches Depot spiegelt in der Komödie ›Bacchides‹ des Plautus ein schlauer Sklave seinem Herrn vor, um ihm weiszumachen, warum er das Geld nicht nach Athen mitbringt, welches aus Ephesus hergeholt werden sollte (250ff.). Der alte Nicobulus fragt, ob sein Sohn von dem Gastfreund Archidemides das Geld bekommen habe. Der Sklave Chrysalus (253): Was? Gastfreund nennst du ihn, deinen Feind! … Zuerst hat er sich auf Ausflüchte verlegt, er sei dir keine drei Pfennige schuldig. Sogleich holte Mnesilochus (der Sohn des Alten, der in Wirklichkeit das Geld leichtfertig durchgebracht hat) unseren alten Gastfreund, den alten Pelagon, als Beistand herzu. In dessen Gegenwart zeigte er dem Kerl auf der Stelle das Symbolon vor, das du selber ihm mitgegeben hattest, damit er es ihm vorweisen könne. … Der aber fährt fort zu behaupten, es sei gefälscht, es sei nicht das echte Symbolon. Nachdem sie schließlich vor Gericht die Zahlung erreicht hätten, habe er, der schlaue Sklave, vor der Ausfahrt aus dem Hafen ein verdächtiges Schiff beobachtet (289 ff.): Als wir aus dem Hafen ausfahren, verfolgen uns die Leute mit dem Ruderboot, schneller als Vögel und Winde! Weil ich merke, was da gespielt werden soll, haben wir unser Schiff sofort gestoppt. Nachdem sie uns still halten sehen, fangen sie an, im Hafen mit ihrem Boot Runden zu drehen. … Wir ziehen uns wieder in den Hafen zurück. … Wir halten gleich anschließend Rat. Am nächsten Tag tragen wir das ganze Geld fort, vor ihren Augen, offen sichtbar, damit sie wissen sollten, was geschah. … Traurig, weil sie uns geradewegs vom Hafen mit dem Geld weggehen sehen, ziehen sie sogleich ihr Boot an Land und lassen die Köpfe hängen. Wir dagegen haben das ganze Geld hinterlegt bei Theotimus; der ist dort der Priester der Artemis von Ephesus, … der Sohn des Megalobulus, derzeit der bei den Ephesiern beliebteste Mann von ganz Ephesus. Nicobulus äußert sich besorgt, aber der Sklave beruhigt ihn (312 f.): Nein, es ist doch direkt im Artemis-Tempel verwahrt. Dort steht es unter staatlicher Obhut.
Damit kommt ein zweiter Aspekt der Asylia ins Spiel, der keinen Bezug zur Gastfreundschaft hat, die Heiligkeit des Tempels als eines durch religiöses Tabu vor jedem Zugriff geschützten Ortes. In der Tat haben antike Städte ihren Staatsschatz im Tempel aufbewahrt, und unter entsprechenden Umständen konnte wohl auch ein Privatmann den besonderen Schutz eines solchen Ortes nutzen.
Der alte Gastfreund Pelagon, den Mnesilochus in der Lügengeschichte herbeiruft und der ihn dann vor dem ephesischen Gericht vertritt und die Durchsetzung seiner Geldforderung erstreitet, tut dies in seiner Eigenschaft als Próxenos der Familie des Atheners. Häufiger als eine Proxenie für Privatpersonen erscheint in den erhaltenen Zeugnissen der Próxenos, den ein auswärtiger Staat offiziell bestellt dazu, seine Staatsinteressen am Ort zu vertreten und sich der Angelegenheiten aller seiner sich am fremden Ort aufhaltenden Bürger anzunehmen. Von ihm wird im Rahmen der staatlichen Gastfreundschaft näher zu reden sein (siehe unten S. 69). Die Stadt Oianthea, deren Vertrag aus der Mitte des 5. Jahrhunderts v.Chr. eben betrachtet wurde, hatte schon zu Beginn des 6. Jahrhunderts ihren Proxenos auf der Insel Kerkyra (Korfu; IG IX 1, 867).
Ebenso wichtig wie die Fürsprecher für die Fremden waren die Richter. Die Fremdengerichtsbarkeit regelt Streitigkeiten zwischen Fremden und Einheimischen und zwischen zwei ortsfremden Parteien. In Griechenstädten, die ihre Auslandsbeziehungen geregelt haben, sind für solche Streitigkeiten eigene Behörden eingesetzt, die Xenodíkai (zu unterscheiden von den Xenokrítai, von auswärts beigezogenen Richtern). Xenodíkai sind inschriftlich oft bezeugt, zum Beispiel in Ämterlisten aus Athen,18 im Rechtshilfevertrag zwischen Athen und Troizen,19 in dem Beschluss über die Vereinigung der phokischen Städte Medeon und Stiris20 und anderwärts öfter. Auch die das Gesetz über das Verfahren in Fällen strittiger Beschlagnahme (sylan) enthaltende Bronzetafel von Oianthea führt im Anschluss ein weiteres Gesetz an zur Regelung des Falles, dass die zwei Fremdenrichter (Xenodíkai) sich nicht auf eine gemeinsame Entscheidung einigen. Dann darf der Fremde, der Klage führt, Geschworene benennen, ausgenommen seinen staatlichen Proxenos und seinen privaten Gastfreund, Männer von bestem Ruf, und zwar, wenn der Streitwert eine Mine oder mehr beträgt, fünfzehn, wenn weniger, neun an der Zahl. Der Proxenos wird ebenso wie der ausdrücklich von ihm unterschiedene private Gastfreund (Idióxenos) vom Verfahren ausgeschlossen, weil sie ja gebunden sind, in jedem Fall die Partei ihres Schutzbefohlenen zu vertreten, und somit als befangen gelten. Ein weiteres Gesetz auf derselben Tafel belegt den Proxenos, wenn er trügt (gemeint ist wohl kaum die Falschaussage zugunsten des Mandanten, sondern der Parteiverrat zu dessen Schaden), mit einer Buße in Höhe des zweifachen Streitwerts.
In Rom ist für Rechtsstreitigkeiten eines Römers mit Peregrini oder von Peregrini untereinander, das heißt mit Angehörigen solcher fremder Staaten, mit denen Rom entweder einen Rechtshilfevertrag geschlossen oder ihnen als Unterworfenen die faire Behandlung (fides) zugesagt hat, für das Grundlageverfahren (in iure) der Fremdenmagistrat (praetor peregrinus) zuständig.21 Hat er die Rechtsfrage beantwortet, geht der Fall zur Entscheidung an das Gericht der Recuperatores. In klassischer Zeit scheint der Fremde die Prozessfähigkeit vor dem Recuperatorengericht selbst besessen zu haben; doch blieb es üblich, dass es ein römischer Gastfreund als Patronus übernahm, seine Sache zu führen. Doch auch außerhalb Roms kann ein Römer die Rolle eines Gastfreundes übernehmen: Cornelius Gallus, der erste Statthalter Ägyptens, das zu einer dem Kaiser Augustus direkt unterstehenden Provinz geworden war, nennt sich in einer inschriftlichen Proklamation Proxenos des Königs von Äthiopien.22