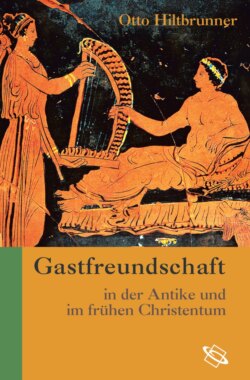Читать книгу Gastfreundschaft in der Antike und im frühen Christentum - Otto Hiltbrunner - Страница 6
Оглавление[Menü]
I. Grundhaltungen
1. Die Urangst vor dem Fremden
Die Begegnung mit dem Fremden ist eine Ausnahmesituation. Der Mensch ist von Anfang an auf die Gemeinschaft mit anderen Menschen angewiesen. Doch sie findet in geschlossenen Gruppen statt, deren Keimzelle die Familie ist. Damit diese über den Tod des Einzelnen hinaus fortlebt, bedarf es eines zweiten Menschen anderen Geschlechts. Das Kind ist schon sogleich nach seiner Geburt auf nährende Fürsorge und Pflege durch freundliche Menschenhände angewiesen, und von Menschen lernt der heranwachsende Mensch, was er zum Leben braucht. Mit Recht sagt Augustinus1: Die Grundlage für menschliches Leben wäre dahin, wenn es sich zeigte, dass es nicht Gottes Wille wäre, sein Wort dem Menschen durch Menschen mitzuteilen, und er alles, was nach seinem Wunsch den Menschen zu lernen aufgegeben wird, vom Himmel her durch Engel verkünden ließe. Innerhalb der Gruppe werden ebenso die für diese Gruppe spezifischen Verhaltensnormen entwickelt wie die Vorstellung von magisch-religiösen Mächten, die das Heil der Gemeinschaft bewirken. Doch dieser Gewähr für die Existenz bietende Schatz an Wissen und Glauben muss vor Störung gehütet werden. Wird die Abgeschirmtheit der Gruppe, beispielsweise durch Heirat mit Frauen aus einer anderen Gruppe, durchbrochen, dann darf dies nur geschehen unter besonderen Vorsichtsmaßregeln, die zur Integrierung des Fremden führen.
In noch dünn besiedelten Gebieten ist die Konfrontation mit einem Fremden ein seltenes und aufregendes Ereignis, auf das man reagieren muss. Zwei Entscheidungen sind möglich: entweder Philoxenie, das heißt dass im Unbekannten ein Stück artverwandten Wesens vermutet wird, zu dem man in friedlich-freundschaftliche Beziehung treten kann, oder aber Xenophobie, eine Angst, aufgrund deren man meint, einen gefährlichen Eindringling abwehren zu müssen. Schon in Rudeln des Tierreichs sind beide Möglichkeiten gegeben. Zuweilen wird ein vereinzeltes Jungtier angenommen, zumeist freilich wird der nicht zum Verbund gehörige Artgenosse abgewiesen. Menschen handeln differenzierter, es fließen vielerlei Überlegungen ein. Frauen aus Stämmen, deren Tüchtigkeit bekannt ist, werden sogar geraubt, weil man sich davon eine Steigerung der eigenen Qualitäten verspricht. Medizinmänner, Schmiede, Trommler und Musiker, Schamanen, alle, deren besondere Fertigkeiten der eigenen Gruppe Nutzen bringen, sind erwünscht. Vorsichtige Vorbehalte hat man gegenüber Händlern, Bettlern und Schutzflehenden. Denn der Fremde bringt seine eigenen magischen Potenzen mit; die lassen Befleckung, Verseuchung und Tod befürchten, nicht unberechtigt, wenn man beispielsweise an das schnelle Aussterben der einheimischen Bewohner der von Kolumbus entdeckten amerikanischen Inseln denkt. Ihnen fehlte die Immunabwehr gegen die von den Europäern mitgebrachten Krankheitserreger, an welche die Eindringlinge längst gewöhnt waren.
Von vornherein verdächtig ist der Fremde, der allein daherkommt. Hat er sich aus seiner doch ebenfalls geschlossenen Gruppe gelöst und sich auf den Weg in die Fremde, mit dem althochdeutschen Wort ins „Elend“ begeben, weil er verstoßen wurde, weil er sich mit einem Fluch beladen hatte? Wenn schon die Angehörigen seiner eigenen Gruppe ihn nicht unter sich dulden wollten, dann hat die Gruppe, zu der er unbekannt hinkommt, umso triftigeren Grund, seine Unheil bringende Berührung zu meiden. Er ist friedlos, da ihn das innerhalb seiner Herkunftsgruppe geltende Recht nicht mehr schützt, er aber als Außenstehender an den Rechten, die in der neuen Gruppe nur für deren eigene Angehörige gelten, keinen Anteil haben kann.
Die völlige Schutzlosigkeit des fremden Ankömmlings lässt die Entscheidung einfach erscheinen, solange man sich der eigenen Überlegenheit völlig sicher ist: Der Fremde wird getötet oder sonstwie eliminiert. Die Selbstgewissheit kann so groß sein, dass überhaupt nur Angehörige des eigenen Volkes als Menschen angesehen werden. So gilt das altägyptische Wort pirom (Mensch) nur für Ägypter. Doch es regen sich Zweifel. Man kennt die Kräfte nicht, die der Fremde verborgen mit sich trägt. Stehen ihm mächtige Geister bei, dann würden sie seine Tötung oder auch bloß schlechte Behandlung rächen. Der Schaden, den man abwenden will, würde die eigene Gemeinschaft also erst recht treffen. Wie, wenn der Unbekannte gar ein Gott wäre? Die Theoxenie, die Einkehr des Gottes bei den Menschen, ist ein uraltes in vielen Kulturkreisen verbreitetes Wandermotiv. Im Altnordischen ist Odin der unheimliche Wanderer, im Griechischen gibt Homer der Vorstellung Ausdruck in den Odysseeversen (17,485–487): Auch wohl Götter in der Gestalt von aus anderem Volke stammenden Fremden, vielfältig sich wandelnd, wandern oft umher durch die Stadtgemeinden hin und üben Aufsicht über Frevelmut und Wohlverhalten der Menschen. Alle diese Theoxenie-Erzählungen haben ein didaktisches Ziel: Warnung davor, die mit dem Fremden möglicherweise verbündete Macht zu verkennen, und Mahnung, ihn vorsichtshalber freundlich zu behandeln.
Doch die Gefühle, die bei der Ankunft des Fremden ausgelöst werden, bleiben zwiespältig, Das Sittengebot, in die religiöse Dimension erhoben durch den Glauben, dass ein oberster Gott – bei den Griechen Zeus – die Fremden schirmt, verlangt Achtung. Dennoch bleibt die Ehrerbietung, die man ihnen äußerlich erweist, innerlich verbunden mit der Angst vor der Ungewissheit, vor dem Unheimlichen. Sogar der Bettler, dessen Schwäche so offensichtlich ist, dass man ihn für harmlos halten darf, kann sich nicht allein auf den Beschützer Zeus berufen, er muss deutlich Zeichen seiner Unterordnung setzen. Der Flüchtling muss durch eine zeremonielle Reinigung von dem Fluch, den er mitbringt, entsühnt werden, bevor er im Haus bleiben darf.
Eine extreme Form der Distanzierung zeigt ein von Herodot (4,196) überlieferter Bericht karthagischer Kauffahrer über ihre Geschäfte an der von der Zivilisation des Mittelmeerraums unberührten Westküste Afrikas: Wenn sie bei ihnen ankommen und die Schiffsfracht ausgeladen haben, stellen sie die Ware in einer Reihe längs des Küstensaums hin, steigen wieder aufs Schiff und geben ein Rauchsignal. Wenn die Eingeborenen den Rauch sehen, kommen sie ans Meer, legen als Gegenwert für die Waren Gold hin und gehen wieder zurück von den Waren weg. Die Karthager steigen aus und schauen nach, und wenn ihnen das Gold dem Wert der Waren zu entsprechen scheint, nehmen sie es an sich und fahren davon, wenn aber nicht entsprechend, steigen sie wieder aufs Schiff und bleiben sitzen. Jene aber kommen herbei und bringen noch anderes Gold zu dem hinzu, das sie schon hingelegt hatten, so lange, bis sie die Händler überzeugen. Keine von beiden Seiten, sagen sie, erlaube sich ein Unrecht. Denn weder sie selber rührten etwas von dem Gold an, bevor der volle Gegenwert der Waren ausgeglichen war, noch rührten jene an die Waren, bevor die Händler das Gold genommen hätten. So wird jeder Personenkontakt vermieden.
Doch diese übersteigerte Vorsicht bleibt eine Ausnahme. Der Wille zur Kommunikation überwindet in aller Regel die Bedenken und Hemmungen. Mit dazu bei trägt eine natürliche Neugier. Man will von dem Ankömmling nicht nur erfahren, wer er ist, sondern auch, was er erlebt hat, was in der Welt draußen vorgeht, was dort anders ist. Der Vorsicht der Gastgeber muss das Verhalten des Ankommenden entsprechen. Will er unter dem Dach des ihn aufnehmenden gastlichen Hauses bleiben und in den Kreis der Hausbewohner aufgenommen werden, muss er Beweise dafür liefern, dass von seiner Seite nichts Böses zu befürchten steht. Die Frist, die Fremdheit gänzlich abzulegen, ist kurz bemessen. Zwei Tage Gast, vom dritten Tag an Hausgenosse ist ein altgermanischer Rechtssatz, der auch anderswo ähnlich befolgt wird und unter anderem bedeutet, dass der Neuaufgenommene nach zwei Tagen zu den täglich zu verrichtenden Arbeiten mit herangezogen wird. Wie alle anderen Hausgenossen unterstellt er sich dem Oberhaupt der Familie und dem Häuptling der Gruppe, fügt sich den hier geltenden Bräuchen und Gesetzen und verzichtet darauf, seinen eigenen Willen gegen seine Gastgeber geltend machen zu wollen. Entscheidend ist der Akt, mit dem der Ankömmling die Unterwerfung vollzieht. Symbolisch legt er seine Waffe nicht bloß nieder, sondern überreicht sie förmlich dem Gastgeber. Der wird dadurch zum Gastherrn. Die slawischen Sprachen haben mit ihrem Wort für „Herr“, gospod, den sprachlichen Ausdruck für das Verhältnis am reinsten bewahrt: gospod ist zusammengesetzt aus altbulgarisch gosti, das in germanischen Sprachen erscheint als gotisch gasts, altnordisch gestr, althochdeutsch gast. Ob das slawische Wort direkt als Erbwort aus dem Indoeuropäischen anzusehen sei oder als Entlehnung aus dem Germanischen, kann offen bleiben. Im Altlatein hat hostis noch die Bedeutung Gast. In der zweiten Silbe des slawischen gospod, -pod, steckt der Begriff der Macht und Herrschaftsgewalt, der sich in der Stammsilbe von lateinisch potestas und potentia wiederfindet, auch in lateinisch possum (ich kann), das aus potis sum (ich bin mächtig) zusammengezogen ist.
Dem Gastherrn steht es zu, die Geschenke des Gastes entgegenzunehmen. Er ist es, der die Riten vollzieht, mit denen ein Schuldbefleckter entsühnt wird, damit seine Nähe, seine Berührung, niemandem mehr schaden kann. Wenn dem Gast Hände und Füße gewaschen werden, bevor man sich mit ihm zum gemeinsamen Mahl niederlässt, ist das nicht bloß eine gebotene Erfrischung des Wanderers von den Mühen seines Weges, sondern zugleich ein Rest der rituellen Reinigungszeremonie. Das anschließende Gespräch, bei dem man Namen, Herkunft und Lebensumstände des Gastes erfährt, dient dazu, ihm seine Fremdheit zu nehmen. Die Stufen der Integration haben meist ihre streng geregelte Abfolge, von der nicht abgewichen wird. Höchster Grad in der Stufenleiter ist die Blutsbrüderschaft, durch die er zum Vollmitglied der aufnehmenden Gruppe wird.
Der Gastherr übernimmt die unbedingte Pflicht zum Schutz des Gastes. Solange dieser sich im Hause befindet, ist er unantastbar und muss gegen jeden Angreifer von außen verteidigt werden, eine höchst unangenehme Aufgabe dann, wenn der Ankömmling etwa von Bluträchern verfolgt wird. Im alten Orient geht der Schutz des Gastes sogar dem Schutz der eigenen Familienangehörigen vor. Stirbt der Gast, so ist der Gastherr zwar sein Erbe. Doch zugleich obliegt ihm die Pflicht, ihn an demjenigen zu rächen, der seinen Tod verschuldet hat. Begeht der Gast seinerseits gegenüber einem Außenstehenden ein Unrecht, fällt die Verantwortung auf den Gastherrn, genauso, als ob ein Familienangehöriger die Tat begangen hätte. Die Stellung des Gastgebers gegenüber seinem Gast entspricht somit weitgehend der Stellung des Familienoberhauptes gegenüber Frauen, Kindern und Gesinde.