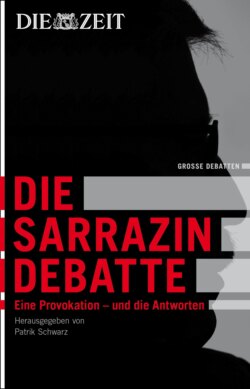Читать книгу Die Sarrazin-Debatte - Patrik Schwarz - Страница 14
»GENUG CHAOS FÜR BERLIN«, MARC BROST/THOMAS E. SCHMIDT
ОглавлениеMARC BROST/THOMAS E. SCHMIDT
2.8.2007
»GENUG CHAOS FÜR BERLIN«
Finanzsenator Thilo Sarrazin über die Schulden der Hauptstadt, die Absurditäten der Bahnreform und die rot-rote Option für den Bund
– DIE ZEIT: Herr Senator, lange galt Berlin als arm, aber sexy. Nun kommt die Stadt ohne neue Schulden aus. Wie erotisch ist es, reich zu sein?
Wir haben immer noch 60 Milliarden Euro Schulden, damit bezeichne ich uns nicht als reich. Berlin ist aus einer ungeordneten Armut in eine geordnete Armut übergegangen. Man kann ja arm sein und trotzdem seine Finanzen im Griff haben, dann kauft man sich eben alle zwei Tage einen Liter Milch. Oder man hat seine Finanzen nicht im Griff und kauft sich jeden Tag ein Sixpack Bier. Das sind so die Unterschiede.
– Für manche ist das Sixpack Bier attraktiver als der Liter Milch.
Nur beim ersten Mal. Zu viel Bier sorgt für einen dicken Kopf und macht einen Bauch.
– Aber die Frage ist doch, ob eine Stadt wie Berlin nicht über ihre Verhältnisse leben muss? London ist reich, Paris ist mondän, aber Berlin schwankt bis heute zwischen Aufbruch und Untergang.
Ich kann in Berlin so viel Ordnung schaffen, wie ich will, es wird immer noch genug Chaos übrig bleiben, um die Stadt interessant zu halten. Der normale Berliner ist nicht reich, der kämpft mit seiner Heizkostennachzahlung und überlegt, wie er sich den Urlaub zusammenspart. Er weiß, dass Mangel und Kargheit kompetent verwaltet werden müssen. Das erwartet er auch von der Politik. Gleichzeitig erwartet er von der Politik einen gewissen Glanz, den man immer von jenen erwartet, die einen repräsentieren. Und ich meine, das hat der Berliner Senat doch bisher ganz gut hinbekommen.
– Man sagt ihnen einen besonderen Hang zu Sekundärtugenden nach. Wann haben Sie die Sparsamkeit schätzen gelernt?
Was heißt Sparsamkeit? Ich habe 1990/91 eine ganze Reihe von Regelungen erfunden, die dafür verantwortlich waren, dass sich der Bund so maßlos verschuldete.
– Wie bitte?
Ich hatte damals im Finanzministerium die Fachaufsicht für die Treuhandanstalt. Ich wollte für den DDR-Nachlass keine Haushaltsmittel, sondern die Treuhand wie ein Unternehmen behandeln. Deswegen wurden ihre Defizite bis zu ihrer Auflösung 1994 nicht als Staatsverschuldung gebucht, sondern als Unternehmensschulden. Das war auch richtig, denn man musste die Sache zügig lösen. Mit der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums wäre das damals nicht möglich gewesen. Sie können sehen, wie die Staatsverschuldung von 1994 an dramatisch anstieg.
– Und die Hoffnung auf Privatisierungserlöse?
Das war alles Quark. Ich habe minimale Erlöse angesetzt. Im Februar 1991 hatte ich die weitere Entwicklung der Treuhand bis zum Jahr 2000 durchgerechnet. Für 2000 ergab sich ein Schuldenstand der Treuhand von 400 Milliarden Mark. Diese Vorlage schickte ich an Finanzminister Theo Waigel und sagte: So wird es kommen. Große Aufregung im Ministerium, die Vorlage wurde weggeschlossen. Als die Treuhand dann Ende 1994 aufgelöst wurde, betrug ihr Schuldenstand 200 Milliarden Mark. Das entsprach exakt meiner Prognose auf der Zeitachse.
– War das Ihre Ursünde, für die Sie jetzt, ganz sparsam, Abbitte leisten?
Nein, das war gezielt so gemacht. Damals war das politische Thema: Wie kriegen wir die Einheit hin? Es ging nicht ums Sparen. Wir sahen ja recht bald, dass es mit der Einheit schneller gehen würde als erwartet, wir standen unter Zeitdruck. Ich hatte zwar alles durchgerechnet, es war auch klar, dass der industrielle Sektor der DDR überdimensioniert war und dass das 1,6 Millionen zusätzliche Arbeitslose bedeuten würde. Aber den tatsächlichen Verrottungsgrad der Industrie konnte keiner voraussehen. Wir mussten die Sachen mit dem radikalstmöglichen Tempo abwickeln, sonst wären uns die ganzen maroden Betriebe zur Dauerlast gefallen. Ich will damit sagen, dass man immer gemäß der Logik der Situation handeln muss, dann aber konsequent.
– Was ist für einen Finanzpolitiker spannender: Geld auszugeben oder es zusammenzuhalten?
Das Füllhorn auszuschütten hat mich noch nie interessiert. Deswegen habe ich mich 1991, als es um die Integration der ostdeutschen Länder in die bundesdeutsche Finanzverfassung ging, auch dafür eingesetzt, die bisherigen Bundeszuschüsse für Berlin zügig abzubauen, um Mittel für den Aufbau Ost zu gewinnen. Berlin war im Vergleich zu Westdeutschland praktisch schuldenfrei, und nun sollten die mal alleine machen.
– Stattdessen stiegen die Schulden Berlins dramatisch an. Haben Sie nicht dazu beigetragen, indem Sie der Stadt die Subventionen wegnahmen?
Die Berliner Finanzpolitik hatte in der ersten Hälfte der neunziger Jahre nicht adäquat auf die Situation reagiert und einfach weiter Geld ausgegeben ohne Ende. Man kann das ganze Schuldendrama mit konkreten politischen Entscheidungen erklären. Es gibt zum Beispiel vier Fehlentscheidungen, die allein für rund die Hälfte des heutigen Schuldenstands verantwortlich sind: die wahnsinnige Berliner Wohnungsbauförderung; der Verzicht, sich von überflüssigem Personal im öffentlichen Dienst zu trennen – eine Möglichkeit übrigens, die der Einigungsvertrag eröffnet hatte; drittens die rasche Anhebung der Ostberliner Bezüge auf Westberliner Niveau und viertens das Desaster der Bankgesellschaft. Es ist eine Berliner Legende, dass das Geld in besonders schöne Maßnahmen geflossen ist. Ohne diese vier Fehlentscheidungen wäre der Berliner Schuldenstand heute durchaus verträglich. Die dramatische Neuverschuldung Anfang der neunziger Jahre war Ausdruck der damaligen Westberliner Unfähigkeit, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen.
– Woher kommt diese Unfähigkeit?
Die Berliner Finanzpolitik war vor dem Mauerfall auf ein bestimmtes Verhalten dressiert worden. Nach der Verabschiedung des Haushaltes pflegte früher der Finanzsenator mit einer Torte vor der Landespressekonferenz zu erscheinen. Die wurde beguckt und dann verteilt: das Stück an den, das an jenen. So war das. Nehmen Sie mal einen durchschnittlichen Potentaten irgendwo südlich der Sahara und nördlich von Kapstadt. Was muss der tun? Der muss Geld von der internationalen Gemeinschaft abzapfen und es im Land so verteilen, dass er an der Macht bleibt. Das funktioniert ganz simpel. Die Berliner kamen aus der Stammesgesellschaft und wurden in die Moderne geworfen.
– Jetzt sprudeln die Steuereinnahmen. Werden dadurch aufs Neue alte Begehrlichkeiten geweckt?
Als Prinzip ist der Schuldenabbau in der Öffentlichkeit Berlins akzeptiert. Das ist für die politisch Verantwortlichen bei SPD und Linken inzwischen eine Sache der Überzeugung. Die Altkader in der PDS sind tief davon geprägt, dass das Ende der DDR weniger durch die Straße eingeleitet wurde als durch den drohenden Staatsbankrott. Als wir Ende Februar 1990 zum ersten Mal in Ost-Berlin waren, gaben die uns ihre Zahlen, auf zwei schmucklosen Blättern: interne und externe Verschuldung. Dann blickten die uns erwartungsvoll an, und ich dachte: Das ist jetzt die Übergabe. Für die war die Sache durch. Die wussten, die würden das nie mehr raffen. Das prägt.
– Rot-Rot in Berlin ist akzeptiert, weil eine sparwillige SPD mit einer vernünftig handelnden PDS koalierte. Jetzt hat sich aber die Linke verändert, und mit Oskar Lafontaine zieht ein neuer Geist ein, der heftig gegen die Berliner Politik wettert. Ändert sich für Sie langsam die Geschäftsgrundlage des Regierens?
Nein, die Handelnden sind ja noch da. Außerdem kann ich mir nicht wünschen, ob eine Partei existiert oder nicht. Da muss man die Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen. Die Linke hat offenbar ein stabiles Potenzial von 10 bis 15 Prozent. Es war ja unnormal, dass wir in Deutschland nur eine linksdemokratische Partei hatten. Jetzt rechnen Sie sich aus, wie Mehrheiten zustande kommen sollen. Es ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass eine linke Mehrheit nur noch unter Beteiligung der Linkspartei zustande kommt.
– Rot-Rot ist für Sie im Bund eine Option?
Ich würde eher bezweifeln, dass die SPD auf Bundesebene programmatische Gemeinsamkeiten mit der Linken hat. Wenn sich 2013 die Konstellation ergibt, wird man verhandeln müssen und sehen, wer welchen Preis für die Machtbeteiligung zahlt.
– Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit propagiert Rot-Rot schon heute als realistische Option für den Bund und stellt sich damit gegen SPD-Chef Kurt Beck.
Für Kurt Beck ist die Sache unangenehm, weil er für die Eindämmung der Linken sorgen muss. Er steht am Oderdeich und muss in atemloser Hast Sandsäcke auffüllen, damit das Wasser nicht durchbricht. Wowereit steht währenddessen auf dem Binnendeich und fragt, was passiert, wenn das Wasser durchgebrochen ist. Das sind zwei unterschiedliche Rollen, und man kann nicht sagen, die eine ist richtig und die andere falsch.
– Was würde Wowereit denn dazu befähigen, die SPD in eine Bundestagswahl zu führen?
Diese Frage stellt sich frühestens im Jahre 2013, denn im Jahr 2009 wird entweder Kurt Beck oder Frank-Walter Steinmeier die SPD in den Bundestagswahlkampf führen. Und ich bin sicher, dass wir dann wieder in der Regierung sein werden.
– In den Achtzigern haben Sie im Bundesfinanzministerium das Referat für die Bundesbeteiligungen an Post und Bahn geleitet. Später waren Sie Vorstand bei der Netztochter der Bahn. Was läuft falsch bei der Privatisierung? Worüber haben Sie sich bei Ihrem Parteifreund Steinbrück beschwert?
Das Schienennetz ist eine staatliche Aufgabe, anders als der Betrieb der Bahn muss es darum auch in staatlicher Hand bleiben. Außerdem bedeutet der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf zur Bahnprivatisierung für den Bund ein Verlustgeschäft. Das lässt sich leicht errechnen: Der Verkauf von 49 Prozent der Bahnanteile könnte circa acht Millionen Euro erbringen. Die Hälfte davon soll für die Stärkung des Bahnkapitals verwendet werden, bleiben rund vier Milliarden Euro für den Bundeshaushalt. Das Schienennetz soll dabei in die Bilanz der Bahn übergehen. Wenn der Bund nun nach 15 Jahren seine Rückholoption nutzen will, wird er für das Schienennetz rund acht Milliarden Euro an Wertausgleich zahlen müssen. Das sind vier Milliarden Euro mehr, als er durch die Privatisierung vorher einnimmt. Das ist absurd und kommt einer Verschleuderung von öffentlichem Vermögen gleich.
Das Gespräch führten Marc Brost und Thomas E. Schmidt.