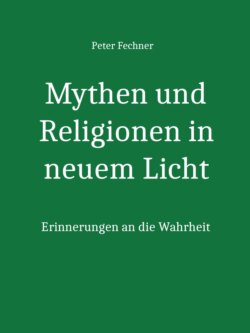Читать книгу Mythen und Religionen in neuem Licht - Peter Fechner - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Beweise zu den Überlieferungen
ОглавлениеGesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, beispielsweise durch archäologische Funde, gibt es über die Königin von Saba leider nicht. Ein Königreich von Saba lässt sich erst ab des 8. Jahrhunderts v. Chr. in Südarabien nachweisen. Hier hat man bei Marib im heutigen Jemen eine Tempelanlage ausgegraben, die zwar bei einigen als Kultstätte der Königin von Saba gilt, jedoch offenbar einer Verehrung der Mondgottheit „Almaqa“ diente und erst zweihundert Jahre nach dem Auftreten der Königin von Saba angelegt wurde. Im Übrigen hat es bisher nur sehr spärliche archäologische Ausgrabungen in Südarabien gegeben, da Expeditionen dorthin bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts entweder verboten waren oder als zu gefährlich betrachtet wurden.
Und in Äthiopien wurde früher gar nicht nach baulichen Überresten der Königin von Saba geforscht, da man sie als arabische Königin betrachtete und nicht glauben wollte, dass sie eigentlich aus Äthiopien stammte. Ruinenreste in Aksum wurden zwar von Äthiopiern als „Palast der Königin von Saba“ bezeichnet, doch stammen sie aus späterer Zeit, als wieder der alte Götterkult mit Verehrung von Sonne und Mond in Äthiopien und Arabien vorherrschte. Deshalb könnte auch die nunmehr bedeutungslos gewordene Bundeslade tatsächlich von einigen Juden auf einer abgelegenen Insel im Tana-See in Sicherheit gebracht worden sein, wo sie achthundert Jahre lang weitgehend unbeachtet verblieb, bis sie wieder mit Einführung des Christentums nach Aksum geholt wurde und zu alten Ehren kam. Die neuesten archäologischen Forschungen am „Palast der Königin von Saba“ haben aber immerhin ergeben, dass die ursprünglichen Fundamente aus dem 10. Jahrhundert v. Chr. stammen, also tatsächlich aus der Zeit der Königin von Saba.
Über die Königin von Saba erfährt man nur etwas Genaueres durch die von Jakoub Adol Mar wiedergegebenen äthiopischen Überlieferungen. Tatsächlich dürfte er als äußerst sachkundiger Berichterstatter der Wahrheit über die Königin von Saba und den König Salomo am nächsten kommen, wenn es auch schwer fällt, ein endgültiges Urteil zu bilden. Jakoub Adol Mar war – wie seine Enkelin Makeda Ketcham mitteilte – der Sohn eines deutschen lutherischen Missionars und einer äthiopischen Prinzessin, studierte in Europa, war Bürgermeister in Addis Abbeba, dann Ratgeber von Kaiser Menelik und Kaiserin Zauditu. 1922 wurde er zum Konsul Äthiopiens in Brüssel ernannt. Er hielt eine romanhafte Darstellung für die geeignete Form, sein Wissen über die Königin von Saba und den König Salomo der Welt zugänglich zu machen und ein altes Kulturerbe der Nachwelt zu erhalten.
Das unvollendete Manuskript – geschrieben in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts – wurde erst 1997 von seiner Enkelin veröffentlicht. (Seine über 2000seitige wissenschaftliche Abhandlung für die Kaiser, in deren Auftrag er die Überlieferungen über die Königin von Saba in Äthiopien gesammelt und kritisch ausgewertet hat, ist verschollen.) Jakoub Adol Mar bestätigte in einem Vorwort seines Manuskriptes, dass der Text weitgehend auf Tatsachen beruht, die durch Überlieferungen belegt sind. Dennoch sind nach so langer Zeit Fragezeichen berechtigt. Man kann nicht ausschließen, dass bei den Überlieferungen – ähnlich wie beim Alten Testament – manches falsch berichtet oder etwas hinzugedichtet wurde.
Mit dem Thema „Äthiopien und die Bundeslade“ hat sich auch ausgiebig der Schriftsteller Graham Hancock beschäftigt und das Ergebnis seiner Recherchen in dem Buch „Die Wächter des heiligen Siegels“ (2) geschildert. Er stellt fest, dass offensichtlich die Templer im 12. Jahrhundert über den Verbleib der Bundeslade Bescheid wussten, obwohl die Bibel gar keine Auskunft hierüber gibt. Es spricht viel dafür, dass französische Tempelritter in Jerusalem dort, wo der Tempel Salomos gestanden hatte, gleich nach Gründung des Ordens ganz gezielt Nachforschungen nach geheimen Gängen durchführten. Sie sind dabei zwar nicht – wie wohl erhofft – auf die versteckte Bundeslade gestoßen, dafür aber auf andere wertvolle Tempelschätze und alte, geheime Schriften der jüdischen Priester, die vielleicht auch Auskunft über den Verbleib der Bundeslade gegeben haben könnten.
Außerdem waren häufig christliche Abgesandte aus Äthiopien in Jerusalem – auch ein vertriebener äthiopischer Prinz, der spätere König Lalibela und Erbauer der berühmten, einmaligen Felsenkirchen in Äthiopien, hielt sich im 12. Jahrhundert dort auf. Das erlaubt es anzunehmen, dass die Tempelritter über die äthiopischen Überlieferungen gut informiert waren. Wahrscheinlich haben sie dem Prinzen Lalibela geholfen, König von Äthiopien zu werden, und wahrscheinlich haben sie auch beim Bau der Felsenkirchen in Lalibela mitgeholfen und die Bundeslade in Äthiopien mit eigenen Augen gesehen. Denn historische Berichte nennen „weiße Männer mit blonden Haaren“ als Erbauer der Felsenkirchen und als Träger der Lade zur Zeit des Königs Lalibela. Die berühmte St. Georg-Kirche ist in Form eines gleichschenkligen Kreuzes – dem Zeichen der Tempelritter – aus dem Felsen gehauen worden! Außerdem ist bei dieser Kirche von oben deutlich das „Kreuz im Kreuz“ zu sehen, das auch ein typisches Zeichen des Christusordens wurde, der in Portugal direkter Nachfolger des Ordens der Tempelritter war, als dieser vom Papst und dem französischen König wegen „Ketzerei“ vernichtet wurde. Zudem hatte Graham Hancock auch das typische „Tatzenkreuz“ der Tempelritter in Aksum und Lalibela entdeckt. Nach seinen weiteren Erkundungen vor Ort in Äthiopien ist sich Graham Hancock schließlich sicher, dass die Bundeslade tatsächlich einst nach Äthiopien gelangt war.
Hat sich hier südlich von Ägypten ein Kreis geschlossen? Gemäß einem Seherbericht (4), der im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Gralsbotschaft (5) entstanden ist, lebte hier im 13. Jahrhundert v. Chr. Abd-ru-shin als Fürst eines vorbildlichen Arabervolkes. Er verkündete hier die Gebote Gottes, die dann nochmals auch dem Moses, der Abd-ru-shin im Sudan aufgesucht hatte, am Berg Sinai mitgeteilt wurden, und die von Abd-ru-shin im 20. Jahrhundert bei seiner erneuten Inkarnation noch einmal eingehend erläutert wurden. Es sieht so aus, als ob die Bundeslade in dieser Region Afrikas, im Bereich Sudan/Äthiopien, wo die Verkündung der Gebote ihren Anfang nahm, tatsächlich ihre „letzte Ruhestätte“ finden und als Beweisstück für göttliches Wirken erhalten bleiben sollte.
Literatur/Quellen:
Jakoub Adol Mar, Makeda, Königin von Saba, Heyne Verlag, München 1998 (1)
Graham Hancock, Die Wächter des heiligen Siegels, Lübbe Verlag, Berg. Gladbach 1992 (2)
Rolf Beyer, Die Königin von Saba, Lübbe Verlag, Berg. Gladbach 1987 (3)
o. Vf., Aus verklungenen Jahrtausenden, Verlag der Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 1997 (4)
Abd-ru-shin, Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft, Verlag der Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart 2004 (5)