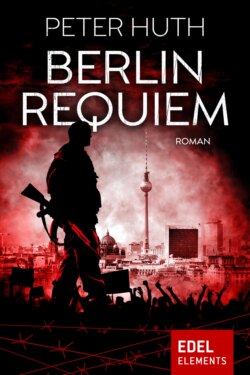Читать книгу Berlin Requiem - Peter Huth - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDie Schüsse, die Sarah hört, werden aus einem SG-550-Präzisionsgewehr abgefeuert, Schweizer Fabrikat. Mike Fegin stellt das Gewehr neben sich ab. Er spuckt auf den Boden. Der junge Polizist sieht sich zu Polizeihauptmeister Karsten Seiks um, Schichtführer des Berliner PSK, des Präzisionsschützenkommandos.
»Das war’s. Gut gemacht, Junge«, sagt Seiks.
Fegin nickt, greift zum Feldstecher und betrachtet sein Opfer aus der Nähe. Die Leiche liegt genau auf der roten Linie, die exakt hundert Meter vor der Mauer auf den Boden gemalt ist.
Fegin holt ein Aufnahmegerät hervor. »Männlich, etwa fünfunddreißig Jahre alt. Schwarze Haare, Bartträger. Offensichtlich Migrationshintergrund ...«
»Was auch sonst, Junge?«, unterbricht ihn Seiks.
Mit träger Beamtenstimme spricht Fegin weiter auf den Rekorder.
»Der erste Schuss wurde um 5:38 Uhr abgegeben, als sich das Subjekt langsam auf die Demarkationslinie innerhalb der Kontrollierten Zone zubewegte und auf mehrmalige Warnrufe nicht reagierte. Das Projektil traf gezielt das rechte Bein, trat wieder aus. Mobilität sollte final unterbunden werden. Das Subjekt bewegte sich dennoch kriechend weiter in Richtung der D-Linie. Der nach Rücksprache mit PHM Seiks abgegebene Schuss traf die Stirn im seitlichen Bereich. Durch den Austrittsdruck wurde der größte Teil des Schädels zerstört. Das Subjekt wurde somit in seiner Vorwärtsbewegung gestoppt und endgültig eliminiert.«
»Genau so, mein Junge.«
Seiks zieht sich die schwarze Sturmmaske, die zur Standardausrüstung des PSK gehört, vom Kopf und klopft Fegin auf die Schulter.
»Noch drei Stunden, dann haben wir es für heute geschafft.«
Die beiden Männer sind seit neun Stunden auf dem provisorischen Wachturm, schon den siebzehnten Tag in Folge. Jeder von ihnen beobachtet die Häuserflucht der Oranienstraße für genau sechzig Minuten durch das Zielfernrohr, dann wechseln sie sich ab, wie es Vorschrift ist. Die Person, die Fegin vor wenigen Minuten ausgeschaltet hat, wird unter der Ziffer 364 dokumentiert werden. Fünfundzwanzig davon hat Fegin getötet, achtzehn Seiks, alle von diesem Wachturm aus. Die übrigen Todesschüsse wurden von den anderen Schichten sowie an den Kontrollstationen Oberbaumbrücke, Mehringdamm Süd und von der Bahnlinie aus abgegeben. Insgesamt sind mehr als hundertfünfzig Beamte des PSK im Einsatz. Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, dass die Infizierten die rote Linie überqueren, sich der Mauer also auf weniger als hundert Meter nähern.
Fegin lehnt sich mit dem Rücken gegen die Brüstung und blickt auf den anderen Teil der Stadt, den Teil, »den es mit allen Mitteln zu verteidigen gilt«, wie es in der Dienstweisung Nr. 64/80907743/a heißt.
Wenn er nach Hause kommt, wird ihn Sabine fragen, wie die aktuelle Lage ist, so wie jeden Tag, wenn er müde am Küchentisch sitzt. Seine Hand wird sie nehmen und erzählen, was sie in den Nachrichten gesehen hat, was dieser und jener Experte gesagt hat. Die kleine Falte auf ihrer Stirn wird größer werden, das ist Sabines Sorgengesicht. Vor den Kindern kann sie es verstecken. Vor ihm nicht. Sie wird sagen: »Du musst es doch wissen.«
Er weiß, was er sieht: Die Toten laufen.
Zu Sabine sagt er jeden Abend: »Mach dir keine Sorgen, wir haben alles im Griff.«
Aber er hat Angst. So wie Seiks, so wie alle anderen auch. Letzte Woche ist ein Reporter auf einen der Türme geklettert und hat mit seiner verfluchten Kamera ein Video gedreht, das jetzt rund um die Uhr im Fernsehen zu sehen ist. Polizeihauptmeister Fegin denkt: Wenn ein Journalist einen der Türme stürmen kann, dann können es die Toten von der anderen Seite vielleicht auch.
Noch sind sie langsam. Leichte Beute.
Fegin wendet sich seinem Kollegen zu.
»Was, wenn sie schneller werden?«
Seiks liegt in vorbildlicher Körperspannung über der Brüstung, das Gewehr aufgesetzt auf den mit Granulat gefüllten Sandsack, das rechte Auge nur Millimeter vor dem Zielfernrohr. Der rote Laserpunkt liegt genau in der Mitte der Oranienburger Straße. Drei Autos, ein Opel und zwei BMW, stehen auf der Fahrbahn, die Türen offen. Die Leuchtreklamen der Dönerbuden und Restaurants flackern, wie immer, bei Tag und bei Nacht. In seinem Blickfeld taumeln insgesamt acht Personen ziellos umher. Zwei Frauen laufen aufeinander zu. Die beiden verfehlen sich um Zentimeter, vielleicht berühren sie sich auch, das kann man bei dem schwankenden Gang kaum erkennen, aber sie nehmen voneinander keine Notiz. Träge stolpern sie weiter, jede für sich.
»Diese Dinger? Warum sollten sie schneller werden?«
Fegin lacht. »Und vor vier Wochen? Wenn dir da einer gesagt hätte, dass die Toten überhaupt laufen können? Was hättest du da gesagt?«
Seiks zuckt mit den Schultern.
»Ich hätte ihn für verrückt erklärt, Kleiner.«
Um acht Uhr ist es fast taghell. Auf dem Oranienplatz hinter dem Turm nehmen die Bautrupps wieder ihre Arbeit auf. Die Mauer, die sie errichteten, besteht aus drei Meter hohen und einen Meter breiten Betonfertigteilen. Es musste schnell gehen vor zwei Wochen, noch klaffen gefährliche Lücken. Eine zweite Verteidigungslinie soll vor der ersten Mauer errichtet werden, dann werden die Türme genau dazwischen stehen, in einem neuen Todesstreifen.
Insgesamt gibt es entlang der Absperrung fünfunddreißig Wachtürme. Wo Gebäude den Übergang zur Kontrollierten Zone markieren, sind die Fenster meist noch provisorisch mit Holz verrammelt, doch die Maurer kommen gut voran. Spätestens Ende des Monats, so der Plan, ist die Zone komplett versiegelt. Das größte Problem ist der Bahndamm im Süden, wo eine Strecke von acht Kilometern abgeriegelt werden muss; am einfachsten ist es im Osten, wo die Spree eine natürliche Barriere bildet. Die Toten können nicht schwimmen. Zumindest haben sie es noch nicht versucht.
All das hat Fegin Sabine gestern Abend erzählt und sich dabei Mühe gegeben, optimistisch zu klingen. Mauern, Wachtürme, die Kontrollierte Zone, die Demarkationslinie ... Gute Worte, Polizeiworte. So ein Scheißdreck.
Dann war das Essen fertig gewesen, und sie hatten sich an den Tisch gesetzt. Es gab Knacker und Kartoffelsalat. Für die Kinder waren die hart gekochten Eier mit Tomatenhälften und Mayonnaisetupfern wie Fliegenpilze zurechtgemacht.
Sabine glaubt, dass so etwas hilft. Julie ist drei, Max acht.
Der Fernseher lief, Spongebob in seiner lustigen Unterwasserwelt. Spongebob verliebte sich in eine Hamsterfrau, die auf dem Meeresboden unter einer Käseglocke lebte. Als Spongebob sie besuchte, musste er sich entscheiden: Liebe oder Leben. Der kleine Kerl gab sich alle Mühe, doch er vertrocknete bei lebendigem Leib, wurde faltiger, fasriger, dünner. Rote Blutadernstriche in seine Augen. Spongebob kotzte. Spongebob musste dringend raus aus der Sauerstoff-Käseglocke. Er war jetzt nur noch ein staubig-gelbes Ding.
Julie fragte: »Geht Sponschbob tot?«
Max schaute nicht vom Fernseher auf.
»In der Schule hat Melvin gesagt, dass wir es nicht kriegen können. Das Schlimme.«
Ja, genau, dachte Fegin. So ist es, mein Sohn.
Sabine aber reagierte, wie Mütter reagieren.
»Max, wen meinst du denn mit wir?«
»Na, uns. Die, die es nicht kriegen. Die, die keine Türken sind oder Araber.«
Richtig wütend wurde Sabine. Als wenn Max »Scheiße« gesagt hätte oder »Neger«.
»Das weiß man alles noch gar nicht. Und es ist nicht richtig, ›Türken‹ zu sagen, Max.«
Was für ein Schwachsinn! Warum durfte man denn jetzt nicht mehr »Türken« sagen?
»Papa, aber es stimmt doch, dass wir es nicht kriegen können, oder?«
Er sah seinen Sohn an, den dünnen Jungen mit seinen Sommersprossen und dem blonden Scheitel. Ein Kind, das von seinem Vater hören wollte, dass alles gut sei.
Ist doch so, oder, Papa?
Julie heulte, sie wollte wissen, ob Spongebob stirbt.
»Nein, Max, wir kriegen es nicht. Nur die.«
Sabine stampfte aus dem Zimmer, jetzt auch wütend auf ihn, aber das war es ihm wert. Als er später ins Bett ging, waren ihre Augen geschlossen, aber er wusste, dass sie noch wach war. Und natürlich konnte auch er nicht einschlafen. So hatten sie noch lange nebeneinander gelegen und sich ohne Worte angelogen.
»Da kommen welche.« Seiks reißt Fegin aus seinen Gedanken. Er zeigt in Richtung Kottbusser Tor. Drei Männer – oder das, was von ihnen übrig geblieben ist – schleppen sich die Oranienstraße entlang. Schwarze Lederjacken, gebleichte Jeans, diese fetten Nikes, von denen ein Paar locker 200 Euro kostet. Einer von ihnen ist widerlich fett. Fegin kennt solche Typen, solche Gangs. In ihren tiefergelegten, lächerlich aufgemotzten BMW. Die fremde Musik, kreischend aus den Riesenboxen im Kofferraum. Diese Typen sind die schlimmsten, ganz und gar unerträglich. Fegin denkt: Die benehmen sich so, als ob die Stadt ihnen gehören würde. Genau wie die grinsenden Gemüsehändler, die kichernden Kopftuchmädchen – geschminkte Lippen, billige Stilettos – und deren Mütter – Kinderwagen schiebend und keifend –, zwei Meter hinter ihren Männern, die rauchen, den ganzen Tag, und sich dann in ihre Teestuben verziehen, an denen draußen ein Schild hängt, auf dem auf Türkisch steht, dass er, Fegin, hier nichts zu suchen habe.
Dieser Blick: Was willst du, Alter?
Komm doch her, Alter.
Fegin legt an. Sieht die Männer im Zielfernrohr ganz nah. Sehr nah. Fegin betätigt den Abzug.
Sein erstes Opfer torkelt.
Ein schneller zweiter Schuss hebt den nächsten von den Beinen.
»Um Himmels willen, Fegin! Was soll die Scheiße? Was machst du denn da?«
Schuss Nummer drei trifft den Fetten, ins Bein.
Er kriecht weiter. Sie kriechen immer weiter. Das ist, was ihn so verrückt macht.
Drei Kopfschüsse, schnell abgefeuert, machen der Sache ein Ende.
»Kannst du mir bitte erklären, was das soll? Sie einfach so über den Haufen zu schießen?«
Seiks’ Stimme zittert. Aber Mike Fegin kennt seinen Partner lange genug, um zu wissen, dass da nicht nur Wut ist. Sondern etwas anderes: Erregung.
Fegins Stimme bleibt ruhig: »Sag mir einen Grund, warum ich warten sollte, bis die Arschlöcher bis zur Linie gerobbt sind. Einen einzigen, Seiks. Wenn du mich fragst: Je eher wir sie fertigmachen, desto besser.«
Weit hinten schälen sich weitere Silhouetten aus dem Schatten der Wohnhäuser. Auf der Straße ein leichter Nebel. Fegin lädt sein Gewehr nach, packt sich zwei Munitionstaschen und steht auf. Er geht zur Brüstung und sieht nach unten. Ein schneller Blick zu Seiks. Der nickt. Mike Fegin springt.
»Wie du meinst, Kleiner«, sagt Karsten Seiks und legt an.