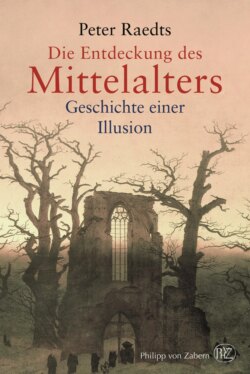Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 Erste Erkundung Petrarca am Abgrund
ОглавлениеAm 8. April 1341, einem Ostersonntag, wurde der Poet Francesco Petrarca vom Vorsitzenden des römischen Senats, Orso dell’Anguillara, auf dem Kapitol in Rom mit einem Lorbeerkranz zum Dichter gekrönt. In seiner Dankesrede verkündete Petrarca, diese Feierlichkeit sei darum so besonders, als sie an „etwas aus legendären Zeiten erinnert, was schon seit über zwölfhundert Jahren außer Gebrauch geraten ist, denn der letzte, von dem wir lesen, dass er diese Ehrung empfangen hat, war der berühmte Dichter Statius, der zur Zeit Domitians gelebt hat“.1 Publius Papinius Statius (um 45–96) wurde vor allem durch seine Heldengedichte Thebais und Achilleis bekannt. Im späten Mittelalter und in der Renaissance zählte er zu den angesehensten römischen Autoren.
Bei der Betrachtung seiner eigenen Zeit und der unmittelbaren Vergangenheit sah Petrarca einen tiefen, dunklen Abgrund, der sich über gut 1000 Jahre erstreckte, eine hoffnungslose Zeit, die nur „Narrenkünstler“ hervorgebracht hatte. Als der Laureat noch weiter zurückblickte, sah er in der fernen, fast legendären Vergangenheit eine Epoche, „die für Dichter glücklicher war, weil sie damals in hohem Ansehen standen, zuerst in Griechenland, später in Italien, dort vor allem unter Kaiser Cäsar Augustus, denn während seiner Regierung gediehen brillante Dichter: Vergil, Varius, Ovid, Horaz und viele andere“.2 Das war die goldene Zeit der klassischen Literatur, der jeder kultivierte Mann seine Aufmerksamkeit widmen sollte, um sie wieder zu Ehren zu bringen. Die jüngere Vergangenheit könnte man hingegen ruhigen Gewissens der Vergessenheit anheimgeben.
Hiermit fasste Petrarca eine ganz neue Haltung gegenüber der Vergangenheit in Worte. Bis dahin hatte man die Vergangenheit immer als ein großes, undifferenziertes Ganzes gesehen, in dem alles zueinander in Beziehung stand und alles zusammenpasste. Alle Zeiten waren gleich wichtig und jede Zeit leistete auf ihre Weise ihren Beitrag zum Heilsplan Gottes für die Menschheit, der von der Erschaffung der Welt bis zum Jüngsten Gericht reichte. Es war Aufgabe der Historiker zu zeigen, wie sich dieser Heilsplan entwickelte und wie Gottes leitende Hand in jedem Zeitalter von neuem sichtbar wurde. In dieser Vergangenheit gab es kein Näher und kein Ferner oder Epochen, mit denen man sich mehr oder eben weniger verwandt fühlte. Alles war gleich alt, gleich weit weg und zugleich nicht wirklich anders als das Heute, weil die Menschen immer und überall gleich sind. Darum existierte auch kein Bedürfnis, alte Dinge zu erhalten oder zu betrachten, es sei denn, sie besaßen einen religiösen oder einen anderen Wert. Ihr Alter war jedenfalls kein Grund.
Mit Petrarca begann sich das zu ändern. Zunächst einmal interessierte sich Petrarca nur wenig für Geschichte als dem Bericht von Gottes Handeln gegenüber der Menschheit, auch wenn er ein gläubiger Christ war. Viel wichtiger war, dass er die Vergangenheit untergliederte und in ihr eine Perspektive schuf.3 Nicht alle Zeiten waren demnach gleich, sondern einige sind denkwürdiger gewesen als andere. Dunkle Zeiten wie die 1000 Jahre seit dem Untergang Roms – das heißt seit dem Fall des Weströmischen Reiches im Jahre 476 – könne man demnach ruhig vergessen; andere, wie die klassische Antike, sollten wieder in Erinnerung gerufen und zu neuem Leben erweckt werden. Petrarca war einer der ersten, dem bewusst wurde, dass sich Gegenwart und Vergangenheit voneinander unterscheiden können, und dass ein Abgrund zwischen der eigenen Zeit und der klassischen Antike gähnte. Genau deswegen war er der erste, der dazu aufrief, zur verlorenen Zeit der Antike zurückzukehren.
Diesen Standpunkt gegenüber der Vergangenheit beschrieb Petrarca am schönsten in einem Brief an den Franziskaner Giovanni Colonna. Mit diesem guten Freund hatte er 1341 einen Spaziergang durch Rom unternommen, als er sich anlässlich seiner Ehrung in der Stadt aufhielt. Mit jedem Schritt, den sie taten, erinnerten sie sich an eine Episode aus der Geschichte des alten Roms: die Höhle, in der die Wölfin Romulus und Remus gesäugt hatte; der Ort, an dem Cäsar seinen Triumphzug gehalten hatte; die Engelsburg, die ursprünglich das Mausoleum für Kaiser Hadrian gewesen war. Auf ihrer Wanderung kamen sie auch an christlichen Monumenten vorbei, allerdings waren das nur wenige. Petrarca war nämlich auf der Suche nach dem anderen Rom, der verlorenen Stadt, von der nur noch Ruinen zeugten. Als sie ermüdet vom langen Spaziergang auf dem Dach der ehemaligen Diokletiansthermen Rast machten, erläuterte Petrarca seinem Freund, dass die Geschichte Roms aus zwei unterschiedlichen Schichten bestünde: der modernen Zeit, für die sich Colonna besonders interessierte, und der Antike, für die Petrarca schwärmte. Und unter „Antike“ verstand Petrarca „alles, was stattgefunden hat, bevor Christi Name in Rom von den römischen Kaisern gepriesen und angebetet wurde“. So groß sei der Verfall gewesen, dem Rom seit langem ausgesetzt war, dass sogar die Bürger der Stadt nichts mehr vom Ruhm des alten Roms wüssten. Erst müsste ihnen bewusst werden, wie großartig diese Vergangenheit gewesen war, damit wieder Hoffnung auf eine Wiederauferstehung Roms aufkeimen könnte.4
Nach Petrarcas Meinung hatte Roms Verfall schon sehr früh eingesetzt. In einem seiner Gedichte ruft der römische Held Scipio Africanus aus, dass er nicht mehr über Roms Geschichte reden will, seit die Kaiser nicht länger echte Römer sind, sondern Spanier und Afrikaner. Zum ersten Mal geschah dies im Jahre 98 mit der Thronbesteigung des Spaniers Trajan, die für Petrarca das Ende der klassischen römischen Kultur bedeutete.5 Besonders spottete er über Fürsten aus noch späterer Zeit, die glaubten, Nachfolger der römischen Kaiser zu sein. Als er 1333 Aachen besuchte, betrachtete er mit eigenen Augen das Grab Kaiser Karls, eines Mannes, „der die Barbarenvölker noch immer mit Angst und Schrecken erfüllt“ und völlig zu Unrecht den Namen „der Große“ trug, als ob er mit Pompeius oder Alexander auf einer Stufe stünde.6 Auch wenn Karl der Große und seine Nachfolger den Kaisertitel besaßen, mit dem Glanz des alten Roms hätte das alles wenig zu tun: Sie waren nur Barbaren, die sich völlig zu Unrecht für die Erben Roms hielten.
In dieser Frage können wir Petrarca mit seinem Landsmann Dante Alighieri vergleichen, der knapp 40 Jahre vorher in der Abhandlung Die Monarchie ebenfalls seine Ansichten über das Römische Reich erläutert hatte. Auch Dante war fasziniert von Roms Ansehen und Macht. Die Tatsache, dass Christus in dem Moment geboren wurde, in dem Kaiser Augustus die ganze Welt unter seiner Herrschaft vereinigt hatte, war für Dante der beste Beweis dafür, dass es schon immer Gottes Willen gewesen war, der gesamten Welt unter der Alleinherrschaft der römischen Kaiser Einheit und Frieden zu schenken.7 Für Dante existierte dieses Reich noch immer, und zwar in demselben Glanz und mit denselben Zielen wie zu seiner Gründung. Die zeitgenössischen Kaiser, wie Heinrich VII. von Luxemburg und Ludwig der Bayer, hätten dieselbe Aufgabe wie Augustus und seien ihm ebenbürtig. Auch Petrarca musste zugeben, dass immer noch so etwas wie ein Römisches Reich existierte und dass es noch einen Deutschen gab, der sich Kaiser nannte. Doch in seinen Augen war das Reich geschwächt und praktisch aufgezehrt von den Barbaren, denen es in die Hände gefallen war.8 Das echte Rom existiere längst nicht mehr. Wo Dante ungestörte Kontinuität sah, eröffnete sich für Petrarca ein tiefer Abgrund zwischen Rom und der Gegenwart, und er konnte nur auf eine Wiederbelebung hoffen.
Im Gegensatz zu allen vorangegangenen Generationen, und auch zu Dante, glaubte Petrarca, die Wiedergeburt von Zivilisation und Glück sei hier auf Erden möglich, so dass die Menschen nicht bis nach ihrem Tod im Himmel darauf warten müssten. In dieser Hinsicht war er pessimistischer als die späteren Humanisten, die überzeugt waren, dass Rom durch ihr Dazutun in Ehren wiederauferstanden sei. Er fand, die Welt seiner Tage befinde sich in einem Zustand finsterster Unwissenheit und Barbarei, dürfe allerdings auf glücklichere Zeiten hoffen. Nur müsste zuvor noch eine Menge passieren. Bevor eine Wiedergeburt möglich wäre, müssten die Römer erst selbst ihre eigene Vergangenheit wieder kennenlernen.
An erster Stelle wollte Petrarca eine Wiederbelebung der wahren Kultur, träumte jedoch auch von einer politischen Wiedergeburt. Aus seinen Schriften geht nicht klar hervor, welche Form diese politische Erneuerung annehmen sollte. Hierüber hat er in Briefen an Papst Urban V., Kaiser Karl IV. und Cola di Rienzo geschrieben, drei sehr verschiedenartige Personen mit völlig unterschiedlichen Ansichten und Idealen. Beim Papst plädierte er für eine schnelle Rückkehr des päpstlichen Hofes aus Avignon nach Rom, um so die Grundvoraussetzung für ein neues goldenes Zeitalter zu schaffen.9 Den Kaiser rief er dazu auf, Deutschland zu vergessen und so schnell wie möglich nach Italien zu kommen, um in die Fußstapfen des Augustus zu treten. Bezeichnenderweise leitete er seine Hoffnung auf Karl nicht davon ab, dass dieser das Amt des Kaisers bekleidete, sondern von seiner energischen Persönlichkeit und seiner Erziehung als Kind in Italien.10 Der Brief an Cola di Rienzo ist besonders interessant, weil er an einen Mann geschrieben wurde, der nicht nur von der Vergangenheit träumte, sondern 1347 auch einen ernsthaften Versuch unternahm, die römische Republik wiederherzustellen. Petrarca unterstützte ihn bedingungslos und pries ihn als den Mann, der Italien wieder groß machen und allen Skeptikern zeigen könnte, was auch jetzt noch in Rom stecke.11
Petrarca wollte die Wiederherstellung Roms als politischen Mittelpunkt Europas und richtete sich an alle, die ihn dabei unterstützen konnten, ob dies nun der Papst war, der Kaiser oder sogar ein ungebärdiger Idealist wie Cola di Rienzo. Darüber hinaus sollte im Anschluss an Roms Wiederaufbau auch das italienische Vaterland neu erblühen. Diese beiden Dinge gehörten für Petrarca eindeutig zusammen. Es war mit Rom abwärtsgegangen, seit die Kaiser nicht länger Italiener waren. Petrarca hielt Karl IV. für fähig, Rom wieder groß zu machen, weil er eine italienische Erziehung genossen hatte und man ihn deshalb nicht als ausländischen Herrscher bezeichnen konnte: „Selbst wenn die Deutschen Euch für sich beanspruchen, wir betrachten Euch als Italiener.“12 Auch in dieser Hinsicht schlug Petrarca neue Töne an. Seine Sorge galt nicht länger der universellen Christenheit, wie dies noch bei Dante der Fall gewesen war, sondern nur einem kleinen Teil davon: dem italienischen Vaterland. Hier zeigt sich zum ersten Mal so etwas wie ein patriotisches Gefühl, das im späteren Humanismus, und vor allem in dessen Geschichtsauffassung, gewaltigen Einfluss ausgeübt hat.
Petrarca ist einer der Begründer dieser neuen Geschichtsauffassung. Seiner Meinung nach wurde das Drama der Geschichte nicht länger von Gott geschrieben, sondern von den Menschen selbst, und zugleich wurden die Epochen der Geschichte nicht länger von Gottes Eingreifen, wie Jesu Geburt, bestimmt, sondern von den Handlungen der Menschen. Demzufolge sah Petrarca im klassischen Rom bis zur Regierung Trajans ein goldenes Zeitalter und anschließend eine Periode der Finsternis, die bis in seine eigene Zeit reichte. Doch er gewahrte Licht am Horizont, auch wenn er nicht richtig erklärte, woher dieses Licht kommen sollte. Zum ersten Mal erkennt man hier die Umrisse einer Dreiteilung der Geschichte in alt, mittel und neu, die seit der Renaissance bis heute die Grundlage der europäischen Geschichtsschreibung bildet.13 Petrarca erläuterte diese Dreiteilung sogar, als er in einem seiner gereimten Briefe seiner Hoffnung auf Wiedererneuerung Ausdruck verlieh: „Es gab eine glücklichere Zeit und irgendwann wird wieder eine kommen. Doch in der Mitte, in unserer Zeit, sieht man, wie Niedrigkeit und Schmutz verschmolzen sind.“14
Hier geschah noch etwas anderes, was sich für die Bewertung der Zeit zwischen Roms Untergang und der Wiederbelebung der antiken Kultur als wesentlich erweisen sollte: Die Mitte wurde von Petrarca gleichgesetzt mit Finsternis und Schmutz, eine Assoziation, die sich so tief ins kollektive Gedächtnis Europas eingeprägt hat, dass sie durch alle späteren Jahrhunderte hindurch bis heute in hohem Maße unseren Blick auf die mittlere Periode bestimmt. Obwohl man sich später, vor allem in der Romantik, bemüht hat, die mittlere Periode zwischen Rom und Renaissance neu zu bewerten, ist Petrarcas Urteil noch immer fest in unser Gedächtnis eingebrannt: Das Mittelalter ist finster, schmutzig und barbarisch.
Die Auffassungen Petrarcas über den Lauf der Geschichte haben die späteren italienischen Humanisten aufgegriffen. Auch sie verherrlichten das alte Rom und sahen in der Zeit danach nur tiefe Finsternis. Allerdings waren sie viel optimistischer in Bezug auf ihre eigene Epoche, überall sahen sie Anzeichen von Erneuerung. Giovanni Boccaccio schrieb 1372 in einem Brief an Jacopo delle Pizinghe, man erkenne an Dantes und Petrarcas Poesie, dass die Musen aus ihrer Verbannung nach Italien zurückgekehrt seien. Petrarcas Dichterkrönung im Jahr 1341 interpretierte er als den Beginn dieser neuen Blütezeit und zögerte nicht, in diesem Zusammenhang Vergils berühmte vierte Ecloga zu zitieren. Darin prophezeite dieser, die Stunde sei nahe, in der „das Kind geboren wird, vor dem das Geschlecht aus Eisen verschwindet und überall das goldene Geschlecht entsteht“.15 Traditionell hatte man dieses Gedicht immer als einen Verweis auf Christi Geburt interpretiert.
Wie sehr sich die Geschichtsauffassung Boccaccios und die der Humanisten verschob, zeigt sich daran, dass nicht länger die Geburt des Heilands die neue Zeit einläutete, sondern Petrarcas Erneuerung der klassischen Antike. Im 15. Jahrhundert verstärkte sich dieses Vertrauen sogar noch, vor allem als man 1421 in Lodi ein Manuskript mit drei bislang unbekannten Werken Ciceros entdeckte, der unter allen lateinischen Autoren der Antike allgemein als der beste Stilist galt. Großen Einfluss hatte auch der Zustrom griechischer Gelehrter und griechischer Handschriften aus Konstantinopel, nachdem die Stadt 1453 den Türken in die Hände gefallen war.16 Es schien tatsächlich so, als würde die Antike im Italien des 15. Jahrhunderts wiederauferstehen.
In einem Punkt waren die späteren Humanisten zurückhaltender als Petrarca. Den politischen Aspekten der neuen Zeit widmeten sie nämlich kaum Beachtung. Ein Autor wie Leonardo Bruni sah noch einen gewissen Zusammenhang zwischen der Blüte der Literatur und der politischen Freiheit, wie sie in der römischen Republik geherrscht hatte, aber in diesem Punkt fanden seine Ideen wenig Resonanz. Alle Erwartungen einer politischen Wiedergeburt Italiens lösten sich endgültig in Luft auf, als der französische König Karl VIII. 1494 auf der Halbinsel einmarschierte und dort die politische Landkarte gründlich neu ordnete, sehr zum Nachteil der kollegial regierten Stadtstaaten, doch zugunsten fürstlicher Regierungsformen. Selbst Florenz, das Zentrum der antiken Wiedergeburt, verwandelte sich im Laufe des 16. Jahrhunderts von einer von Patriziern gelenkten Stadt in ein Großherzogtum unter der straffen Führung der Medici. Niccolò Machiavelli war der letzte Humanist, der sich dem Strom der Zeit entgegenstemmte und in der Istorie Fiorentine (1520–1525) aufrief, jeden fremden Einfluss aus Italien zu vertreiben. Nach ihm wurde es still: Die Wiederherstellung der republikanischen Freiheit und die Vereinigung aller italienischen Regionen war eine Vision, die in Italien erst im 19. Jahrhundert wieder aufkommen sollte.17 Von der Bewegung der Renaissance blieb lediglich der kulturelle Aspekt übrig, die Wiedergeburt der antiken Literatur und Kunst. In dieser Form gelangte die Renaissance nach Nordeuropa.