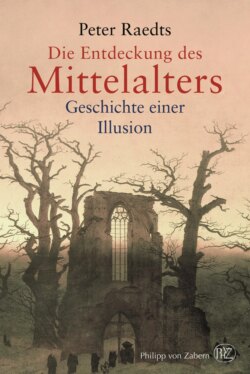Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ist das Mittelalter anders?
ОглавлениеUm solche Brücken zu bauen, ist es zunächst nötig, den Abgrund, der überbrückt werden soll, auszuloten. Aus zwei Gründen ist aus dem Mittelalter, mehr als aus jeder anderen Epoche unserer Vergangenheit, ein fremdes Land geworden. Wie oft gesagt wurde, aber nicht oft genug wiederholt werden kann, besteht die erste und größte Hürde darin, dass wir auch jetzt noch – nach den Worten des Mittelniederlandisten Wim Gerritsen – im Schlagschatten des Deiches leben, den die Humanisten zwischen dem Mittelalter und der Zeit danach aufgeworfen haben. Gemeint ist der Mythos des Mittelalters als Nicht-Kultur.26 Trotz der Romantik und der ganzen aus ihr hervorgegangenen Verklärung des Mittelalters, trotz des Endes aller großen Geschichten, gibt es eine große Geschichte über die Entstehung Europas, die jede Dekonstruktion überlebt hat, nämlich dass die Menschheit nach dem Fall Roms 1000 Jahre lang in Finsternis umhergeirrt ist, bis die Humanisten die Lampe der antiken Zivilisation wieder angezündet haben. Mit dieser und anderen ebenso tödlichen Metaphern bleibt das Mittelalter das Gegenstück zur Moderne, eine Zeit mit einer Kultur, die anthropologisch gesehen zwar interessant ist, an die wir im Grunde aber kaum Gedanken verschwenden müssen.27 Die Humanisten haben das Mittelalter aus der Erzählung der westlichen Zivilisation gestrichen und das konnte nie ganz ungeschehen gemacht werden.
Obwohl die jüngere Generation unserer Kulturträger kaum noch in den altklassischen Sprachen unterrichtet wurde, herrscht weiterhin die unterschwellige Überzeugung, dass man die moderne westliche Kultur ohne die Antike nicht verstehen kann, weshalb die Antike im Rahmen moderner Probleme und Entwicklungen ganz selbstverständlich immer wieder zur Sprache kommt. Schließlich liegt dort das Fundament der politischen Demokratie, dort liegen die Ursprünge der Philosophie und des Christentums, aber auch des Humanismus, dort liegen die Grundlagen des modernen Rechtsstaates und des modernen Erziehungssystems. Bei ihren Überlegungen zur Zukunft des Hochschulunterrichts in den Vereinigten Staaten fängt die liberale Philosophin Martha Nussbaum mit Sokrates und der Stoa an und schließt mit Seneca, ohne irgendwie näher auf die durchaus legitime Frage einzugehen, warum gut 2000 Jahre alte Aussagen zur Erziehung auch jetzt noch Gültigkeit besitzen sollen.28 In einer jüngeren populärwissenschaftlichen Geschichte der Philosophie wird das Mittelalter nach 300 Seiten über die Antike in 40 Seiten abgehandelt, eingeleitet mit der Bemerkung: „Weil Zeit und Platz beschränkt sind, lassen wir die mittelalterliche Philosophie lieber weiter in ihrem nachweislich dunklen und zweifellos dornigen Gestrüpp schlummern.“29
Dies gilt anscheinend auch für Juristen. In den letzten 20 Jahren sind an den juristischen Fakultäten der Niederlande im Zuge der vielen Bildungsreformen alle Seminare zum Thema Altvaterländisches (mittelalterliches) Recht aus dem Kerncurriculum verschwunden, doch Seminare zum Thema Römisches Recht sind noch überall verpflichtend. Plato und Aristoteles gelten in weiten Kreisen als Zeitgenossen und Gesprächspartner, während Thomas von Aquin und Marsilius von Padua nur noch Namen sind, die man ausschließlich in einem esoterischen Kreis hochspezialisierter Fachleute kennt und schätzt. Das Mittelalter ist also nicht fremd geworden, weil es so lange zurückliegt, sondern weil es einfach nicht ins Selbstverständnis und in die Geschichte der modernen westlichen Kultur passt.
Die sowieso schon prekäre Stellung des Mittelalters in der kollektiven Erinnerung des Westens wird noch durch den großen Einfluss verstärkt, den die kulturelle Anthropologie nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Ausübung der Geschichte gewonnen hat. Weil gerade die mittelalterliche Gesellschaft in vieler Hinsicht an die meist nichtwestlichen Kulturen erinnert, die weiterhin bevorzugte Studienobjekte der Anthropologen sind, erzielten deren Methoden unter den Mediävisten großen Erfolg, haben jedoch auch dazu beigetragen, das Mittelalter in eine noch exotischere Ferne zu rücken.
Dabei gibt es durchaus gute Gründe, die Anwendung von Modellen aus der kulturellen Anthropologie in der Geschichte zu begrüßen. In mancher Hinsicht haben sie den Historikern des Mittelalters geholfen, eine allzu simple Identifizierung mit der mittelalterlichen Vergangenheit, zu der sie unter dem Einfluss gewisser Vorstellungen aus der Romantik neigten, zu entlarven. Bahnbrechend war hier das Werk von Marc Bloch, der bereits 1924 aufgezeigt hat, dass die Autorität mittelalterlicher Könige weniger auf ihrer Armee oder auf ihrer Verwaltung beruhte, als vielmehr auf ihrem Ruf als Wundertäter, weshalb sich die Forschung zu den Herrschaftsformen im Mittelalter nicht irgendwelcher rechtshistorischer Konstruktionen bedienen sollte, sondern zunächst die Sakralität des Königsamtes untersuchen müsse.30
Anthropologische Erkenntnisse über die Machtausübung und Legitimation der Macht lieferten auch einen wesentlichen Beitrag zur Demaskierung des Ritters als Beschützer der Armen und Wehrlosen oder des Mythos der feudalen Treue und des mittelalterlichen Landesherrn als väterlichem Schirmherr aller ihm anvertrauten Bauern. In einem erschütternden Buch, das alle romantischen Vorstellungen vom Mittelalter zerpflückt, zeigt der amerikanische Mediävist Thomas Bisson, dass das Aufkommen der Ritterklasse im 10. und 11. Jahrhundert zu einer so erbarmungslos habgierigen Kultur führte, dass selbst heutige Topmanager noch viel davon lernen könnten. Die Bauern wurden Opfer eines Systems, das ganz auf effiziente Betriebsführung und wirtschaftlichen Gewinn ausgerichtet war und in dem menschliche Skrupel als Zeichen von Schwäche galten. Die Burgen, die ab 950 alle Dörfer überragten, sollten die Dorfbewohner nicht beschützen, sondern sie in Schach halten und zu möglichst hohen Produktionszahlen aufpeitschen. Das neue Europa wurde in einer Orgie der Gewalt und Gesetzlosigkeit geboren, die erst im 13. Jahrhundert ein Ende nahm, als wieder eine Art zentrale Obrigkeit entstand, die Adel und Ritterschaft besser unter Kontrolle bekam.31
Die Anthropologen haben auch dazu beigetragen, die mittelalterliche Geschichte zu entchristianisieren, indem sie darauf hinwiesen, dass die Kirche im Mittelalter keine Institution war, die das Leben der Gläubigen bis ins letzte Detail geregelt hat, wie die Kirchen dies – mit beachtlichem Erfolg – im 19. Jahrhundert geschafft haben, sondern dass damals viele Formen von Religiosität und religiöser Bindung nebeneinander existiert haben. Wenn man überhaupt von einem Ganzen sprechen konnte, muss es zumindest chaotisch und absolut widersprüchlich gewesen sein.32 Das hat sogar zu der Frage geführt, ob man überhaupt von einem „christlichen Mittelalter“ sprechen kann. So verkündete Jean Delumeau vor über 30 Jahren, dass die eigentliche Christianisierung Europas erst im 16. Jahrhundert stattgefunden habe, als Reformatoren und Gegenreformatoren eine Überzeugungsoffensive entfesselten, durch die der Inhalt der christlichen Botschaft bis in den letzten Winkel Europas vordringen konnte.33
Auffallend ist jedoch, dass unter Historikern vor allem diejenige Richtung in der Anthropologie populär wurde, die sich auf die Beschreibung kleiner Gemeinschaften und Randerscheinungen spezialisiert.34 Diesen Ansatz charakterisieren zwei Punkte. Erstens versucht der Historiker nicht länger nach größeren sinnstiftenden Zusammenhängen in der Geschichte zu suchen, stattdessen konzentriert er sich lieber auf kleine Ereignisse in winzigen Gemeinschaften: etwa auf die Verehrung eines heiligen Windhundes, die religiösen Ansichten eines italienischen Müllers oder die Rückkehr eines verloren geglaubten Bauern, ohne dabei die Schicksale dieser Menschen in einen größeren sozialen und politischen Kontext zu stellen oder auch nur daraufhin zu untersuchen, ob sie repräsentativ für ein größeres Ganzes sind.35
Zweitens fällt auf, dass bei solchen Rekonstruktionen davon ausgegangen wird, dass zwischen unserer Kultur und der ihren ein Abgrund klafft, den nur die Übersetzungsarbeit des Historikers überbrücken kann. Man sucht nicht nach möglichen Übereinstimmungen oder einer zumindest teilweisen Überlappung der Erfahrungswelt. Das Seltsame und Exotische ist der selbstverständliche Ausgangspunkt und wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum sich diese Bücher wie warme Semmeln verkaufen, schließlich ist der Markt für Eskapismus gewaltig.36 Dadurch ist in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, was Trevor-Roper 1967 – vielleicht zum letzten Mal – noch mutig als „dämlichen Unsinn eines bäuerlichen Aberglaubens“ bezeichnet hat.37 Eigentlich wird nie die Frage gestellt, welchen Nutzen man aus solchen Erkenntnissen ziehen soll, außer dass sie vielleicht Material liefern, um am Wochenende Touristen mit neofolkloristischen Festen anzulocken. Außerdem schält sich immer deutlicher heraus, dass solche marginalen Gemeinschaften oder Erscheinungen für die mittelalterliche Gesellschaft als Ganzes längst nicht so charakteristisch waren und dass sie nur den Eindruck erwecken, uns einen privilegierten Einblick in das Leben einfacher Menschen zu bieten. Genau das, was der moderne Mensch heute daran so seltsam findet, hat man anscheinend auch damals oft schon seltsam gefunden. Van Engen weist sogar darauf hin, dass die Erforschung des Alltagslebens der einfachen Leute im Mittelalter eigentlich noch gar nicht angefangen hat.38
Wie schließlich noch betont werden muss, berufen sich die Historiker ganz zu Unrecht auf die Anthropologie als solche, wenn sie sagen, dass die einzige Art und Weise, andere Kulturen zu rekonstruieren, darin bestehe, sie als seltsam und exotisch zu beschreiben. Unter Anthropologen gibt es schon seit 100 Jahren eine heftige Diskussion darüber, ob der Unterschied zwischen zwei Kulturen tatsächlich so grundlegend ist, dass ein Anthropologe eine andere Kultur erst nach mühsamer Interpretation verstehen könne, oder dass er im Gegenteil davon ausgehen müsse, dass es letztendlich eine gemeinschaftliche Basis an gesundem Menschenverstand, Rationalität und Gefühlsleben gebe, die allen Kulturen eigen ist.39
Mit der Anthropologie gibt es jedoch noch ein anderes Problem. Erst in den letzten Jahren zeigt sich immer deutlicher, dass die Mediävisten durch ihre Entscheidung für einen anthropologischeren Ansatz nicht den Klauen der Ideologie entronnen sind und sich endlich einer reinen Wissenschaft zugewandt haben. Anscheinend haben auch Anthropologen verborgene Agenden. Zur Zeit tritt nämlich die interessante Erscheinung auf, dass diejenigen, die seit Generationen nur Studienobjekte der westlichen Wissenschaft waren, nun selbst den Mund aufmachen und ihre Meinung zu dem äußern, was sie unserer Ansicht nach immer dachten.
Die Lawine wurde von Edward Said durch sein immer noch umstrittenes Standardwerk Orientalism aus dem Jahre 1978 losgetreten. Darin zeigt der Autor, dass praktisch alle Wissenschaften, die sich mit nichtwestlichen Kulturen beschäftigen, eine verborgene Agenda besitzen. Was auf den ersten Blick nach einem neutralen, kritischen Ansatz aussieht, erweist sich bei näherer Betrachtung als Gemeinplatz, der darauf abzielt, durch einen Vergleich mit den östlichen Nichtkulturen die Überlegenheit der westlichen Kultur zu bestätigen und so unterschiedliche Machtverhältnisse zu schaffen und aufrechtzuerhalten.40 Der Ausgangspunkt für jede wissenschaftliche Abhandlung über nichtwestliche, fremde Kulturen ist, nach Saids Meinung, dass „diese Menschen“ außerstande seien, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen zusammenhängend und vernünftig zu formulieren, weswegen ein westlicher Wissenschaftler das für sie tun müsse. Said zitiert in diesem Zusammenhang einen Ausspruch von Karl Marx: „Sie können nicht für sich selbst sprechen, es muss für sie gesprochen werden.“ Mit anderen Worten: Sie liefern das Material, wir schreiben das Drehbuch.41 Talal Asad nennt dies in seinem Buch Genealogies of Religion den Jago-Komplex der europäischen Kultur, die Fähigkeit, alles und jeden nach Bedarf zu formen und für die eigenen Ziele zu benutzen.42
Asad erklärt auch, wie das in der Anthropologie oft vor sich geht. Der Anthropologe reist zu einem Eingeborenenstamm auf Samoa, Bali oder einer anderen Insel. Hier pickt er sich mehrere Gebräuche und Rituale heraus, zwischen denen der Einheimische keinen Zusammenhang vermutet, im Gegensatz zum Anthropologen. Letzterer erklärt dann, dass alles, was auf den ersten Blick nach einer Reihe unzusammenhängender Handlungen aussieht, tatsächlich Teil eines komplizierten Netzes an Bedeutungen ist, die zusammen das bilden, was wir Kultur nennen. Der Anthropologe ist der alles sehende, alles wissende Beobachter, der viel besser als die Einheimischen selbst die Bedeutung ihrer Handlungen ergründen kann. Indem er sie untersucht, erlangt er Macht über sie.43 Viele Begriffspaare, die bei der Erforschung fremder Kulturen bevorzugt verwendet werden und die man zur Zeit auch in der Geschichtsschreibung gerne als Beschreibungs- und Erklärungsmodelle einsetzt, finden ihren Ursprung offenbar in dieser Fachsprache.44 Die bekanntesten sind: magisch – religiös, irrational – rational, assoziativ – kausal, oral – schriftlich, ritualistisch – ethisch, kollektiv – individuell, zügellos – diszipliniert, volkstümlich – elitär, kindhaft – erwachsen. Vor allem die radikalen Veränderungen im 12. Jahrhundert werden meistens in der Terminologie dieser Begriffspaare erklärt.45
Das klassische Beispiel für den von Asad abgelehnten Ansatz in der mittelalterlichen Geschichtsforschung ist Emmanuel Le Roy Laduries Buch über die Sitten und Gebräuche des Katharerdorfes Montaillou. Darin führt der Autor seine Leser meisterhaft durch dieses abgelegene Dorf in den Pyrenäen. Jeder Aspekt im Alltagsleben der Dorfbewohner wird besprochen, ihre geheimsten Gedanken werden offengelegt, und noch viel besser als der Inquisitor Jacques Fournier aus dessen Aufzeichnungen er sein Material entnommen hat, bekommt Le Roy Ladurie das Dorf so in den Griff, dass ihm nichts und niemand entrinnen kann. Er weiß, was die Bauern wirklich beschäftigt, und kennt ihre verborgensten Phantasien und Träume.46 Auf den ersten Blick lässt Le Roy Ladurie anscheinend eine Bevölkerungsgruppe zu Worte kommen, die gewöhnlich zum Schweigen verdammt ist: Die einfachen Leute, die so oft aus der Geschichtsschreibung verschwinden, denen der moderne französische Historiker aber nun das Wort erteilt. In einer Kritik der Arbeit von Geertz erklärt Asad hierzu, dass „Wissen über die lokale Bevölkerung nicht dasselbe ist wie lokales Wissen“.47
In praktisch allen Werken über Folklore, Volksreligiosität und Feste im Mittelalter wird diese Form von Besserwisserei angewandt. Wenn Miri Rubin in ihrem Buch über die Verehrung des Heiligen Sakraments im späten Mittelalter die Bedeutung der Sakramentsprozession behandelt, vermag sie uns zu erzählen, dass die Menschen zwar dachten, mit ihrem feierlichen Umzug durch die Stadt Christus in seinem Sakrament zu ehren, obwohl sie tatsächlich ein Ritual vollzogen, das die Machtverhältnisse innerhalb der Stadt widerspiegelte und zugleich legitimierte. Die Prozession war eigentlich eine „Ikonographie der Macht“.48
Mit dem Erfolg der Anthropologie drang fast unmerklich auch ihre Ausdrucksweise in die Geschichtsschreibung über das Mittelalter ein. So entstand der merkwürdige Kontrast, dass in einer Zeit, in der die Anthropologen zunehmend die Voreingenommenheit ihrer Ausdrucksweise erkennen und sich bemühen, ihr Fach zu entkolonisieren, die Historiker das Mittelalter unbekümmert kolonisieren und auf den Status einer nichtwestlichen, fremden Gesellschaft reduzieren. Damit ist die Mediävistik wieder an dem Punkt angelangt, an dem die Humanisten angefangen haben: Die eigene Zivilisation verherrlichen, indem man sie von der Barbarei der vorangegangenen Jahrhunderte abhebt. Was der Anthropologe im Raum tut, macht der Mediävist in der Zeit: kein geographischer, sondern ein chronologischer Orientalismus.49
Die Welt, die in Abhandlungen wie der oben genannten heraufbeschworen wird, steht zwar im vollkommenen Gegensatz zu unserer Welt, doch in mancher Hinsicht kann das ein ästhetisches Vergnügen sein, es kann sogar eine Art Heimweh nach Zeiten wecken, in denen die Menschen direkter, einfacher und ungezügelter waren: der mittelalterliche Mensch als edler Wilder. Vor allem amerikanische Mediävisten haben in den vergangenen 20 Jahren unermüdlich versucht, das völlige Anderssein des Mittelalters zum interessantesten und relevantesten Aspekt dieser Epoche zu machen. Wenn der moderne Mensch die Konfrontation mit dem völligen Anderssein des Mittelalters sucht, wäre er besser in der Lage zu erkennen, was in der eigenen Kultur verdrängt und ausgegrenzt wird. Zugleich könne er so die Machtmechanismen, die in der modernen westlichen Kultur die Erinnerung bestimmten, besser erkennen.50 Dies ist an sich nicht unrichtig, doch es ist nicht genug. Auf diese Weise bleibt das Mittelalter schließlich die Zeit, von der wir nichts lernen können, die uns nichts zu sagen hat und die uns keinen Stoff für eine Reflexion über die Herausforderungen liefert, vor denen die Gesellschaft heute steht. Eine solche Beschäftigung mit Geschichte erhält so in einer Zeit, die sich gerade von der postmodernen Ironie und Distanziertheit distanziert, etwas Frivoles und sogar Irritierendes. Anders gesagt: Die Strategie des modernen Menschen, das Andere, das Nichtmoderne im Mittelalter anzusiedeln, um dadurch die eigene Identität schärfer in den Blick zu bekommen, funktioniert nicht mehr.51
Bedeutet dies, dass nun die Stunde der reinen Wissenschaft geschlagen hat?52 Nein, diese Stunde hat schon vor 200 Jahren geschlagen. Seitdem lehrt uns die Erfahrung, dass wissenschaftlicher Scharfsinn entbehrlich ist, wenn es darum geht, ein lebendiges Band zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu knüpfen. Darüber hinaus lehrt die Erfahrung, dass selbst Historiker trotz ihres kritischen Verstandes nicht gegen große mitreißende Geschichten gefeit sind, die nicht immer einer kritischen Prüfung standhalten. Und in manchen Fällen – hier drängen sich die Namen Edward Gibbon, Jules Michelet und Jacob Burckhardt auf – haben sie diese Geschichten selbst geschrieben. Das Beste, was man von der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung erwarten kann – und das ist eine Menge und durchaus wichtig –, ist, dass sie all diese dummen Interpretationen der Vergangenheit korrigiert, entlarvt und durch eine schlichtere Version ersetzt.53 Ungefähr so wie Theologen allzu verrückte Formen der Marienverehrung oder eines biblischen Fundamentalismus an den Pranger stellen und hoffen, dass ihre Kritik zu einer zurückhaltenderen Frömmigkeit der Gläubigen führt.
Dieser Vergleich mit der Theologie geschieht nicht zufällig. Geschichte ist ein Fach mit lebensanschaulichen Aspekten: Die Menschen suchen in der Vergangenheit nach Sinn, Bedeutung, Zusammenhang und Deutungen, was bedeutet, dass man Geschichten erzählen muss, Geschichten, die manchmal von Historikern, meistens aber von anderen geschrieben werden. Der große, mit Blick auf die Greuel des 20. Jahrhunderts jedoch verständliche Irrtum der Postmodernisten besteht in der Annahme, dass Fragmente von Wissen, die keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit, Allgemeingültigkeit oder gar Wahrheit erheben, ausreichen, dem Leben einen Sinn zu geben.
Die Menschen brauchen große Geschichten, sie fühlen sich betrogen, wenn man durch die vielen täglichen widersprüchlichen und chaotischen Erfahrungen nicht irgendwie einen roten Faden ziehen kann. Das zeigt sich auch wieder in den letzten Jahren; erklärende Geschichten über „die“ Vergangenheit, um „die“ Gegenwart zu verstehen, tauchen allenthalben auf. Die häufigste Form solcher vereinfachenden Geschichten sind Verschwörungstheorien, die alles Unglück der Welt den Machenschaften einer einzigen Gruppe zuschreiben. Früher waren das die Juden oder der Kapitalismus, jetzt sind es die islamistischen Fundamentalisten. Doch auch die plötzliche Angst vor dem Multikulturalismus mit der daraus entspringenden Popularität der Geschichte der Aufklärung als jener Zeit, in der die universellen menschlichen Werte, die für alle Zeiten und alle Kulturen gelten, zum ersten Mal formuliert wurden, verweist darauf, dass die Menschen nicht ohne große Geschichten leben können.
Die existierenden Geschichten über das Mittelalter sind überholt, im Gegensatz zu denen über die Antike. Wenn die mittelalterliche Vergangenheit bei der Reflexion Europas über seine eigene Kultur noch eine Rolle spielen soll, müssen wir versuchen, das Mittelalter innerhalb der weiter gefassten Geschichte der westlichen Kultur wieder zur Sprache zu bringen, damit diese Epoche neben der Antike ihren Platz als eines der beiden Fundamente erhält, auf denen sich die heutige westliche Kultur gründet.
Schon Ende des 16. Jahrhunderts zeigte sich zum ersten Mal, dass antike Autoren nicht länger alle Fragen beantworten konnten. In den Werken Herodots und aller anderen antiken Geographen kam Amerika nicht vor. Kopernikus und Galilei hatten bewiesen, dass sich die Erde um die Sonne dreht und damit die antike Kosmologie ins Reich der Fabeln verwiesen. Und ob die antike Literatur wirklich immer als Vorbild für jede spätere Poesie und Prosa dienen soll, erschien auch immer fraglicher. Über diese Fragen entbrannte ein Streit, der dem Monopol des klassischen Altertums als Inspiration und Vorbild für jede spätere Literatur und Wissenschaft ein Ende bereitete. Von dieser Zeit an wurde versucht, das Mittelalter neben der Antike in die Geschichte der westlichen Kultur aufzunehmen, meistens als Gegensatz zur Antike. Ende des 19. Jahrhunderts gab es zwei große Betrachtungsweisen der europäischen Vergangenheit, die gleichwertig nebeneinanderstanden, die klassizistische und die gotische, beide mit eigenen Assoziationen (und nicht zu vergessen mit ihrer eigenen Architektur), die aber gemeinsam Europas Vergangenheit umfassten. Beide Begriffe bezeichneten um 1900 viel mehr als nur bestimmte, fest umschriebene historische Zeitalter. Sie repräsentierten eine ganze Palette an philosophischen, politischen und gesellschaftlichen Ansichten und hatten sich zu Symbolen einer Lebensanschauung entwickelt.
Durch den Vergleich und die Konfrontation der Antike mit dem Mittelalter führten Generationen von Europäern heftige Debatten über wesentliche Fragen, die sie im Moment beschäftigten, zum Beispiel über das Verhältnis zwischen Vernunft und Gefühl, über Kosmopolitismus und Nationalismus, über Individuum und Gemeinschaft, Universalität und Partikularismus, Tradition und Moderne. Konflikte, die nirgends schöner charakterisiert wurden als in der Debatte zwischen dem Humanisten Settembrini und dem Jesuiten Naphta in Der Zauberberg von Thomas Mann. Natürlich war die Verwendung von Geschichte in diesen Debatten in hohem Maße mythisch, doch die Frage ist, ob nicht jede Verwendung von Geschichte, die über das Antiquarische hinausgeht, mythische Züge enthält und allein in dieser Form für eine heutige Debatte relevant sein kann. Mythen sind lebensgefährlich, wie die jüngere Vergangenheit bewiesen hat, doch Walter Benjamin meinte, dass jemand, der sich dieser Gefahren bewusst ist, den Mythos weiter als Mittel zur Deutung des Leben heranziehen kann.54
Bevor wir über Möglichkeiten nachdenken, dem Mittelalter wieder einen Platz in der Geschichte Europas einzuräumen, ist es darum dienlich, in allen Einzelheiten zu verfolgen, wie das in den vergangenen Jahrhunderten geschehen ist, was das Mittelalter früher so relevant, so mythisch gemacht und so unmittelbar mit dem Geschehen im modernen Europa verbunden hat. Warum hat sich die Vorstellung vom Mittelalter nach dem Zweiten Weltkrieg in Nichts aufgelöst, während die von der Antike unangefochten ist? Man muss sich auch fragen, warum sich niemand mehr wie Proust darüber Sorgen macht, dass die Kathedralen leer stehen, dass sie nur noch stumme Denkmäler einer verschwundenen Kultur sind, deren Bedeutung sich in der Erhaltung des Stadtbildes erschöpft.