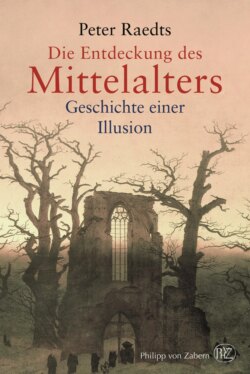Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kirche, König und Parlament
ОглавлениеIn der englischen Geschichte war die Reformation nicht dieselbe radikale Abrechnung mit der katholischen Vergangenheit, zu der sie in Deutschland unter Luther wurde. Für Luther und seine ersten Anhänger war die Reformation der alten Kirche ein direkter Eingriff Gottes, der das Ende aller Zeiten einleiten sollte. Dadurch wurde die Vergangenheit sinnlos, weil nur noch Gottes Zukunft zählte. Erst später setzte sich bei den Lutheranern das Bewusstsein durch, dass das Ende doch noch ein bisschen auf sich warten ließ, und man die Vergangenheit darum nicht einfach vergessen konnte, sondern studieren musste. In England war die Reformation kein spontanes Ereignis, keine Vision einiger gläubiger Theologen, sondern erfolgte auf Befehl der Regierung und, was noch wichtiger war, blieb immer unter der Kontrolle der Regierung. Die Geschichte ist bekannt: Weil König Heinrich VIII. vom Papst nicht die Zustimmung erhielt, seine Frau Katharina von Aragón zu verlassen, beschloss er 1534, das Band mit Rom zu lösen und sich selbst an die Spitze der englischen Kirche zu stellen. Um diesen Schritt zu rechtfertigen, berief man sich schon in den ersten Gesetzen, in denen die neue Stellung der Kirche vorbereitet wurde, auf „verschiedene alte und wahrhaftige Geschichten und Chroniken“, die eindeutig belegen sollten, dass die englischen Könige von jeher Kaiser in ihrem eigenen Reich gewesen seien und darum auch schon immer an der Spitze der nationalen Kirche gestanden hätten. Im selben Gesetz benannte man ansonsten noch die Parlamentssitzungen unter den Königen Eduard I., Eduard III., Richard II. und insbesondere Heinrich IV. als Momente, in denen die englische Krone ihre Unabhängigkeit erkämpft hätte, „um sie zu bewahren vor allen Einmischungen des römischen Stuhles“.69
Das gab den Ton an, dem alle späteren Anhänger Heinrichs VIII. folgten. Sie verteidigten die Reformation der englischen Kirche durch Verweise auf zahlreiche historische Präzedenzfälle, die belegen sollten, dass nicht England einen neuen Weg eingeschlagen hatte, sondern dass Rom mit den großen Traditionen der christlichen Kirche gebrochen hatte. Darüber hinaus wurde es Heinrichs Anhängern leicht gemacht, dieses Argument zu benutzen, weil in England die Kontinuität mit der mittelalterlichen Kirche faktisch sehr groß blieb. Die einzig wirklich radikale Maßnahme war die Aufhebung der Klöster zwischen 1536 und 1539, doch ansonsten blieben alle alten, ehrwürdigen Institutionen wie Kathedralen und Kapitel sowie die traditionellen Ämter wie Bischof oder Dechant mit ihrem ganzen Besitz und allen Privilegien bestehen, so dass das mittelalterliche Kirchenrecht in England weitgehend in Kraft blieb. Auch als man unter Eduard VI. und Elisabeth I. in der Lehre immer häufiger protestantische Ideen übernahm, blieb die mittelalterliche Kirchenorganisation unverändert, obwohl das von den wirklich überzeugten Protestanten, den Puritanern, zunehmend kritisiert wurde.
Mit mittelalterlichen Präzedenzfällen belegten die Juristen, dass Heinrich VIII. mit seinen Maßnahmen nichts anderes getan hatte, als auf dem Weg voranzuschreiten, den die englischen Könige schon lange vor ihm eingeschlagen hatten. Die Historiker machten daraus eine Geschichte. Einer der einflussreichsten von ihnen war der ehemalige Mönch John Bale. Sein größter Verdienst war eine Bestandsaufnahme mittelalterlicher Schriften, die nach der Aufhebung der Klöster verlorenzugehen drohten.70 Außerdem interpretierte er die Entwicklung der englischen Kirche neu, vor allem in seiner Illustrium majoris Britanniae scriptorum […] Summarium (1548–1549). Nach Bales Ansicht hatte das Christentum in England einen sehr reinen Ursprung. Zum ersten Mal wurde es nämlich von Josef von Arimathäa gepredigt, einem Jünger Jesu und zugleich dem Eigentümer des Grabes, in dem Jesus bestattet wurde (Mt. 27, 57–60). Diese Geschichte vom Ursprung des Christentums in England übernahm Bale aus der Anglica Historia (1512–1513), die der italienische Humanist Polydor Vergil wahrscheinlich im Auftrag Heinrichs VII. geschrieben hatte.71 In den darauffolgenden Jahrhunderten wurde ganz England christianisiert und hat seitdem an der Lehre der Urkirche festgehalten. Die Leitung der Kirche blieb hier immer in den Händen von Laien. Der Niedergang der englischen Kirche setzte ein, als Papst Gregor der Große im Jahr 596 veranlasste, eine Schar von Missionaren unter der Leitung des Mönches Augustinus nach England zu schicken, durchweg „Mönche und Italiener“, die viel über Logik und Philosophie wussten, aber nichts über die Heilige Schrift. Sie hatten die Aufgabe, statt den christlichen den römischen Glauben zu predigen und England dadurch der Macht des Papstes und des Klerus zu unterwerfen.
Im 11. Jahrhundert wurde ihr Werk von Anselmus fortgesetzt, der ebenfalls ein italienischer Mönch war. Als Erzbischof von Canterbury setzte dieser die verderbliche Politik von Papst Gregor VII. um, die darauf abzielte alle weltlichen Fürsten unter die Herrschaft des Papstes zu bringen. Dadurch wurde auch in England die legitime Macht des Königs über die Kirche erheblich beschnitten. Wie schlimm das alles war, zeigte sich 1171, als die klerikale Arroganz so groß wurde, dass Heinrich II., um seine Macht zu retten, nichts anderes übrig blieb, als den Erzbischof Thomas Becket in der Kathedrale von Canterbury ermorden zu lassen. Zum Glück gab es in der englischen Geschichte auch Gegenkräfte wie den Theologen John Wycliffe, der im 14. Jahrhundert die erste Bibelübersetzung auf Englisch verfasste, oder die Bewegung der Lollarden im 15. Jahrhundert, die ein einfaches evangelisches Christentum ohne Klerus, jedoch auch Treue zur Autorität des Königs befürworteten.72 Diese und andere fromme Christen haben die Wende zum Guten unter Heinrich VIII. vorbereitet.
In den großen Linien übernahmen alle späteren Apologeten der englischen Kirche Bales Ansichten von der Entwicklung des Christentums. Doch während Bale den Akzent besonders auf die christliche Antike Englands legte, verschob er sich bei John Foxe und Matthew Parker eher ins Mittelalter. John Foxe verdankt seinen Ruhm einem Buch, das unter dem Titel Foxe’s Book of Martyrs (1554) bekannt wurde, eine herzzerreißende Beschreibung des Schicksals der protestantischen Märtyrer unter der Regierung der katholischen Königin Maria Tudor. Allerdings stellte er die Glaubensbeweise dieser Helden des Protestantismus in einen größeren historischen Zusammenhang, indem er betonte, in England habe die Kirche sehr viel länger die ursprüngliche Reinheit des Glaubens bewahrt und sich viel früher als anderswo, schon seit Wycliffes Wirken im späten 14. Jahrhundert, gegen Roms Tyrannei erhoben. Foxe machte im Mittelalter viel mehr Lichtpunkte aus als Bale.
Er verehrte den legendären König Artus als Ideal eines frommen christlichen Fürsten und vertrat die Ansicht, auch in der angelsächsischen Zeit habe sich viel Gutes erhalten. Mit den Mönchen, die Papst Gregor der Große entsandt hatte, war demnach natürlich Verderbnis eingedrungen, dennoch gelang es den Engländern in den folgenden Jahrhunderten, vor allem durch die weise Gesetzgebung guter Könige, wie Alfred dem Großen Ende des 9. Jahrhunderts, die Lehre des wahren Glaubens größtenteils zu bewahren, während sie anderswo in Europa längst verdorben war. Erst nach der Eroberung Englands durch die Normannen 1066 sei alles schiefgegangen. Doch selbst damals hätte es noch weise Fürsten wie Heinrich II. gegeben, der sich nicht von Becket schikanieren ließ, und vor allem Johann I. Ohneland, der nach Ansicht von Foxe das tragische Opfer päpstlichen Machtmissbrauchs wurde. Der Aufstand der Barone unter seiner Herrschaft, der 1215 in der Ausstellung der Magna Charta gipfelte, war nach Foxes Meinung vom Papst angestiftet, um die Stellung des Königs zu schwächen und ihn der päpstlichen Macht zu unterwerfen.73
Wie die meisten europäischen Protestanten waren Bale und Foxe also davon überzeugt, dass die Kirche nach der Zeit der Apostel immer weiter in Verfall geraten war. Doch nach ihrer Darstellung spielte England in dieser traurigen Geschichte eine ganz besondere Rolle, erstens weil der christliche Glaube in England apostolischen Ursprungs war und England diesbezüglich als einziges europäisches Land auf einer Stufe mit Rom stand, zweitens aber auch weil die englische Kirche diesen apostolischen Glauben in den folgenden Jahrhunderten viel reiner bewahrt hatte als die Kirche Roms. Dass es trotzdem zu Auflösungserscheinungen kam, hatten die Engländer den Schurkereien des Papstes zu verdanken; was von der ursprünglichen Inspiration erhalten blieb, verdankten sie der Weisheit des Königs.
Unter der harten Herrschaft Elisabeths I. wurde die Gefahr einer Rückkehr der englischen Kirche in den Schoß Roms endgültig gebannt, doch dafür hörte man von streng protestantischer Seite her immer lautere Kritik: Die Reformation sei nicht weit genug gegangen und die anglikanische Kirche halte noch viel zu sehr an ihren mittelalterlichen Institutionen fest, zum Beispiel am Bischofsamt, das in der Urgemeinde überhaupt nicht existiert habe. Den Angriff der radikalen Reformatoren parierte Matthew Parker, der 1559 zum Erzbischof von Canterbury ernannte wurde. Parker verteidigte die von der anglikanischen Kirche gewählte Stellung zwischen Katholizismus und Protestantismus (bekannt als via media oder Mittelweg) und legte dazu eine gewaltige Sammlung mittelalterlicher Dokumente an, die im damaligen England ihresgleichen suchte.74 Mit diesen Quellen gewappnet zog er in den Kampf gegen seine protestantischen Gegner. Zunächst machte er kurzen Prozess mit der Anschuldigung, das Bischofsamt sei erst 597 mit der Ankunft der Mönche aus Rom in England eingeführt worden. Seit der allerersten Predigt des Evangeliums durch Josef von Arimathäa habe es in England Bischöfe gegeben, darum bildeten sie ein unwiderrufliches Erbe der englischen Kirche, das man nicht einfach abschaffen könne.
Das eigentliche historische Fundament für die Kirche seiner Zeit fand Parker in der angelsächsischen Epoche. Damals habe ein glückliches Gleichgewicht existiert, das nach der normannischen Eroberung brutal gestört worden sei, um erst jetzt unter Elisabeth I. wiederhergestellt zu werden. Die angelsächsische Kirche war in starke Bistümer organisiert, doch der Klerus war verheiratet, wie sich das gehörte. Die Messe wurde nicht als ein Opfer betrachtet, in dem Christus wirklich zugegen war, sondern als eine Gedächtnisfeier. Darüber hinaus benutzte man im Gottesdienst nicht Latein, sondern die Sprache des Volkes, das Angelsächsische. Parker war geradezu besessen von der alten englischen Sprache. Er scheute weder Kosten noch Mühe, um aus ganz England angelsächsische Manuskripte zusammenzutragen. Als wichtigstes Ergebnis seiner Forschung veröffentlichte er 1574 die von Asser um 890 geschriebene Biographie Alfred des Großen. In der Einleitung empfahl Parker allen wärmstens, Altenglisch zu lernen. Doch vor allem wollte er mit dieser Ausgabe zeigen, dass Alfreds Regierung der Höhepunkt der alten englischen Geschichte war. Alfred war nicht nur ein großer militärischer Anführer und Gesetzgeber, er hatte auch die Kirche vorbildlich geführt. Seine größte Sorge galt dem Ausbildungsstand des Klerus, wie unter anderem die Tatsache zeigt, dass er die Cura pastoralis, eine Abhandlung Gregor des Großen über die pastoralen Pflichten des Klerus, eigenhändig ins Angelsächsische übersetzt hat.75 Die Einheit von König und Kirche, von katholischer Struktur und protestantischer Lehre, das Glaubensbekenntnis sowie den Gottesdienst übersetzt in die Volkssprache, das alles fand Parker im 9. Jahrhundert und hoffte, es unter Alfreds ferner Nachfolgerin Elisabeth I. wieder einführen zu können.76
Obwohl Parker für eine Kirche plädierte, die zwischen den katholischen und protestantischen Extremen die Mitte hielt, gelang es ihm nicht, einen Großteil der engagiertesten englischen Christen zu überzeugen. Der Ruf nach einer radikalen Reformation erhielt immer größere Zustimmung. Die Puritaner wollten nicht die Kirche Alfreds des Großen, sondern die Kirche Jesu Christi und seiner ersten Jünger. Und für sie bedeutete das eine Kirche ohne Kathedralen, ohne Bischöfe und – das vielleicht radikalste von allem – ohne König. Diesen letzten Schritt hätten die Puritaner vielleicht nie unternommen, wenn die Könige Jakob I. und Karl I. nicht in einer Kirche mit Bischöfen das beste Instrument gesehen hätten, ihre königliche Macht auf Kosten des Parlaments zu vergrößern. Sie glaubten, dass eine hierarchisch organisierte Kirche die beste Garantie für einen hierarchisch aufgebauten Staat mit dem König als absolutem Fürsten an der Spitze bietet. Was im 16. Jahrhundert als religiöser Streit begonnen hatte, verwandelte sich dadurch im 17. Jahrhundert in einen politischen Kampf um die Beziehungen zwischen König und Parlament. In diesem Kampf wurde die richtige Interpretation der mittelalterlichen Vergangenheit Englands zu einer der wichtigsten Waffen in den Händen beider Parteien.
Zweifellos hatten die Befürworter einer starken königlichen Macht die besseren historischen Argumente. In ihrem Lager befand sich einer der größten Historiker des 17. Jahrhunderts, Henry Spelman, der seinen Ruhm vor allem seinem Buch The Original, Growth, Propagation and Condition of Feuds and Tenures by Knight-service in England (1639) verdankte. Diese Abhandlung über Ursprung und Art des Feudalismus, einschließlich der Rolle des Königs, war ein bedeutender Durchbruch bei der Erforschung der konstitutionellen Geschichte des Mittelalters. Im Gegensatz zu den französischen Juristen des 16. Jahrhunderts, die wie besessen waren vom römischen Ursprung des Feudalismus, gelang es Spelman, dem feudalen System auf den Grund zu gehen. Er zeigte nämlich, dass es eine Form des Landbesitzes war und zugleich eine Art Kriegsdienst, beides gestützt auf ein Band persönlicher Treue zwischen König und Lehnsmann. Spelman konnte auch belegen, dass der Feudalismus in angelsächsischen Zeiten gar nicht existiert hatte, sondern erst von Wilhelm dem Eroberer in England eingeführt worden war.
Je schärfer er die Konturen des Feudalismus ins Visier nahm, desto klarer erkannte er, dass sich das ganze System um die Macht des Königs drehte: Der war nämlich der Besitzer des ganzen Landes, er schenkte seine Gunst, wem er wollte, und der Vertrag, den er mit einem Lehnsmann schloss, schuf zwar gegenseitige Verpflichtungen, war jedoch von Seiten des Königs eine reine Gunst. Das bedeutete, dass der Feudalismus gar nicht die Grundlage für die Machtverteilung zwischen König und Untertanen war. Diese These verfeinerte Spelman noch in einer Abhandlung über den Ursprung des Parlaments. Darin erläuterte er, dass die Einberufung der Bürgerschaft auf Initiative des Königs erfolgte, wenn dieser das Bedürfnis verspürte, zusätzlich zu den Ratschlägen seiner Barone und Bischöfe auch noch die Meinung anderer Bewohner seines Königreiches zu hören. Spelman vermutete eine erste Versammlung dieser Art im Jahre 1258 unter der Regierung Heinrichs III. Wichtiger als die Frage, wann wohl zum ersten Mal eine Parlamentssitzung stattgefunden hat, waren die beiden unvermeidlichen Schlussfolgerungen, dass es in England zwar immer einen König gegeben hat, aber kein Parlament, und dass die Einberufung des Parlaments auf Initiative des Königs erfolgte. Demnach besaß das Parlament nicht das geringste Recht, sich dem König zu widersetzen oder ihn gar abzusetzen.77
Ganz gleich wie historisch korrekt Spelmans Erklärung auch sein mochte, in der politisch erregten Situation unter den Stuart-Königen war sie für die meisten Engländer inakzeptabel.78 Die radikalste Attacke gegen die Stellung der Monarchie führte der Anwalt Edward Coke, der verschiedene Ämter bekleidete, unter anderem ab 1593 den Vorsitz des Unterhauses. Coke war heilig davon überzeugt, dass „Englands Gesetze viel, viel älter sind als die Regeln und Gesetze der römischen Kaiser“.79 Hieraus zog er den Schluss, dass der König in England schon immer dem Gesetz unterworfen war, während das Parlament seit Urzeiten als Wachhund des gemeinen Rechts fungiert hat, eine Überzeugung, die in der Theorie der Ancient Constitution Gestalt annahm. Nach ihr lag der Ursprung des Parlaments irgendwo in grauer Vorzeit. Eine erste historisch nachweisbare Form des Parlaments war der Witenagemot, der Rat der Barone, die sich in angelsächsischen Zeiten um den König scharten und ihn bei der Regierung unterstützten. Die normannische Eroberung bedeutete einen Bruch, doch schon 1116 versammelte Heinrich I. wieder seine Getreuen um sich. Und beginnend mit diesem Moment konstruierte Coke eine Kontinuität mit dem ersten Parlament des Jahres 1295 unter der Regierung Eduards I. Coke war sich nicht nur sicher, dass das Parlament uralt war, seiner Meinung nach hatte es auch immer die gesamte Bevölkerung Englands vertreten, nicht nur den Adel.80 Dabei stützte er sich auf das Werk des Juristen und Historikers William Lambarde, der in seinem Archeion (1591) behauptet hatte, das Wort baro bezeichne in mittelalterlichen Dokumenten nicht nur Baron, sondern auch Bürger.81
Der schönste Beleg für die hohe Stellung des Rechts in der englischen Gesellschaft und die eingeschränkte Macht des Königs war nach Cokes Meinung die Magna Carta, 1215 von Johann Ohneland ausgestellt, um seinen Konflikt mit den Baronen beizulegen. Darin ging es Coke vor allem um die Bestimmung, dass man in England keinen freien Mann verhaften darf, es sei denn, er wurde von seinesgleichen oder nach dem Gesetz des Landes rechtmäßig verurteilt. Man kann es Ironie nennen, dass der Aufstand der Barone, den die Tudor-Historiker als deutlichsten Beweis für ein päpstliches Komplott gegen England betrachtet hatten, unter den veränderten politischen Umständen des 17. Jahrhunderts auf einmal als heiliges Fundament des englischen Staates galt. Nach dem endgültigen Triumph des Parlaments über den katholischen König Jakob II. im Jahre 1688 stieg der Status der Magna Carta in nahezu mythische Höhen.82
Seit diesem Jahr der Glorious Revolution war das Bild der englischen Geschichte für Jahrhunderte festgeschrieben. England war demnach die „mother of the free“, es war das Land, wo die Freiheit des Bürgers respektiert wurde, wo man Ehrfurcht vor dem Gesetz hatte, und wo die Regierung dies alles durch ein weises Gleichgewicht zwischen Fürst und Parlament garantierte. Die Grundlage dazu wurde schon in angelsächsischen Zeiten gelegt, zum ersten Mal ausdrücklich formuliert wurde das in der Magna Carta, und die letztendliche Bestätigung bildete die Bill of Rights des Jahres 1688. Die Anhänger der absoluten Monarchie mochten zwar die besseren historischen Argumente haben, doch im großen Kampf um die Freiheit siegte der Mythos über die Geschichte, weder zum ersten, noch zum letzten Mal.
Mit dem Ende der konstitutionellen Krise des 17. Jahrhunderts hörte auch das ernsthafte Interesse an der mittelalterlichen englischen Geschichte abrupt auf. Das letzte große Werk auf diesem Gebiet war der Linguarum veterum septentrionalium thesaurus (1703–1705) von Georges Hickes, ein Werk mit Grammatiken und Vokabellisten der wichtigsten nordgermanischen Sprachen. Anschließend blieb es 100 Jahre lang still. Im 18. Jahrhundert wandten sich sowohl die Welt der Gelehrten als auch das gebildete Bürgertum wieder ganz dem Studium jener Epoche zu, mit der sie sich seit 1500 eigentlich am liebsten beschäftigt hatten, der klassischen Antike. Durch die großen archäologischen Entdeckungen in Pompeji und Herculaneum nach 1740 nahm dieses Interesse sogar noch lebhaftere Formen an. Alle kulturellen Wunderwerke, die hier ausgegraben wurden, die Villen, Badehäuser und Tempel, die Fresken und Skulpturen offenbarten einmal mehr, wie tief der Verfall in der Zeit danach gewesen war. Es war eine Bestätigung für das, was alle schon immer gewusst hatten, selbst diejenigen, die sich kurz davor noch so begeistert auf die Erforschung des Mittelalters gestürzt hatten.
William Camden, ein Schüler von Matthew Parker und einer der größten Kenner des englischen Mittelalters, musste zugeben, dass es um die Zivilisation damals schlecht bestellt gewesen ist, sie war „gehüllt in dunkle Wolken, oder besser noch in dichte Nebelschwaden der Unwissenheit, so dass jeder Funke kritischer Wissenschaft einem Wunder gleichkam“. John Selden, der 1618 mit seiner History of tithes ein kontroverses und noch immer wichtiges Buch über die Kirchensteuern im Mittelalter geschrieben hatte, glaubte, sich dafür bei seinen Freunden entschuldigen zu müssen: Es handele zwar von einer „kahlen und sterilen Vergangenheit“, aber er habe es doch getan, weil es etwas Licht auf heutige Probleme werfen könne.83 Das tat es und zwar so deutlich, dass sich Selden deswegen vor dem Richter verantworten musste, weil die Kirchenleitung Anklage gegen ihn erhoben hatte. Dieselbe Tendenz gab es in Frankreich: In dieser Zeit studierte man das Mittelalter nicht aus historischen Gründen, sondern aus juristischen. Wer seinem Herzen folgte, beschäftigte sich mit der Antike, nur die Pflicht zwang einige, sich in seltenen Fällen um die Zeit danach zu kümmern.
Zum Glück war das nach 1700 nicht mehr nötig, doch das Ende der trockenen Diskussion über die Beschaffenheit der englischen Verfassung machte den Weg für ein spielerisches Interesse am Mittelalter frei, wie es zur gleichen Zeit ganz ähnlich auch in Frankreich aufkam. Niemand nahm diese Epoche ernst, doch es war amüsant und entspannend, von keuschen Jungfrauen und wollüstigen Mönchen zu lesen, ganz zu schweigen von der gruseligen Dunkelheit, die alle katholischen Traditionen umgab. Zeitweise musste sich jeder englische Aristokrat, der auf der Höhe der Zeit sein wollte, mindestens eine gotische Abteiruine in seinen Schlosspark stellen. Der Staatsmann und Schriftsteller Horace Walpole ging sogar noch weiter und ließ sein Landgut in Twickenham in ein komplettes gotisches Schloss umbauen. Hier schrieb er eine phantastische mittelalterliche Novelle, The Castle of Otranto (1764), eine wahre Schauergeschichte voll finsterer Leidenschaft, Morden bei Mondenschein und unerklärlichen übernatürlichen Erscheinungen. Das Buch hatte sofort Erfolg und begründete die Mode der Gothic novel, ein Genre, das so populär wurde, dass Jane Austen es 40 Jahre später in ihrer Northanger Abbey aufs Korn nahm.84 Doch derselbe Walpole hatte für die mittelalterliche Literatur nur Verachtung übrig. Selbst ein Dichter wie Chaucer fand sie lediglich in den Bearbeitungen von Dryden und Pope erträglich, ansonsten seien mittelalterliche Dichter völlig unlesbar: „Kein Schimmer Poesie in ihren Werken“.85 Als der Historiker und Philosoph David Hume in seiner Geschichte Englands beim Jahr 1485 anlangte, vermerkte er erleichtert, er könne ab jetzt endlich über die „Morgenröte der Zivilisation und der Wissenschaft“ schreiben.86
Nichts illustriert die zögerliche Aufwertung des Mittelalters besser als die 1730 nach einem Entwurf von Nicholas Hawksmoor vollendete Bibliothek des All Souls College in Oxford. Von außen ist das Gebäude ein Spiel mit gotischen Formen und Spitzbogenfenstern, doch innen ist die Bibliothek streng klassizistisch, selbst die gotischen Formen der Fenster sind kaschiert. Die Gotik bleibt draußen, lediglich eine amüsante Spielerei in einer Kultur, die die klassische Antike auch weiter als letzte, endgültige Norm ansah. Edward Gibbon sprach im Namen aller kultivierten Engländer, als er das Römische Reich des Antoninus Pius eine Blaupause für eine ideale Gesellschaft und die anschließenden Jahrhunderte einen „Sieg der Barbarei und Religion“ nannte.87