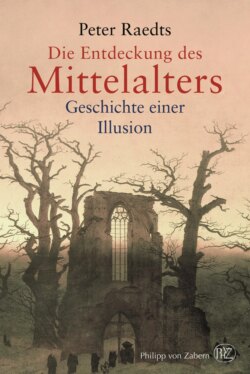Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kaiser und Papst
ОглавлениеIn Deutschland und den Niederlanden gab es nur eine Möglichkeit, die eigene Geschichte mit der klassischen Antike anfangen zu lassen, nämlich die Auswertung der äußerst spärlichen Angaben, die sich in den römischen Quellen über die Germanen fanden. Schließlich bewohnten sie in der Antike jenes Gebiet, das später die Niederlande und Deutschland umfassen sollte. Tacitus war der einzige antike Autor, der sich etwas ausführlicher mit den alten Germanen beschäftigt hatte. In den Annales hatte er dem germanischen Anführer Arminius (in Deutschland später irrtümlich Hermann genannt) breiten Raum gewidmet. Dieser hatte im Jahre 9 völlig unerwartet ein großes römisches, von Varus geführtes Heer vernichtend geschlagen. Nach den Angaben von Tacitus geschah dies im Teutoburger Wald. In den Historiae berichtete er ausführlich vom gefährlichen Aufstand des Häuptlings der Bataver, Julius Civilis, während der politischen Wirren nach Neros Tod im Jahre 68. Und in seinem Aufsatz Germania, der die Geschichte und Sitten der Germanen behandelte, verglich er die Reinheit und Einfachheit dieser Naturvölker mit der überzivilisierten Dekadenz Roms.
Für die Humanisten im Norden waren das drei schöne Punkte, mit denen sie auftrumpfen und ihren italienischen Kollegen vorhalten konnten, dass die Germanen den Römern in mancher Hinsicht weit überlegen gewesen sind. Ein hübsches Beispiel für diesen Standpunkt ist die Monographie des deutschen Humanisten Ulrich von Hutten über Arminius, 1529 postum veröffentlicht. In diesem Buch besang er Arminius als großen Kriegshelden der Germanen und als den ersten Retter des deutschen Vaterlandes.38 Sein Lobgesang wurde zum Ausgangspunkt eines Personenkultes um diesen Häuptling, der seinen Höhepunkt 1875 erreichte, als Kaiser Wilhelm I. am – vermeintlichen – Ort der Schlacht das gewaltige Hermannsdenkmal einweihte.
In den Niederlanden konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Humanisten auf das Volk der Bataver, das Tacitus zufolge eine Insel in der Rheinmündung bewohnt hatte. Obwohl unter niederländischen Humanisten wie Erasmus von Rotterdam und dem Gelehrten Gerhard Geldenhauer aus Nimwegen ein heftiger Streit über die Frage ausbrach, wo diese Insel nun genau lag, ob damit Holland gemeint war oder die Betuwe, waren sich alle darin einig, dass diese von Tacitus für ihre Tapferkeit und Treue gerühmten Bataver die Vorfahren der heutigen Bewohner der Niederlande sein mussten.39 Als sich die niederländischen Provinzen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegen den König von Spanien erhoben, erhielt der Aufstand des batavischen Anführers Julius Civilis gegen die Römer eine besondere Bedeutung. Zeigte sich daran nicht, wie sehr Unabhängigkeitsbestreben und Widerstand gegen fremde Tyrannei das niederländische Volk schon von jeher ausgezeichnet hatten? Damit war der Grundstein für einen historischen Mythos gelegt, der sich in den niederländischen Schulbüchern bis ins 20. Jahrhundert hinein erhalten hat.
Doch egal wie sehr sich die Humanisten des Nordens bemühten, alle spärlichen Angaben über die Germanen und Bataver in der antiken Literatur auszuwalzen, unbestreitbar blieb, dass über diese alten Völker kaum etwas bekannt war. Darum mussten Gelehrte, die sich mit der Vergangenheit des Vaterlandes beschäftigten, auch die Geschichte der eigenen Provinzen nach der Antike unter die Lupe nehmen. Das war unvermeidlich. In dieser Zeit waren die Provinzen ja entstanden, und damals hatte das eigene Volk bewunderungs- und nachahmenswerte Taten vollbracht, über die man unbedingt schreiben musste.
In den deutschen Ländern konnte man ziemlich leicht eine Verbindung zwischen der antiken und der mittelalterlichen Vergangenheit herstellen. Außerdem empfand man den Übergang auch kaum als schmerzhaft. Schließlich besaß der deutsche König seit der Kaiserkrönung Ottos I. im Jahre 962 – nach Ansicht vieler schon seit Karl dem Großen – gesetzmäßig Anspruch auf das Amt des römischen Kaisers. Er war der Nachfolger von Augustus und Konstantin dem Großen, und dadurch war Deutschland der direkte Erbe des Römischen Reiches, nicht Italien oder die Stadt Rom. Seit dem Tod Friedrichs II. im Jahre 1250 besaß die Macht des Kaisers zwar nur noch wenig Einfluss auf das politische Spiel im Deutschen Reich, dennoch blieb das Prestige des Kaisertums gewaltig, auch im 16. und 17. Jahrhundert unter Kaisern wie Karl V. oder später Rudolf II. Die Deutschen jeder Konfession und Strömung waren stolz darauf, dass ihr Fürst der Kaiser war, und dass sie dadurch am Ruhme Roms teilhaben konnten. Darum empfand man auch das Mittelalter in Deutschland viel weniger als in Italien als einen Bruch mit der Antike, so dass die Deutschen die Geschichte des Mittelalters als Verlängerung der Antike behandeln konnten. Dieses Bewusstsein einer Kontinuität zeigt sich unter anderem daran, dass die deutsche Geschichtsschreibung die mittelalterliche Vier-Reiche-Lehre noch in der Renaissance und sogar bis ins 18. Jahrhundert hinein als historisches Schema benutzte, während diese Einteilung im übrigen Europa schon längst außer Gebrauch war. Nach der mittelalterlichen Auffassung war das Römische Reich überhaupt nicht untergegangen, sondern hatte sich behauptet: Im Osten war die Herrschaft auf die Kaiser des Neuen Roms, Konstantinopel, übergegangen, während sich im Westen zunächst die Franken mit der Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahre 800 zu den Erben der alten Kaiser erklärt hatten. Später waren es dann die Deutschen, seit Otto I. 962 vom Papst in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Im Mittelalter sprach man von der translatio imperii, der Übertragung des Reiches.40 Solange ein deutscher König zum Kaiser gekrönt wurde, existierte das Römische Reich einfach weiter.
Diese Sicht auf die deutsche Vergangenheit war eng mit der alten Kirche verwoben. Schließlich waren seit Karl dem Großen alle Kaiser vom Papst gekrönt worden. Darüber hinaus galt der Kaiser neben – oder unter – dem Papst als Oberhaupt der Kirche, eine Funktion, die vor allem Karl V. sehr ernst genommen hat, wie sein hartnäckiger Kampf gegen Protestanten und Türken zeigt. Darum überrascht es auf den ersten Blick, dass sich auch Luthers Anhänger zu dieser Ideologie der Vier-Reiche-Lehre bekannten und sie nicht zusammen mit dem Papsttum auf den Müllhaufen der Geschichte warfen. Dafür kann man einige Gründe nennen. Zunächst waren Luther und seine ersten Anhänger, wie bereits erwähnt, fest davon überzeugt, dass die ganze Geschichte ihrem Ende entgegenging und dass damit natürlich auch das Römische Reich untergehen würde. Darum hatten sie keinen besonderen Bedarf an einem anderen Modell, um die Vergangenheit zu verstehen.41 Der zweite Grund war, dass sie die Reichsideologie auch als historische Waffe gegen den Papst benutzen konnten. Gerade im Mittelalter ist der Kaiser oft der große Gegenspieler des Papstes gewesen, daran erinnerten sich die Reformatoren noch gut. Vor allem auf den Titanenkampf zwischen Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII. verwiesen die Reformatoren gern, um zu schildern, wie die Päpste schon immer ihre geistliche Autorität missbraucht hatten, um auf Kosten christlicher Fürsten politische Macht zu erwerben.
Die Reformatoren machten sich auch auf die Suche nach Dokumenten, die ihren Standpunkt untermauern konnten. Der aufsehenerregendste Fund war das Liber de unitate ecclesiae conservanda (Das Buch über den Erhalt der Einheit der Kirche), ein Pamphlet, das ein Mönch der Abtei Hersfeld 1085 zusammengestellt hatte. Es enthielt einen äußerst scharfen Angriff auf Gregor VII. als den Mann, der die Einheit der Christen zerstört hat. Ulrich von Hutten entdeckte 1519 eine Handschrift dieses Pamphlets in der Abteibibliothek in Fulda (seitdem verloren). 1520 gab er dieses Werk in gedruckter Form heraus und sorgte dafür, dass ein Exemplar dieses Buches auch an Erzherzog Ferdinand von Österreich, einen Bruder Karls V., geschickt wurde, zweifellos um den Kaiser auf diese Weise daran zu erinnern, wo seine Pflicht lag im Konflikt der protestantischen Reichsfürsten mit dem Papst.42
Auch in der protestantischen Geschichtsschreibung des 16. Jahrhunderts wurde betont, was für eine heilsame Rolle die Kaiser innerhalb der Kirche gespielt hatten. Dies geschah immer im Rahmen der Vier-Reiche-Lehre. Oben wurde bereits erwähnt, dass die Abfolge der vier Reiche in der Chronik von Johannes Carion als deutliches Zeichen für die wohltätige Wirkung von Gottes mächtiger Hand in der Geschichte gedeutet wurde. Ein einflussreicher protestantischer Historiker wie Johannes Sleidanus gab seiner Gesamtdarstellung der Geschichte den Titel De quattuor summis imperiis (Über die vier größten Reiche; 1580), was bereits alles über die Einteilung seines Buches sagt. Unter den Kaisern schätzten die protestantischen Historiker besonders Karl den Großen, Otto I. und Heinrich IV., denen wir bereits begegnet sind, dazu Friedrich II., der als Ideal eines christlichen Fürsten geschildert wurde, weil er sich unermüdlich für Wissenschaft und Kunst eingesetzt hat, vor allem aber wegen seines Kampfes gegen den Papst.43
Für die Protestanten war es ein großes Problem, dass seit Karl dem Großen alle Kaiser vom Papst gekrönt worden waren. Dies war eine unumstößliche Tatsache, aus der die Päpste den Anspruch ableiteten, im Besitz der kaiserlichen Macht zu sein und diese mit der Kaiserkrönung nur auf den deutschen König zu übertragen. Diesen Anspruch unterstützte die berüchtigte Donatio Constantini (Konstantinische Schenkung), eine Proklamation Kaiser Konstantins des Großen, in der dieser verkündete, er habe zum Dank für seine Genesung von einer schweren Krankheit, die er dem Gebet Papst Silvesters verdanke, die weltliche Macht über den Westen des Reiches Silvester und seinen Nachfolgern übertragen.44 Zwar hatte der italienische Humanist Lorenzo Valla schon um 1440 nachgewiesen, dass diese Proklamation lediglich eine Fälschung aus dem 8. Jahrhundert war, trotzdem blieb die Tatsache, dass die Kaiserkrönung durch den Papst nun einmal üblich war und der Papst daraus weiterhin den Anspruch ableitete, über dem Kaiser zu stehen.
Dass der Papst den deutschen Fürsten zum Kaiser krönte, war für Luther so problematisch, dass er anfangs dazu neigte, die Bedeutung des Kaisertums zu leugnen und als leere Hülle zu bezeichnen. Später gelangte er zum Schluss, Karl der Große habe das Kaisertum nicht vom Papst erhalten, sondern man habe es ihm geradewegs aus Griechenland übertragen.45 In seinem Teil von Carions Chronik äußerte Melanchthon die These, bei Karls Krönung sei der Papst lediglich als Vertreter des römischen Volkes aufgetreten, und folgerte daraus, dass es ganz egal sei, wie der Kaiser gekrönt werde, weil letztendlich nicht der Papst, sondern Gott allein, alle Königreiche übertrage und bestätige.46 Mit solchen Kniffen konnten auch die Protestanten künftig das Kaisertum ehren und glauben, das antike Rom, das letzte der vier Weltreiche, würde mittels der translatio imperii sowohl im Mittelalter als auch im zeitgenössischen Deutschen Reich fortleben.47
Erst im 18. Jahrhundert begannen deutsche Historiker und Juristen daran zu zweifeln, ob das antike Rom und das spätere Deutsche Reich tatsächlich so selbstverständlich miteinander verbunden sind, wie man immer vorausgesetzt hatte. Als einer der ersten in Deutschland stellte der Jurist Christian Thomasius fest, dass diese Kontinuität nur eine Fiktion war, und zwischen Antike und Mittelalter in Wirklichkeit eine tiefe Kluft gähnte. Bei seinen Forschungsarbeiten zur Gesetzgebung des Reiches im 18. Jahrhundert stieß er auf das Problem, dass die tatsächliche Staatsstruktur der deutschen Länder kaum etwas mit der antiken römischen Gesetzgebung, wie sie im Codex Kaiser Justinians I. überliefert war, zu tun hatte. Das alte Rom war ein sehr zentral gelenkter Staat, während es sich beim Römisch-Deutschen Reich des 18. Jahrhunderts um eine völlig zersplitterte Ansammlung kleiner Territorien handelte, nur locker zusammengehalten von der Reichsgesetzgebung und den letzten Resten einer kaiserlichen Autorität. Der Ursprung dieser Ordnung konnte nicht im antiken Rom liegen, sondern musste in der deutschen Gesetzgebung und der späteren deutschen Geschichte gesucht werden. Nachdem er sich das einmal bewusst gemacht hatte, war Thomasius gezwungen, die Fiktion einer Kontinuität zwischen dem alten Rom und dem Deutschen Reich aufzugeben: Das waren zwei völlig verschiedene historische Staatsformen, die man unabhängig voneinander sehen musste.48 Die Zäsur zwischen beiden datierte Thomasius um das Jahr 500.
Sowohl für die Geschichtsschreibung als auch für das Geschichtsbewusstsein in Deutschland hatte Thomasius’ Entdeckung einschneidende Folgen. Als man erst einmal die Fiktion aufgegeben hatte, die deutsche Gesetzgebung sei eine Fortführung der römischen, stellte sich heraus, dass man über den mittelalterlichen Ursprung der gültigen Gesetzgebung des Reiches praktisch nichts wusste. Dies hatte zur Folge, dass die Geschichtsschreibung völlig neue Methoden entwickelte. Alle existierenden Geschichtswerke konnte man beiseitelegen, weil sie auf der Fiktion einer Kontinuität aufbauten. Doch um eine neue Geschichte zu schreiben, mussten die Historiker erst einmal nach neuen Quellen suchen. Ab 1750 begann man in Deutschland, alle Archive nach Urkunden, Bullen, Privilegien und anderen Dokumenten zu durchforschen, die ein Bild von der Struktur und den Institutionen des mittelalterlichen Deutschen Reiches zeichnen konnten. Dieser Aufbruch der Mediävistik zur Quellenforschung und zur genauen Untersuchung aller Institutionen ist für die deutsche Mittelalterforschung bis heute prägend geblieben. Für das historische Bewusstsein bedeutete dies, dass sich in Deutschland um 1750 eine vorsichtige Neubewertung des Mittelalters vollzog als einer Epoche, die sich grundlegend von der Antike unterschied. Nach und nach dämmerte die Erkenntnis, dass sich die Größe der deutschen Vergangenheit nicht auf der Verbindung mit Rom gründete, sondern auf der Einheit und Macht aller um den Kaiser gescharten deutschen Länder in den Jahrhunderten nach Rom. Deutschland musste sein Selbstbewusstsein gar nicht von Rom ableiten, sondern konnte stolz auf die eigene deutsche Vergangenheit verweisen, um hieraus Inspiration für die Zukunft zu schöpfen. Der Untergang des alten Reiches im Gefolge der Französischen Revolution stärkte dieses Selbstbewusstsein. Der letzte Kaiser, Franz II., wurde am 14. Juli 1792 gekrönt, ein Datum, das der Berliner Zeitung den Kommentar entlockte: „Es ist ein merkwürdiger Umstand, dass die Krönung just am 14. Juli stattfand, an dem Tag, an dem 1789 die Bastille erstürmt wurde.“49 Das war tatsächlich merkwürdig, und 1806 beschloss der letzte römisch-deutsche Kaiser dann auch, die Krone des 1000 Jahre alten Reiches niederzulegen, bevor Napoleon sie für sich beanspruchen konnte.