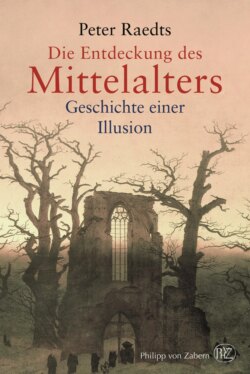Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Protestanten und Katholiken
ОглавлениеNördlich der Alpen wurde die Renaissance in den Jahren um 1500 begeistert aufgenommen. Auch in Nordeuropa manifestierte sich in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts allmählich in immer größeren Kreisen ein Gefühl des Verdrusses und der Unzufriedenheit mit der bestehenden intellektuellen Bildung, so dass es auch hier zur Ablehnung der unmittelbaren Vergangenheit kam. Obwohl die Forschung in den letzten 20 Jahren herausgearbeitet hat, dass die Kontinuität in Unterricht und Erziehung zwischen Mittelalter und Renaissance tatsächlich viel größer war, als früher angenommen worden war, und die Renaissance nicht länger als Beginn der Moderne gelten kann, steht dennoch fest, dass sich damals viele talentierte, originelle Denker und Dichter nicht länger in der scheinbar steril und nichtssagend gewordenen Weisheit ihrer Vorfahren wiedererkannten.18 Mit dem Aufkommen der Schulen und Universitäten im 12. Jahrhundert hatte man eine Methode aus Frage und Antwort zwischen Lehrer und Schüler entwickelt, mit der man die Schüler in kurzer Zeit in komplizierte wissenschaftliche Probleme einführen konnte. Sie wurde unter dem Namen Scholastik bekannt.
Um 1500 hatte diese Methode für viele ihren Glanz verloren, obwohl sie an den Universitäten noch einige hundert Jahre lang in Gebrauch blieb. Allerdings schien sie keine neuen Erkenntnisse mehr hervorzubringen und hatte ihren Wert für die Bildung der Jugend anscheinend verloren. Humanisten wie Desiderius Erasmus ließen kein gutes Haar an den Methoden, mit denen man sie unterrichtet hatte. Die italienische Erneuerungsbewegung verlieh diesem Gefühl der Unzufriedenheit Ausdruck und gab ihm einen historischen Rahmen: Die unmittelbare Vergangenheit war tatsächlich finster und barbarisch. Darüber hinaus boten die Italiener eine klare pädagogische Alternative: Rückkehr zu den Klassikern. Junge Menschen bräuchten lediglich eine Ausbildung in den bonae litterae (der guten Literatur), in der Sprache Vergils und Ciceros. Dort könnten sie lernen, sich in klarem, reinen Latein auszudrücken, und wer sich hierzu befleißigt hatte, halte alle Instrumente in Händen, um sich zu einem zivilisierten, moralisch hochstehenden Menschen zu entwickeln.
Die italienische Renaissance mit ihrer Verehrung der klassischen Antike und ihrer Abwendung von der Mittelperiode wurde darum im Norden begeistert aufgenommen, allerdings beeinflussten zwei Faktoren ihre Rezeption, durch die sich auch die Einschätzung des Mittelalters beträchtlich veränderte.19 Der erste war die Reformation und der zweite ein erwachendes patriotisches Gefühl, das von allen Humanisten im Norden wie im Süden angefacht wurde.
Obwohl man auch in Italien mit der Funktionsweise der Kirche unzufrieden war und sogar heftige Reformbemühungen unternahm, wie von 1494 bis 1498 in Florenz unter Führung des Dominikaners Girolamo Savonarola, mündete dies nicht in einer Abspaltungsbewegung, sondern lediglich in Reformen im Rahmen der alten Kirche. In Italien wurde die Reformation im Keim erstickt; das Land blieb katholisch und die Religion war dort nie ein ernsthafter politischer Streitpunkt. Im Norden dagegen rückten Kirche und Glaube in den Brennpunkt des Interesses, als sich nach 1517 herausstellte, dass Luthers scharfe Kritik an der Kirche für die Einheit der mittelalterlichen Christenheit das Ende bedeutete. Zwischen Befürwortern und Gegnern der Reformation entbrannte ein heftiger Streit, in dem auch die mittelalterliche Vergangenheit als Argument hinzugezogen wurde. Daraus resultierte keineswegs eine Bewunderung des Mittelalters, man schätzte es ungefähr so wie Petrarca und die anderen italienischen Humanisten dies taten, doch man benutzte diese Epoche, um in der Debatte die eigene Position zu untermauern.
Gewöhnlich geht man davon aus, dass die Reformatoren in der Geschichte dieselbe Dynamik sahen wie die Humanisten, eine Dreiteilung, in der auf die goldene Zeit der ersten christlichen Gemeinde ein 1000-jähriger tiefer Verfall folgte, während dem Priester und Päpste nach der Macht griffen, Aberglaube und Zauberei die Oberhand bekamen und der wahre Glaube praktisch vom Erdboden verschwand, um erst durch die Predigten der Reformatoren wieder zum Leben erweckt zu werden. Die Renaissance wäre demnach nicht nur ein Wiederaufleben der klassischen antiken Literatur, sondern zugleich auch eine Wiedergeburt der wahren Religion. Das klingt sehr reizvoll, trifft auf die Anfangszeit der Reformation aber nicht zu.
Das historische Bewusstsein der Reformatoren unterschied sich kaum von dem des Mittelalters. Seit der Geburt von Christus und der Blüte der ersten christlichen Gemeinde war es demnach nur bergab gegangen. Luther sah seine eigene Epoche nicht als Neuanfang, sondern als Ende aller Zeiten. In einem Brief aus dem Jahre 1530 schrieb er, dass alles vorbei sei, weil das Heilige Römische Reich auf dem letzten Loch pfeife und das Papsttum drauf und dran sei zusammenzubrechen. Unter Karl dem Großen habe es zwar noch ein Aufflackern gegeben, doch das sei von kurzer Dauer gewesen, etwa so wie eine Flamme noch einmal auflodert, bevor sie erlischt. Luther hoffte nur darauf, dass der jüngste Tag schnell kommen möge.20 Gerade dass er und seine Anhänger das unverfälschte Wort Gottes predigten, war für Luther ein klares Zeichen dafür, dass das Ende nahe ist. Schließlich hatte Christus prophezeit, dass kurz vor dem Ende zunächst eine Periode totalen Verfalls kommen sollte, gefolgt von einer kurzen Zeit, in der das Evangelium des Königreiches in der ganzen Welt gepredigt würde. Danach würde das Letzte Gericht abgehalten.
Auch in der ersten reformatorischen Geschichtsschreibung stach dieses Bewusstsein eines nahe bevorstehenden Endes hervor. Die Chronik Chronicon Carionis von Johannes Carion, die später von Philipp Melanchthon und Caspar Peucer vollendet wurde, stand noch ganz im Rahmen der traditionellen christlichen Geschichtsschreibung. In ihrem Werk wurde die Geschichte der Menschheit eingeteilt in den Aufstieg und den Niedergang der vier großen Reiche, die Gott nach der Prophezeiung Daniels (Dan. 2) gewollt hat. Den Kirchenvätern Hieronymus und Orosius zufolge waren das nacheinander Babylon, Persien, das Reich Alexanders des Großen und als letztes und größtes das Römische Reich. Im selben Moment, in dem Rom die Herrschaft über die Welt erlangte, wurde auch Christus geboren; und nun, da das Römische Reich seinem Ende zugehe, würde Er zurückkehren. Anzeichen dafür seien die gewaltig zugenommene Macht der Osmanen, unter der das Reich fast zusammenbreche, und, wie bei Luther, die Predigt des wahren Evangeliums nach jahrhundertelangem Abfall vom Glauben und Aberglauben.21
Das Mittelalter war bei Carion keine mittlerweile abgeschlossene Periode der Barbarei, sondern erst der Anfang einer Epoche des Verfalls, die jetzt ihren Tiefpunkt erreicht hatte. Nach der festen Überzeugung der ersten Protestanten war die eigene Zeit eine Fortsetzung des Mittelalters, nur eine Stufe schlimmer. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts verstärkte sich diese Überzeugung sogar noch, als sich herausstellte, dass die Kirche Roms keineswegs auf dem letzten Loch pfiff, sondern sich von den eingesteckten Schlägen erholte und mit der Gegenreformation sogar einer neuen Blüte entgegenging. Die Art, wie die Katholiken nun wieder Gott herausforderten, bewies um so deutlicher, dass es mit der Welt so nicht länger weitergehen konnte, und ein fürchterliches Gericht bevorstehen musste.22
Eine solche Beurteilung der eigenen Zeit ließ wenig Raum für Interesse an der Vergangenheit, trotzdem empfanden die Reformatoren, insbesondere in der zweiten und dritten Generation, ein immer stärkeres Bedürfnis, ihr Vorgehen historisch zu rechtfertigen. Vor allem wollten sie sich gegen den Vorwurf verteidigen, ihre Interpretation des christlichen Glaubens sei neu und gründe sich nicht auf einer jahrhundertealten Tradition. Ebenso wie in den vorangegangenen Jahrhunderten blieb „neu“ im 16. Jahrhundert ein Schimpfwort. Auch Humanisten wie Petrarca und Erasmus wollten ja nichts Neues, sondern nur die Erneuerung des in Vergessenheit geratenen Erbe Roms. In derselben Richtung argumentierten auch die reformatorischen Geschichtsschreiber: Sie wollten nachweisen, dass in der Reformation nichts anderes geschehen war, als eine Erneuerung der reinen Predigt von Gottes Wort, ein Rückgriff auf das, was Christus selbst, seine ersten Jünger und die Kirchenväter gepredigt hatten.
Obwohl das Studium der Bibel theoretisch ausreichen sollte, um das wahre Wort Gottes zu finden, verletzte es die Protestanten, dass die Katholiken ihnen vorwarfen, ihre Lehre sei neu und müsse allein deshalb schon ketzerisch sein. Um die Haltlosigkeit dieser Anschuldigungen zu beweisen, taten die protestantischen Historiker etwas Merkwürdiges: Sie übernahmen die Beweisführung ihrer katholischen Gegner, um sie anschließend umzudrehen. Meisterhaft geschah dies in der ersten protestantischen Kirchengeschichte, den dreizehnbändigen Magdeburger Centurien (1559–1574), zusammengestellt von einer Kommission unter der Leitung von Matthias Flacius Illyricus. Nach der katholischen Argumentation – in der Einleitung der Centurien fasste Flacius sie selbst zusammen – war die Kontinuität der Kirche, und zwar hier die ununterbrochene Folge von Päpsten und Bischöfen, die sogenannte apostolische Sukzession, der beste Beweis dafür, dass im 16. Jahrhundert dieselbe Wahrheit verkündet wurde wie zur Zeit Christi und seiner Apostel.23
Diese Kontinuität konnten Flacius und andere Protestanten nicht leugnen, sie konnten hier nur ansetzen. Zunächst wiesen sie nach, dass diese Kontinuität nur eine Aneinanderreihung von Lug und Trug war, eine sich unaufhaltsam verschlimmernde Entartung von Kirche und Papsttum. Doch unter dieser ganzen Verdorbenheit erkannten sie auch eine Kontinuität der Wahrheit. Nie war das Licht des Evangeliums ganz erloschen: Immer wieder hat es in jeder Generation einige gegeben, die die Fackel weitergereicht haben, bis die Wahrheit in Luthers Zeit wieder öffentlich gepredigt werden konnte.24
Flacius meinte, es sei Aufgabe des Historikers nachzuweisen, dass Gott sein Volk in all den Jahren nie verworfen habe. Stattdessen habe es immer eine kleine Gruppe Getreuer gegeben, die dem schändlichen Wucher nicht nur in Wort und Schrift widerstanden, sondern auch bereit waren, mit ihrem Blut von der Wahrheit Zeugnis abzulegen.25 Diese Zeugen waren eben diejenigen, die von der katholischen Kirche als Ketzer verurteilt worden waren: Im 11. Jahrhundert Berengar von Tours mit seiner Auslegung des Abendmahls, im 12. Jahrhundert Pierre Valdès und seine „Armen von Lyon“, die die Priesterkirche verworfen und ihr Leben der Predigt geweiht hatten, sowie um 1400 als unmittelbare Vorläufer der Reformation John Wycliffe, der die Bibel ins Englische übersetzt hatte, und Jan Hus aus Böhmen, der 1415 auf dem Scheiterhaufen für die Wahrheit starb. In dieser Polemik war die Geschichte des Mittelalters also von großem Interesse, weil sie zeigte, dass es zwischen den Tagen der Urgemeinde und der Reformation einen stetigen Strom an Wahrheitssuchenden gegeben hat, die sich gegen die herrschende Kirche zur Wehr gesetzt haben. Darum verkündete Luther nun gar nichts Neues, sondern predigte lediglich öffentlich, was bereits seit Jahrhunderten im Verborgenen überliefert worden war.
Interesse am Mittelalter gab es, wie gesagt, auch in katholischen Kreisen. Auch hier ging es darum, die Kontinuität zwischen der Urkirche und der zeitgenössischen Kirche zu belegen, und dafür war es nötig, das Mittelalter unter die Lupe zu nehmen. Doch während die Protestanten die Kontinuität der wahren Lehre hervorhoben, betonten die Katholiken die Kontinuität des apostolischen Amtes, vor allem das des Papstes als Nachfolger von Petrus.26 Das zeigte sich zunächst im zwölfbändigen Wälzer des Kardinals Cesare Baronio, den Annales Ecclesiastici (1588–1607), die ausdrücklich als Antwort auf Flacius und die Centurien gedacht waren. Mit der Lehre beschäftigte sich Baronio erst gar nicht, sondern beschränkte sich darauf, institutionelle Dokumente aus der Antike und dem Mittelalter zu sammeln und über die Kirchenstruktur zu polemisieren.27 Das Neue an Baronios Werk war, dass er sich als echter Humanist nicht mehr mit überlieferten Geschichten begnügte, sondern die Archive des Vatikans durchforstete, um anhand authentischer Dokumente den Rechtsanspruch des Papstes und der katholische Kirche zu beweisen.
Derselbe Respekt vor Dokumenten beseelte auch die kleine Gruppe von Jesuiten, die 20 Jahre später unter der Führung von Jean Bolland und Godefridus Henschenius (Henschen) die Initiative ergriff, eine kritische Ausgabe der Heiligenleben herauszubringen. Das Ergebnis war die berühmte Quellenreihe Acta Sanctorum, deren erste vier Bände 1643 erschienen, und in der alle Heiligen in der Reihenfolge ihrer Gedenktage im Kalender behandelt wurden.28 Diese Ausgabe verursachte einige Unruhe, weil sich rasch herausstellte, dass die meisten alten Heiligengeschichten keiner historischen Kritik standhielten und manche liebgewordenen Heiligen sogar nie existiert hatten. Zum Beispiel gab es den ehrwürdigen Orden der Karmeliten, den der Prophet Elija der Sage nach im 8. Jahrhundert vor Christus auf dem Berg Karmel in Palästina gegründet hatte. Die Bollandisten bewiesen eindeutig, dass der Ursprung des Ordens in Wirklichkeit ziemlich obskur war und in die Zeit der Kreuzüge verwiesen werden musste. Das einzige, was die Bettelmönche mit Elija verband, war die Tatsache, dass beide irgendwann etwas mit dem Berg Karmel zu tun gehabt hatten, allerdings mit einem zeitlichen Abstand von etwa 2000 Jahren. Dies führte zu großem Ärger mit der Inquisition und es dauerte 20 Jahre, bis eine Lösung gefunden worden war.29
In Frankreich bildete sich im 17. Jahrhundert eine ganz ähnliche Initiative. In Paris versammelte sich eine Gruppe gelehrter Benediktiner in der Abtei Saint-Germain-des-Prés und begann, Dokumente zu sammeln, anfangs vor allem solche mit einem Bezug zur Geschichte ihres eigenen Ordens, später aber auch solche zur religiösen wie weltlichen Geschichte ganz Frankreichs. Der angesehenste Gelehrte dieser Gruppe war Jean Mabillon, berühmt vor allem durch seine Abhandlung De re diplomatica aus dem Jahre 1681, in der er die Grundlagen für eine wissenschaftliche Quellenkritik gelegt hatte.30 Viele Quellenausgaben dieser Gruppe sind so hervorragend, dass auch heute kaum Anlass besteht, sie zu überprüfen, und deshalb sind sie immer noch unersetzlich für jeden, der sich mit mittelalterlicher Geschichte beschäftigt.
Sowohl die Arbeit dieser Benediktiner als auch die der Bollandisten hat viel zu unserem Wissen über das Mittelalter beigesteuert, vor allem durch die Erschließung neuer Quellen. Ihre Publikationen gaben diese gelehrten Mönche jedoch nicht heraus, weil das Mittelalter sie als Epoche faszinierte oder weil sie darin ein Vorbild für ihre eigene Zeit sahen. Sie wollten die katholische Vergangenheit von frommen Geschichten und Legenden befreien, um so die Wahrheit des Glaubens noch triumphierender erstrahlen zu lassen. Auf diese Weise konnten sie unablässig darauf pochen, dass sich einzig und allein die römischkatholische Kirche durch all die Jahrhunderte seit Christus nie verändert hatte. Jacques-Bénigne Bossuet, Bischof von Meaux, Vertrauter Ludwigs XIV. und Erzieher des französischen Thronfolgers Ludwig, besser bekannt als Le Grand Dauphin, hat diese Einstellung eindringlich beschrieben. Mit Interesse verfolgte Bossuet die Arbeit der Benediktiner von Saint-Germain. Viele ihrer Veröffentlichungen standen in seiner Bibliothek und er verwendete ihre Ergebnisse wiederholt in seinen eigenen Büchern, wenn auch meist ohne Quellenangaben.31 In seiner Studie über die neuere Geschichte der protestantischen Kirchen, Histoire des variations des églises protestantes (1688), widmete er so einen ganzen Band den Waldensern und den Katharern. Dies waren zwei mittelalterliche Sekten, die die Protestanten als ihre Vorläufer betrachteten.
Genüsslich veranschaulichte Bossuet, dass diese beiden Gruppen Lehren verkündet hatten, die den Ansichten des Protestantismus widersprechen. Ebenso wie die Manichäer, die schon Augustinus von Hippo bekämpft hatte, glaubten die Katharer an eine vollkommene Trennung von Körper und Geist, während die Waldenser, die Anhänger von Valdès, zum Sakrament der Eucharistie dieselben Ansichten vertraten wie die Katholiken.32 Die Protestanten mussten die Geschichte dieser beiden Gruppen verfälschen, um behaupten zu können, es handele sich dabei um Vorläufer. Anscheinend brauchten sie diesen mageren Trost.33 Die katholische Kirche kam ohne solche Verdrehungen der Wahrheit aus, weil sie immer nur lehrte, was sie empfangen hatte, ohne daran je etwas zu verändern.34
Dies war tatsächlich das einzige, was Bossuet am Mittelalter interessant fand, nämlich dass sich in diesen 1000 Jahren an den Überlieferungen der alten Kirche nichts verändert hatte. Ansonsten verachtete er diese Epoche, so wie jeder humanistisch Gebildete. Obwohl die Kirche ihre Lehre rein bewahrt hatte, hatten die Christen im Mittelalter nicht nach ihr gelebt, und dadurch waren sie mitverantwortlich für die Katastrophe der Reformation. Auch die mittelalterlichen Päpste schätzte Bossuet nicht besonders: Sie hatten sich viel zu sehr mit Politik beschäftigt, statt sich weise auf ihre geistliche Aufgabe zu beschränken, ein Vorwurf, den Voltaire 100 Jahre später übernahm.35 Auf der Suche nach inspirierenden Vorbildern sollten die Katholiken lieber das Zeitalter der Kirchenväter studieren und sich in die Schriften des Augustinus oder des Ambrosius von Mailand vertiefen, statt sich mit dem Mittelalter zu beschäftigen. Bossuets Haltung war typisch für die Mehrheit der gebildeten Katholiken: Das Mittelalter bildete unbestreitbar einen Teil der Kirchengeschichte, allerdings keinen, mit dem man sich gern beschäftigte. Im Gegenteil, ein wichtiger Teil im Programm der Gegenreformation bestand ja gerade darin, alle Missbräuche, die sich im Laufe des Mittelalters ins Kirchenleben eingeschlichen hatten, wieder auszumerzen und zur Reinheit des christlichen Altertums zurückzukehren. In diesem Sinne stimmte die Einschätzung des Mittelalters sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten ziemlich genau überein, nur dass die Protestanten daraus viel radikalere Schlüsse zogen.