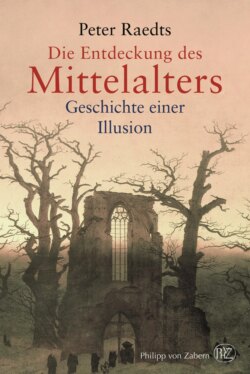Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Römer, Gallier und Franken
ОглавлениеIn Frankreich war es im 16. Jahrhundert nicht einfach, die Spannung zwischen der Bewunderung der Antike und dem Stolz auf das eigene Vaterland zu überbrücken. Selbst die eingefleischtesten Verfechter der Monarchie konnten schwer behaupten, dass die Herrschaft der französischen Könige auf die der römischen Kaiser zurückgehe. Auch wenn einige schlaue Juristen gerade dies versuchten und dazu das Argument heranzogen, der französische König sei Kaiser in seinem eigenen Reich. Damit das auch Hand und Fuß hatte, wurde Karl der Große in Frankreich verehrt, und zwar mindestens ebenso sehr wie in Deutschland. Charlemagne, wie sein französischer Name lautet, galt als der größte aller französischen (eigentlich fränkischen) Könige. Und weil in ihm das Kaisertum wiedererstanden war, strahlte etwas von diesem Ruhm auch auf die französischen Könige der folgenden Generationen ab. Natürlich hielt das den Vergleich mit dem Anspruch des heiligen römischen Kaisers in Deutschland nicht stand, auch wenn Jean Bodin in seiner Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Methode zum leichten Verständnis der Geschichte; 1566) unumstößlich bewies, dass die Lehre von den vier Weltreichen historischer Unsinn war.50 Eine andere Methode, die französische Monarchie in der klassischen Antike zu verankern, war die Behauptung, dass die französischen Könige von den Trojanern abstammen. Doch auch diesem Versuch wurde im 16. Jahrhundert jede Grundlage entzogen, obwohl diese Legende unter einigen unkritischen Anhängern der Monarchie noch bis ins 17. Jahrhundert hinein die Runde machte.51 Die übliche Methode, die Kontinuität und das hohe Alter des französischen Königtums zu belegen, bestand darin, die Antike beiseite zu schieben und mit dem Einfall der Franken Ende des 5. Jahrhunderts zu beginnen. Der Überlieferung nach hatten von dieser Zeit an drei Geschlechter über Frankreich regiert: Angefangen mit Chlodwig, dem Stammvater der Merowinger, getauft um 496 in der Kathedrale von Reims, in der später alle französischen Könige gekrönt wurden, gefolgt von den Karolingern seit der Machtergreifung Pippins des Kurzen im Jahre 751 und schließlich den Kapetingern, die seit der Thronbesteigung von Hugo Capet im Jahre 987 regierten.52
Dies war natürlich keine befriedigende Lösung in einer Zeit, in der man das Heute vor allem in der antiken Vergangenheit verankern wollte. Darum nahmen die französischen Humanisten Zuflucht zur selben List, die ihre deutschen Kollegen bereits angewandt hatten: Sie suchten in der antiken Literatur nach möglichen Vorfahren der heutigen Franzosen und fanden sie auch in De Bello Gallico (Über den Gallischen Krieg) von Julius Cäsar. Gallier, keltische Stämme, hatten zur Zeit der römischen Eroberung das Gebiet des heutigen Frankreichs bewohnt. Diese Entdeckung brachte einige Probleme mit sich. Im Gegensatz zu den Germanen, die Tacitus wegen ihrer Tapferkeit und Tugend in den Himmel gelobt hatte, gehörten die Gallier zweifelsfrei zu den Verlierern der Geschichte. Jeder kannte die Beschreibung der Niederlage des Vercingetorix. Dieser Anführer des gallischen Widerstandes gegen die Römer musste seine Waffen nach der Belagerung von Alesia im Jahre 52 v. Chr. dem triumphierenden Cäsar zu Füßen legen. Darüber hinaus hatten die Gallier 500 Jahre später auch noch eine schmähliche Niederlage gegen die Franken erlitten, durch die sie endgültig zu Hörigen auf den Landgütern ihrer germanischen Herren wurden. Wie Guillaume du Bellay in seiner Épitome de l’antiquité des Gaules et de France (1556) zugeben musste, hatten die Gallier tatsächlich gegen die Römer verloren, zugleich verwies du Bellay jedoch auf ihre Freiheitsliebe, die so groß war, dass viele von ihnen lieber Selbstmord begingen, als sich unter das römische Joch zu beugen. Dadurch konnten sie ihren heutigen, freiheitsliebenden Nachfahren immer noch als Vorbild dienen.53
Mit der Niederlage gegen die Franken verhielt es sich weitaus schwieriger. Die französischen Könige galten als Nachfolger des Frankenkönigs Chlodwig. Musste man hieraus schließen, dass 1000 Jahre lang fremde Tyrannen das französische Volk regiert hatten? Zu dieser Schlussfolgerung kam man tatsächlich im späten 18. Jahrhundert, doch im 16. Jahrhundert war sie noch undenkbar. Der furchtbare Religionskrieg, der Frankreich nach 1560 erfasste, ließ eine so aufwieglerische Formulierung nicht zu. Ganz im Gegenteil suchten überall in Frankreich gerade die engagiertesten Intellektuellen, les politiques, nach einem Weg, die kämpfenden Parteien miteinander zu versöhnen, und vermieden es, die Autorität des Königs in ein schlechtes Licht zu stellen, weil das die Unruhe nur vergrößert hätte. Sie bemühten sich also, den Gegensatz zwischen Franken und Galliern möglichst zu verringern, am besten ganz aufzuheben, und stattdessen zu belegen, dass Frankreich in der Vergangenheit eine Einheit gewesen sei und nun wieder eine werden solle.
Hierzu ging Jean Bodin davon aus, dass die Franken Kelten waren, die in einer früheren Phase der Geschichte nach Osten ausgewandert und im 5. Jahrhundert zurückgekehrt waren, um ihren gallischen Brüdern nach dem Abzug der Römer militärischen Beistand zu leisten. Der Calvinist François Hotman, dessen Bild von der französischen Vergangenheit vom Massaker an den Protestanten in der Bartholomäusnacht vom 23. auf den 24. August 1572 geprägt war, wollte in seiner Franco-Gallia (1574) belegen, dass Frankreich im Laufe seiner langen Geschichte nur in Zeiten mit einer eingeschränkten Monarchie einig und stark gewesen sei. Bis zur römischen Eroberung hatten die alten gallischen Stämme ihre Könige gewählt und sie jedes Jahr im Stammesrat zur Verantwortung gezogen. Unter der römischen Zwangsherrschaft verschwand diese Freiheit, wurde aber von den Franken wieder eingeführt, die sich ebenfalls von jeher als freie Männer um ihren gewählten König geschart hatten. In ihrer Freiheitsliebe und ihrer Ablehnung der römischen Tyrannei fanden diese beiden Gruppen zusammen.54 Leider gelangte Frankreich im 16. Jahrhundert wieder unter den Einfluss des römischen Rechts und verlor dadurch seine Neigung zur gallisch-fränkischen Freiheit. Hotmans Meinung nach hieß es also Barbaren gegen Römer, nicht Germanen gegen Kelten. Der letztere Gegensatz wurde erst im 18. Jahrhundert wieder aufgegriffen, als sich die Franken gegen die absolute Monarchie erhoben.
In seinem Buch sprach Hotman noch ein weitaus größeres Problem an, das in Frankreich im Laufe des 16. Jahrhunderts sehr viele Menschen beschäftigt hat. Nämlich ob die klassische Antike wirklich in jeder Beziehung als Vorbild für die Gegenwart dienen kann, eine Frage, die sich die Deutschen erst im 18. Jahrhundert stellten. Es sah sogar so aus, als sei eine Rückkehr zur Antike unvereinbar mit den tatsächlichen Interessen des französischen Staates. Die absolute Monarchie, die dem römischen Kaisertum nachgebildet war, führte zur Ermordung aller, die nicht der Konfession des Königs anhingen. Doch auch das vielgepriesene römische Verwaltungsrecht schien in immer größerem Widerspruch zur juristischen Wirklichkeit zu stehen. Die französischen Rechtshistoriker des 16. Jahrhunderts waren mit dem praktischen Problem konfrontiert, dass in Südfrankreich das geschriebene Recht galt, im Norden hingegen das mittelalterliche Gewohnheitsrecht. Allein schon dieser Unterschied zwang sie, beide zu untersuchen. Als wahre Humanisten zogen sie das römische Recht vor und wollten bis zu seinen Quellen vordringen, in der festen Überzeugung, man müsse nur die reinen Texte freilegen, dann würde sich die Relevanz dieses Rechts für die Gegenwart und zugleich die Rückständigkeit des Gewohnheitsrechts von selbst ergeben. Stattdessen entdeckten sie jedoch, dass der Codex Justinianus, die Grundlage für jedes Studium der Rechte, überhaupt nicht der juristische Blaudruck der idealen Gesellschaft war, für den man ihn immer gehalten hatte, sondern ein ziemlich buntes Sammelsurium aller möglichen Gesetze und Vorschriften aus unterschiedlichen Epochen der römischen Geschichte.
Auch hier war es Hotman, der nachwies, dass Rom nicht als Vorbild dienen konnte: „Justinians Bücher enthalten weder vom demokratischen Staat, noch vom wahren Römischen Reich oder von Konstantinopel irgend eine vollständige Beschreibung, statt dessen sind sie lediglich ein Sammelsurium verschiedener Bruchstücke und Fragmente aller drei.“55 Nur durch verdrehte Interpretationen gelang es, diese Bruchstücke für die juristischen Probleme der eigenen Gesellschaft relevant zu machen. Allerdings war das eine unangemessene Methode, von den französischen Juristen abschätzig verworfen als mos italicus, die italienische Gewohnheit – mit anderen Worten schlecht. Sie selbst behandelten die römische Gesetzgebung nicht länger als großes Ganzes, sondern versuchten, die einzelnen Teile in den Kontext ihrer Entstehung zu stellen. Dadurch verlor ein großer Teil des römischen Rechts seine Relevanz; schließlich ist es ja in einer Zeit entstanden, in der Rom eine Republik oder ein heidnisches Kaiserreich war. Frankreich war hingegen eine christliche Monarchie. Die unvermeidliche Schlussfolgerung war, dass große Teile des römischen Rechts für Frankreich eher geringe Bedeutung besaßen, während das mittelalterliche Gewohnheitsrecht weitaus bessere Antworten auf die reale Situation in Frankreich lieferte als das justinianische Recht.56
Ein schönes Beispiel für diesen Gesinnungswandel war die Frage nach dem Ursprung des Feudalismus. Hier handelte es sich nicht um ein rein theoretisches Problem, sondern um eine Frage von höchster politischer Tragweite: Bis 1650 war, abgesehen von der Religion, die Beziehung zwischen König und Adel das brisanteste Problem des französischen Staates. Erst unter den Regierungen der Kardinäle Richelieu und Mazarin, der Ersten Minister Ludwigs XIII., wurde der französische Adel wirksam der Kontrolle der Zentralverwaltung unterworfen. Die juristische Diskussion konzentrierte sich auf die Libri feudorum, eine Sammlung rechtlicher Regeln zum Lehnswesen, die man in Italien um 1200 in den Korpus des römischen Zivilrechts aufgenommen hatte. Die Frage war nun, ob dieses Regelwerk des Feudalismus römischen Ursprungs war oder nicht. Konnte man sie zustimmend beantworten, hatte man die Relevanz und den einzigartigen Wert des römischen Rechts für alle Zeiten bewiesen. Doch sollte sich herausstellen, dass die Römer den Feudalismus gar nicht gekannt hatten, würde dies die Bedeutung des römischen Rechts gewaltig relativieren.
Guillaume Budé, einer der ersten französischen Juristen, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat, neigte dazu, die Beziehung zwischen Patron und Klienten in der römischen Gesellschaft als eine Vorstufe des Treuebandes zwischen Lehnsherr und Lehnsmann zu betrachten.57 Andere verteidigten den römischen Ursprung der Libri feudorum mit dem philologischen Argument, das Wort feodum (Lehen) stamme direkt von den antiken Begriffen fides und fidelitas (Treue und Treuepflicht) ab. Ein oft hinzugezogener Beleg war auch der Hinweis in den Libri, dass die darin aufgenommenen Gesetze auf das allerälteste Recht (jus antiquissimum) zurückgingen. Welches sollte das sein, wenn nicht das römische? Gegen einen römischen Ursprung der Libri feudorum sprach zunächst einmal die Sprache, die so barbarisch war, dass sie nicht römisch sein konnte. Ein starkes Argument, für das alle Humanisten sehr empfänglich waren. Charles Dumoulin baute das Sprachargument weiter aus und zeigte auf, dass Wörter wie „Lehen“ oder „Vasall“ im römischen Recht nirgendwo vorkommen. So kam er zu der Schlussfolgerung, dass man den Ursprung des Lehnswesens in der Tradition der alten Franken suchen muss, von denen die heutigen Franzosen abstammen. Mit anderen Worten war das Lehnswesen rein französischen Ursprungs und konnte nur über das französische Gewohnheitsrecht untersucht werden, nicht über das römische, das nur Verwirrung gestiftet hat. Ebenso wie über den Ursprung des Feudalismus kam es zu hitzigen Debatten über die Stellung des Königs und den Rang der Kirche in Frankreich. Egal welchen politischen Standpunkt sie sonst einnahmen, als sich die Juristen mit diesen Fragen beschäftigten, wurde ihnen ebenfalls rasch klar, dass sie die Grundlagen dafür nicht im antiken römischen Recht, sondern in der mittelalterlichen Rechtspraxis auf eigenem Boden suchen mussten.
Noch viel größer als das Prestige des römischen Rechts war die Bewunderung der klassischen Literatur. Im 16. Jahrhundert waren sich in Frankreich alle darin einig, dass nichts und niemand an die Sprachgewalt von Cicero, Vergil, Tacitus, Livius und all der anderen antiken Autoren heranreichen kann. Auch jemand, der auf Französisch schrieb, sollte sich möglichst eng an die antiken Vorbilder halten, sowohl inhaltlich als auch stilistisch. Der Dichter Pierre de Ronsard, der die Leistung vollbracht hatte, die ganze Ilias in nur drei Tagen auf Griechisch zu lesen, konnte in einem seiner Gedichte erklären, dass alle Franzosen, die seine Gedichte verstehen wollten, zugleich auch Griechen und Römer sein müssten, weil sie sonst nur ein totgeborenes Kind in Händen hielten.58 Zugleich wurde die mittelalterliche französische Literatur maßlos verachtet. François Rabelais sprach von den unglücklichen, unseligen Goten, die jede gute Literatur vernichtet haben.59
Im 17. Jahrhundert änderte sich dieses Verdikt nicht. Nicolas Boileau stellte in seiner Art poétique (1674) einen Katechismus des guten Geschmacks zusammen, der bis weit über Frankreichs Grenzen hinaus großen Einfluss ausübte. Darin bestimmte er, dass sich jede gute Literatur am Vorbild der antiken Klassiker orientieren sollte. Und gemessen an diesem Kriterium könne man vor dem Dichter François Villon, der im 15. Jahrhundert zum ersten Mal Ordnung in das mittelalterliche Chaos gebrachte hat, nicht von französischer Literatur sprechen.60
Daneben gab es in Frankreich jedoch auch eine Unterströmung, bei der die mittelalterliche französische Literatur Anklang fand, natürlich nicht in den tonangebenden Pariser Kreisen, in denen der Klassizismus übermächtig war und bis ins 18. Jahrhundert hinein auch blieb. Doch in der Provinz blieben die großen Geschichten aus dem Mittelalter auf einem etwas niedrigeren Niveau äußerst populär. Hier bildeten sie weiterhin die Grundlage für eine Weltanschauung, die vom Klassizismus der intellektuellen Oberschicht anscheinend nicht besonders beeinflusst wurde. Dies zeigt unter anderem der Erfolg der Bibliothèque bleue, einer Reihe kleiner, billiger Bücher, die seit dem späten 16. Jahrhundert von Troyes – nicht von Paris – aus über ganz Frankreich verbreitet wurden. In diesen broschierten Schriften offenbart sich eine Welt von Zwergen und Riesen, Mönchen und Einsiedlern, Rittern und Kreuzfahrern, die sich in nichts von der Vorstellungswelt des Mittelalters unterschied. Besonders beliebt waren Ausgaben alter Geschichten über Karl den Großen und seine Paladine Roland, Huon und Ganelon sowie über die Kreuzzüge als Höhepunkt im ewigen Kampf der Christenheit gegen die Heiden.61
Auch in höheren Kreisen war entgegen aller rigorosen Forderungen des Klassizismus ein erstes, zögerliches Interesse an der französischen Literatur des Mittelalters zu erkennen. Hier läge die Annahme auf der Hand, das fortbestehende Interesse des lesenden Teils der Bevölkerung an diesen fernen Jahrhunderten habe die intellektuelle Elite unwillkürlich beeinflusst, wahrscheinlicher ist jedoch, dass dies eher etwas mit dem Stolz auf König und Vaterland zu tun hatte. Dieser verlangte nämlich, dass die ganze französische Vergangenheit ruhmreich sein müsse, nicht nur ein Teil davon. Wenn die französische Literatur tatsächlich erst mit Villon angefangen hätte, wie Boileau behauptete, würde dies zugleich bedeuten, dass sich große Fürsten wie Philipp II. August und Ludwig der Heilige in einem barbarischen Jargon ausgedrückt haben, was ihre Ehre beflecken würde.
Der Jurist Etienne Pasquier, der so viel geleistet hat, um das alte französische Recht zu bewahren und zu veröffentlichen, hat sich auch mit der mittelalterlichen Literatur beschäftigt. Zwar beurteilte er sie viel zurückhaltender als das Recht, dennoch schätzte er sie in gewisser Weise. Auch er bezeichnete das mittelalterliche Latein durchweg als barbarisch und ließ als einzige Ausnahme nur Einhard, den Biographen Karls des Großen, gelten. Selbst das lag vielleicht mehr an Karls Größe als an der Reinheit von Einhards Sprache. Für das Französisch seiner eigenen Zeit, des 16. Jahrhunderts, hatte Pasquier nur Lob übrig, obwohl er zugeben musste, dass es unmöglich war, mit der Sprache der antiken Autoren gleichzuziehen. Daneben lobte er jedoch auch die französische Sprache und Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts. Er sprach sogar von einer Blütezeit der Literatur in den Tagen Philipp Augusts und Ludwigs des Heiligen. Trotzdem musste Pasquier zugeben, dass das Niveau damals bedeutend niedriger war als zu seiner Zeit, weshalb es ihn große Mühe gekostet hatte, diese alten Geschichten zu übersetzen.62 Im Gegensatz zu den meisten Zeitgenossen betrachtete er die mittelalterliche Literatur nicht als Antithese zur modernen Dichtkunst, sondern als ihren Vorläufer.
Diese schwache Strömung gegen den vorherrschenden Trend wurde im 17. Jahrhundert von Jean Chapelain fortgesetzt. Obwohl man ihn mit Boileau zu den großen Wortführern des Klassizismus rechnen muss, entwickelte Chapelain nebenbei ein überraschendes Interesse an der mittelalterlichen Literatur. In einem Brief an einen Kollegen gab er zu, er habe den großen Lancelot-Roman durchgeackert und schließlich festgestellt, dass er diese Erfahrung als nicht einmal allzu unangenehm empfunden hätte.63 Anscheinend hatte dies sein Interesse am Mittelalter so sehr geweckt, dass er eine kurze Abhandlung über alte Geschichten schrieb, De la lecture des vieux romans (Von der Lektüre alter Romane; um 1647), in der er erläuterte, wie man an alte französische Literatur herangehen sollte. Natürlich kann er nicht umhin, den alten Lancelot-Roman mit den antiken Klassikern zu vergleichen. Dieser Vergleich fällt alles andere als vorteilhaft aus: Der Autor des Romans ist ein Barbar, der die verrücktesten Wundergeschichten erzählt und anscheinend außerstande ist, eine klare Linie in seine Erzählung zu bringen. Insofern wiederholt Chapelain die üblichen Ansichten seiner Zeit. Doch dann geht er einen Schritt weiter und vergleicht den Lancelot-Roman mit Homers Werk. Dabei stellt er fest, dass zwischen Helden wie Achill und Lancelot gar kein so großer Unterschied herrscht. Ebenso wie die in der Ilias und der Odyssee aufgezeichneten Mythen, Fabeln und Göttergeschichten die Grundlage für die spätere griechisch-römische Kultur bilden, wurden die primitiven Geschichten im Lancelot-Roman zur Grundlage für die spätere Blüte der französischen Literatur. Chapelain leugnet also nicht den barbarischen Charakter der mittelalterlichen Literatur und stößt sich dabei vor allem an der Sprache. Doch durch den Hinweis darauf, dass auch die antike Kultur ein ähnlich primitives Stadium durchlaufen habe, rechtfertigt er sein Interesse an dieser frühesten Epoche von Frankreichs Größe, die er keineswegs ausklammert, sondern auf die er sich beruft, indem er sie unsere moderne Antike nennt.64 Dadurch wird die mittelalterliche französische Literatur zu einem unumstößlichen Bestandteil von Frankreichs Erbe, ebenso wie die antike Kultur ohne Homer undenkbar wäre. Im 18. Jahrhundert sollte Thomas Blackwell denselben Kunstgriff auch in England anwenden.
Dennoch bildeten Pasquier und Chapelain selbst mit ihrer sehr zurückhaltenden Würdigung der mittelalterlichen Literatur eine Ausnahme. Ein ästhetisches Interesse an der mittelalterlichen Literatur konnte erst entstehen, als die selbstverständliche Überlegenheit des Klassizismus in den Jahren um 1700 zum ersten Mal vorsichtig in Frage gestellt wurde. Dass dies geschehen konnte, hatte zwei Ursachen. Zunächst hatte man im 17. Jahrhundert auf dem Gebiet der Naturwissenschaften gewaltige Fortschritte erzielt. Die revolutionären Forschungsergebnisse großer Gelehrter wie Galileo Galilei und Isaac Newton hatten die Vorherrschaft von Aristoteles und Claudius Ptolemäus auf dem Gebiet der Naturphilosophie und Astronomie abrupt beendet. Und dadurch stellte sich gleich die Frage, ob die antiken Autoren auch in anderen Punkten die ihnen bis dahin eingeräumte Autorität und Bewunderung eigentlich verdienten. Darüber entbrannte vor allem unter französischen Intellektuellen ein heftiger Streit, der als die Querelle des Anciens et des Modernes (Streit der Alten und der Modernen) in die Geschichte einging. Obwohl der Ausgang dieses Streits keineswegs bedeutete, dass die antiken Autoren von nun an ihre Autorität verloren hatten – die Lektüreliste in den Schulen änderte sich nicht – wurde es in der Folge möglich, andere Epochen und Kulturen zu betrachten, ohne die Messlatte der Antike anzulegen.65
Darüber hinaus entstand Anfang des 18. Jahrhunderts allmählich ein kulturelles Unbehagen, das an den 200 Jahre zurückliegenden Zwist der Humanisten mit der mittelalterlichen Scholastik erinnert. Nach Ansicht vieler war die Kultur mittlerweile zu kompliziert und künstlich geworden, sowohl in ihren Sitten und Umgangsformen als auch in der Literatur. Die Menschen sollten sich von diesen Konventionen befreien und zu einer einfacheren, spontaneren literarischen Gestaltung zurückkehren, die dem Gefühl größere Aufmerksamkeit zollt und von den vielen Regeln des Klassizismus unbelastet ist. Dafür konnte die mittelalterliche Literatur als Vorbild dienen, weil sie längst nicht so vielen Regeln unterworfen war und dadurch viel unkonventioneller wirkte.
Ein Gelehrter wie der Abbé Claude Goujet, der sich eingehend mit dem Mittelalter, und zwar vor allem mit der angeblich finstersten Zeit, dem 10. Jahrhundert, beschäftigt hatte, kam zu der Ansicht, dass man die Literatur dieser Zeit schon immer unterschätzt hätte und bei näherer Betrachtung viel Wertvolles darin entdecken könnte. In seiner Bibliothèque Française (1745) schreibt er, dass er in der altfranzösischen Poesie „eine Zärtlichkeit der Gefühle“ und „eine Feinfühligkeit des Denkens“ fand, die man vor allem der Naivität und Schlichtheit der damaligen Menschen zu verdanken habe. Hierin war Etienne de Barbazan einer Meinung mit Goujet: Das Mittelalter verdiene unsere große Bewunderung, weil, wie er es in den Fabliaux et contes françois (1756) ausdrückt, die Menschen damals einfacher und nicht so schlecht wie jetzt waren.66
Sich in die mittelalterliche Literatur zu vertiefen war nützlich, darum musste man sie veröffentlichen. Am meisten hat Jean-Baptiste de la Curne de Sainte-Palaye dazu beigetragen, der vor allem durch seine aktive Mitgliedschaft in der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres einen gewaltigen Anstoß zum Studium der altfranzösischen Sprache und Literatur gegeben hat. Bekanntheit erlangte er beim großen Publikum vor allem durch seine Bücher über Ritter und Rittertum sowie über die provenzalischen Troubadoure, den beiden Milieus, die die meiste altfranzösische Literatur hervorgebracht hatten.67 Beide Werke waren im 18. Jahrhundert enorm erfolgreich und trugen erheblich dazu bei, dass man begann, das Ideal der Ritterschaft zu kultivieren.
Dennoch unterschied sich dieses wachsende Interesse am Mittelalter grundlegend von dem in der späteren Romantik. Es war völlig unverbindlich und spielerisch, ohne die tiefe Sehnsucht nach einer verlorenen Zeit, die für die romantische Verherrlichung des Mittelalters so typisch werden sollte. Darüber hinaus stand es im weiter gefassten Rahmen der Bewunderung für alles Primitive und Einfache, die einerseits als Kritik an den herrschenden Sitten und Gebräuchen fungierte, andererseits aber auch nicht allzu ernst genommen wurde. So wie Königin Marie-Antoinette im Park von Versailles einen Bauernhof errichten ließ, in dem sie mit ihren Hofdamen Hirtin spielte, um für kurze Zeit den vielen Konventionen des Hoflebens zu entrinnen, so ergötzten sich ihre weniger privilegierten Untertanen zur Entspannung an der Schlichtheit und Unmittelbarkeit des mittelalterlichen Lebens und der mittelalterlichen Literatur. Wie locker man letztere nahm, erkennt man unter anderem daran, dass man es für die normalste Sache der Welt hielt, die mittelalterlichen Geschichten zu bearbeiten und nachzuerzählen, weil die Originale als viel zu schwierig und praktisch unlesbar galten. Auf derselben Ebene spielte sich das Interesse an exotischen Ländern wie China oder dem Orient ab. Man las viel darüber und benutzte sie auch, um die eigene Kultur ein wenig zu relativieren und leichten Spott damit zu treiben (Montesquieus Lettres persanes aus dem Jahre 1721 ist dafür ein gutes Beispiel), doch letztendlich blieb davon kaum mehr übrig als hier und da ein chinesischer Salon oder eine Oper wie Mozarts Entführung aus dem Serail.68