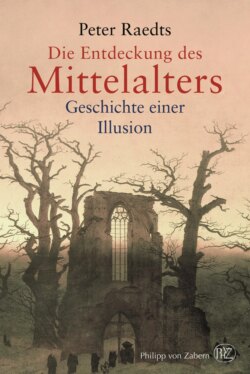Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеDer Ursprung dieses Buches liegt in Oxford. Hier begann ich im Herbst 1978 mit meinem Promotionsstudium. Für Oxford hatte ich mich nicht etwa deshalb entschieden, weil diese Universität als Centre of excellence hoch oben in den internationalen Ranglisten stand, falls es solche Listen damals überhaupt schon gab. Der Grund für diese Wahl bestand nicht einmal darin, dass der große Richard Southern mein Doktorvater werden wollte, auch wenn er sich später als der inspirierendste Lehrer erweisen sollte, den sich ein Student nur wünschen kann. Der wahre Grund war, dass ich an einer Universität studieren wollte, die auf eine jahrhundertealte Tradition verweisen konnte und die, was mir noch wichtiger erschien, diese Tradition sorgfältig kultivierte.
Ich wähnte mich in einer Welt, die ich in einem etwas hochtrabenden Brief an die „Heimatfront“ folgendermaßen beschrieb: „Am meisten berührt mich, dass Oxford kein Museum ist, in dem Kultur sicher verwahrt und unschädlich in Glasvitrinen verstaut wird, um nur noch angegafft zu werden, sondern dass Tradition hier von Generation zu Generation weitergegeben und dabei zugleich erneuert wird. […] So wird man sich bewusst, dass man mitten im großen Strom der Geschichte treibt, in dem wir als Zwerge auf den Schultern von Riesen stehen.“ Ich war mächtig stolz darauf, nun selbst in diese lange Tradition aufgenommen zu werden, indem ich in derselben Stadt und denselben Gebäuden studieren durfte, in denen Johannes Duns Scotus, Wilhelm von Ockham, Edward Gibbon und John Henry Newman studiert und gelehrt haben. Sie hatten die Fackel entzündet, und nun war es an mir, das Feuer lebendig zu halten und an die nächste Generation weiterzureichen.
Schließlich kam der Moment, an dem ich mit einem Freund durch den Kreuzgang des 1458 gestifteten Magdalen College schlenderte. Wir plauderten über dies und das. Plötzlich erwähnte er beiläufig, dass kein einziger Stein dieses Gebäudes aus dem Mittelalter stamme, sondern frühestens irgendwann aus dem 19. Jahrhundert. Es dauerte eine Weile bis mir bewusst wurde, was er da eigentlich sagte. Wenn seine Behauptung stimmte – und dass dies der Fall war, fand ich rasch bestätigt –, dann war meine ganze Vorstellung von Oxford als einem der wenigen auserwählten Orte, an dem ich in den lebendigen Strom der Geschichte eintauchen konnte, weil hier eine ununterbrochene Kontinuität vom Mittelalter bis in die Gegenwart bestand, ein absolutes Hirngespinst. Was ich für mittelalterlich gehalten hatte, war nicht mehr als ein Versuch des 19. Jahrhunderts, den Faden der mittelalterlichen Kultur wieder aufzugreifen und diese der modernen Gesellschaft als Spiegel vorzuhalten. Das Mittelalter Oxfords war lediglich eine Attrappe, wobei während meines fünfjährigen Aufenthalts dort alle mitspielten und so taten, als ob sie alles für echt hielten. Zugleich war ihnen irgendwie bewusst, dass hier nur ein Theaterstück aufgeführt wurde, vielleicht auf einem etwas höheren Niveau als auf einem Mittelaltermarkt oder einer nachgestellten Schlacht, doch im Wesentlichen nicht viel anders.
Alles war nur Erfindung. Heute ist das allgemein bekannt, doch damals beschäftigten sich die Historiker noch wenig mit den Fragen der Repräsentation, Invention und Konstruktion. Die Bombe platzte erst 1983, dem Jahr, in dem ich meine Dissertation abschloss. Damals erschien nämlich Invention of tradition von Eric Hobsbawm, eine brilliante Essaysammlung. Alle Gefühle und Gedanken, die ich nach der achtlosen Bemerkung meines Freundes seit drei Jahren zwar in mir brodeln fühlte, jedoch nicht recht zu fassen bekam, wurden darin klar beschrieben und geordnet. Vor allem die Beiträge über die englische Königskrönung und die Schottenröcke habe ich bestimmt zehnmal gelesen. Es war eine ernüchternde, zugleich aber auch erhellende Lektüre, die auf die Dauer zu neuen und reiferen Einsichten in meinem Umgang mit der Vergangenheit führte.
Die neuen Erkenntnisse führten zu neuen Fragen, in erster Linie natürlich der, woher eigentlich dieses Bedürfnis stammt, das Mittelalter wieder zum Leben zu erwecken und darauf so viel Geld und Energie zu verschwenden. Außerdem fragte ich mich, wie das bewerkstelligt wurde. Und warum war es so wichtig zu tun, als hätte es seit dem Mittelalter nie einen Bruch in der Entwicklung gegeben? Schließlich war da noch die Frage, warum die Konstruktion des Mittelalters immer umstritten blieb und anscheinend nicht dem Zahn der Zeit widerstehen konnte, wohingegen das Bild der Antike, obwohl es schon aus der Renaissance datiert, alle Angriffe viel besser überstanden hat und immer noch als unentbehrlich für das Verständnis der Gegenwart gilt. Dies sind die Fragen, die dieses Buch behandelt, und auf die ich eine Antwort geben will.
Dies geschieht in fünf Schritten nach einer Einleitung, in der die aktuellen Formen des Interesses am Mittelalter besprochen werden. In einer ersten Erkundung versuche ich aufzuzeigen, warum in der Epoche von Renaissance und Humanismus trotz aller Verklärung der klassischen Antike das Interesse an dem Zeitraum zwischen Rom und Renaissance gewachsen ist, obwohl die Humanisten ihn so verachteten. Dies änderte sich Ende des 17. Jahrhunderts, als ein heftiger Streit über die Autorität der antiken Überlieferung aufkam, der zu der wichtigen Entdeckung führte, dass Europa außer der römischen und mediterranen noch eine andere Vergangenheit besaß, nämlich die des Nordens und des Mittelalters. Die Hauptrolle in dieser Entdeckungsphase spielt in meinem Buch Johann Gottfried Herder, meiner Ansicht nach der Vater des Mediävalismus und des damit eng zusammenhängenden Multikulturalismus.
Die darauffolgenden drei Kapitel beschreiben, was die Generationen vom Sturm und Drang bis zum Ende des 19. Jahrhunderts so alles dem Mittelalter zugeschrieben haben. Sie fanden darin jene Ursprünglichkeit und Authentizität, nach der sie sich sehnten. Im Mittelalter erkannten sie den Ursprung der Nation, zu der sie gehören wollten, und sie entdeckten dort ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Eintracht, an dem es der modernen aufgeklärten Gesellschaft in ihren Augen so sehr fehlte. Dies fasse ich zusammen in den Begriffen Echtheit, Eigenart und Gemeinschaft. In der Schlussbetrachtung gehe ich darauf ein, warum dieses Geschichtsverständnis vom Mittelalter nicht mehr funktioniert, und ob eine neue Geschichte möglich ist.
Nach dem Kapitel über „Eigenart“, über die Entstehung eines nationalen Bewusstseins, unterbreche ich meinen Bericht, weil es in Europa ein Land gab, das seine Eigenart nicht durch den Rückgriff auf seine mittelalterliche Vergangenheit herausbildete, nämlich die Niederlande. Natürlich war hier jedem bewusst, dass es eine mittelalterliche Vergangenheit gab, und dass sie in mancher Hinsicht sogar bewundernswert war. Schließlich war dies die Zeit von Jan van Schaffelaar und Graf Florens V., „dem Gott der armen Leute“, beide Paradebeispiele vaterländischer Tugend. Dennoch schuf die mittelalterliche Vergangenheit in den Niederlanden keine Einheit, sondern vergrößerte nur die Zwietracht zwischen den Protestanten, von denen sich viele eine zweite Reformation wünschten, und den Katholiken, die sich als alleinige Hüter der mittelalterlichen Vergangenheit betrachteten. Der Aufstand gegen die Spanier und das 17. „Goldene“ Jahrhundert schienen weitaus besser geeignet, um alle Niederländer auf einen Nenner zu bringen, vor allem durch den Hinweis auf die religiöse Toleranz dieser Jahrhunderte.
Dieses Buch handelt von Invention und Konstruktion sowie dem historischen Kontext, in dem dies stattfand. Dennoch habe ich es nicht „Die Erfindung des Mittelalters“ genannt, sondern „Die Entdeckung des Mittelalters“. Im Laufe meiner Forschungsarbeit beeindruckte mich besonders die stets wachsende Begeisterung, mit der Dichter und Schriftsteller, Historiker und Philosophen über das Mittelalter erzählten. Sie sprachen davon, als hätten sie ihre eigene mühselige Welt mit ihren erdrückenden Konventionen überwunden und nach einer langen Reise ein neues jungfräuliches Land entdeckt, in dem alles noch unberührt scheint, in dem alles noch möglich ist, in dem ein Mensch endlich zur Ruhe kommen und er selbst sein kann.
Invention und Konstruktion, das klingt nach einer Werbeagentur, in der Spindoktoren raffinierte Pläne schmieden, um ihr Publikum hinters Licht zu führen. Doch so darf man sich das nicht vorstellen. Wir wissen heute, dass die großartige Vision von einer besseren Welt in der fernen Vergangenheit nur eine Illusion war, neue Gebäude, zwar aus alten Steinen errichtet, aber dennoch funkelnagelneu. Die Menschen glaubten, eine Alternative entdeckt zu haben für eine Welt, in der sie sich nicht länger heimisch fühlten und die sie hinter sich lassen wollten. Sie hatten nicht das Gefühl, etwas Neues zu schaffen, sondern etwas zu finden. Genau das möchte ich ernst nehmen, auch wenn mir klar ist, dass sie damals von Dingen schrieben, die größtenteils nur in ihrer Phantasie existierten und oft die Grenze zur Mythologie und Utopie überschritten.
Die wichtigste thematische Einschränkung dieses Buches besteht darin, dass die Entwicklung der bildenden Kunst und der Architektur ausgeklammert wird. Man hat schon so viel geschrieben über Gothic Revival, die Nazarener und die Prärafaeliten, über die Arts-and-Crafts-Bewegung sowie andere Bemühungen, eine neue, vom Mittelalter geprägte Ästhetik zu schaffen, dass Laien ohne Vorbildung in Kunstgeschichte in dieser Fülle sofort den Überblick verlieren. Wenigstens kommen die Ideen, die dieser Wiederbelebung der mittelalterlichen Kunst zugrunde lagen, in diesem Buch zur Sprache, obwohl ich nur in einigen wenigen Fällen, wie zum Beispiel bei William Morris, näher auf die enge Verbindung mit der bildenden Kunst eingehe.
Außerdem behandelt dieses Buch nur einen geographisch begrenzten Bereich. Zunächst beschränkt es sich auf Europa. Obwohl die Mittelalterforschung in den Vereinigten Staaten blüht und gedeiht, hat diese Nation nun einmal keine mittelalterliche Vergangenheit. Dadurch erhält der Rückblick auf das Mittelalter dort eine völlig andere gesellschaftliche und politische Funktion als in Europa. Er stand dort praktisch immer im Zeichen des Andersseins, obwohl sich Charles Homer Haskins und seine Schüler eifrig bemüht haben zu beweisen, dass das Mittelalter auch für das moderne Amerika unmittelbar relevant war. Weil ich alle Quellen in ihrer Originalsprache studieren wollte und vieles nicht übersetzt ist, hat sich meine Auswahl innerhalb Europas notgedrungen auf den niederländischen, englischen, deutschen und französischen Sprachraum beschränkt, weil ich nur diese vier Sprachen beherrsche. Die intellektuelle Entwicklung in diesen Sprachgebieten erachte ich für ausreichend repräsentativ, um fundierte Aussagen über die Entwicklung des Mittelalterbildes in ganz Europa treffen zu können.
Eine dritte Beschränkung besteht darin, dass dieses Buch nur auf einer Auswahl von Autoren beruht und keine vollständige Übersicht darüber bietet, was in den letzten 500 Jahren über das Mittelalter geschrieben wurde. Immerhin habe ich versucht, Autoren auszuwählen, die entweder eine größere Strömung repräsentieren oder besonders einflussreich waren. Um nur drei Beispiele zu nennen: Heinrich Luden ist heute vergessen, doch Anfang des 19. Jahrhunderts war er der erste, der eine Geschichte Deutschlands schrieb, in der das Volk die Hauptrolle spielt. Sein Buch hat später vielen – und weitaus besseren – Historikern als Vorbild gedient, vor allem in Osteuropa. Der Philosoph David Hume verfasste eine Geschichte Englands, die so umstritten war, dass man die englische Geschichtsschreibung bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als Reaktion auf sein Werk verstehen muss. Jules Michelet beeinflusst die französischen Historiker bis auf den heutigen Tag und seine Arbeit ist noch immer grundlegend für das Selbstverständnis der französischen Republik. Ich hätte noch viele andere Autoren besprechen können, glaube jedoch, anhand der getroffenen Auswahl verlässliche Aussagen über Europas Umgang mit seiner mittelalterlichen Vergangenheit treffen zu können.
Eine letzte Beschränkung besteht darin, dass die Gegner des Mittelalters – und das waren viele – kaum zu Worte kommen. Ich behandle Goethe, der nach einem kurzen Anflug der Bewunderung für den Architekten des Straßburger Münsters einer klassizistischen Weltanschauung fest verhaftet blieb. Es wäre auch interessant gewesen zu ergründen, warum Heinrich Heine die Entdeckung des Mittelalters als ein katholisches Komplott betrachtet hat. Auf solche Fragen gehe ich nicht ein, obwohl ich mir bewusst bin, dass die Bewunderung für das Mittelalter keineswegs universell war. Dies zeigt schon allein die Tatsache, dass selbst nach allen Bildungsreformen des 19. Jahrhunderts und entgegen Herders Wunsch die antike Literatur weiterhin in ganz Europa die Grundlage für die Ausbildung der Elite blieb, während die Jugend lediglich im Geschichtsunterricht und in den modernen Sprachen ein wenig über das Mittelalter erfuhr.
Im Laufe der Jahre habe ich von den Ratschlägen vieler profitiert. Als ich in der Flut an Literatur fast unterzugehen drohte und Niek van Sas mein Leid klagte, erwiderte sie einfach, ich solle die ursprünglichen Quellen lesen, dagegen bei der Auswahl der Sekundärliteratur äußerst selektiv zu Werke gehen. Das habe ich beherzigt und war überrascht, wie geistreich und lesbar Autoren wie Gibbon, Hume, Voltaire, die Gebrüder Schlegel, Michelet, Thierry und Burckhardt sind, wenn man sie nur zur Hand nimmt. Die Lektüre all dieser Autoren war lehrreich und erfrischend, obwohl mir persönlich die ironische, distanzierte Prosa Voltaires, Humes und Gibbons besser gefällt als der involvierende Stil von Romantikern wie Thierry und Michelet, die mir einen Hauch zu schwülstig sind. Ich hoffe, etwas davon kommt in meinem Buch zum Ausdruck.
Viel habe ich von meinem ehemaligen Doktoranden Ronald van Kesteren gelernt. Er hat in seiner wunderbaren Dissertation eine Reihe origineller Ideen formuliert, von denen ich hier dankbar Gebrauch mache. Großen Dank schulde ich auch Ed Jonker, Bert Roest, Hendrik Spiering, Ineke van’t Spijker und Jaap Verheul, die mein Manuskript kritisch durchgesehen und mich vor Ausrutschern und Unstimmigkeiten bewahrt haben. Ben de Bock und Jaap van Zaane haben Auszüge des Manuskripts gelesen, um zu prüfen, ob es auch für Nichthistoriker verständlich ist. Teile dieses Buches wurden erstmals auf Kongressen und Versammlungen in Den Haag, Löwen, Leeds, Utrecht, Amsterdam, Nimwegen, Budapest, Oxford, Gent und Groningen vorgestellt. Die Diskussionen nach den dortigen Vorträgen waren für mich sehr aufschlussreich. Natürlich bin ich allein für den letztendlichen Text verantwortlich.
Dank eines Freistellungsstipendiums der Niederländischen Organisation für Wissenschaftliche Forschung (NWO) und eines von der Radboud Universität in Nimwegen finanzierten Sabbaticals konnte ich zwei Jahre lang ungestört an einem Buch arbeiten, das viel umfangreicher geworden ist als ursprünglich geplant. Vor einiger Zeit fragte mich Koos Hageraats von der Uitgeverij Wereldbibliotheek, ob ich meine Antrittsrede Toerisme in de tijd (Tourismus im Wandel der Zeiten, 1995) nicht zu einer kurzen Geschichte über das Mittelalter in der Moderne ausarbeiten wolle. Begeistert sagte ich zu, doch nachdem ich einmal angefangen hatte, mich in die vielen Geschichten über das Mittelalter zu vertiefen, schlug mich das Thema so in seinen Bann, dass das Resultat den Rahmen eines kurzen Überblicks sprengte und auch weitaus mehr Zeit in Anspruch nahm. Längere Passagen dieses Vortrags wurden übrigens in der Einleitung und der Schlussbetrachtung verarbeitet. Ich danke Koos für seine unendliche Geduld und die vielen hilfreichen Ratschläge. Sjoerd de Jong danke ich für seine wertvollen redaktionellen Anmerkungen zum fertigen Text.
Vor kurzem schrieb der englische Historiker Keith Thomas in einem besorgten Artikel über die Zukunft der Universitäten, dass sich geisteswissenschaftliche Forscher von ihren naturwissenschaftlichen Kollegen dadurch unterscheiden, dass ihre Arbeit weniger darauf abzielt, neue Erkenntnisse zu erhalten, als ein besseres Verständnis zu ermöglichen.1 Ich weiß nicht, ob dieser Unterschied wirklich so krass ist. Die Arbeiten vieler Autoren in diesem Buch sind allgemein bekannt, doch für gewöhnlich finden ihre Betrachtungen über das Mittelalter kaum Beachtung. In diesem Sinne bietet das vorliegende Werk durchaus neue Erkenntnisse. Dennoch stimme ich Thomas in mancher Hinsicht auch zu. Ziel meines Buches ist es zu betrachten, wie die Europäer mit ihrer mittelalterlichen Vergangenheit umgegangen sind, um dadurch das moderne Europa besser zu verstehen. Dass hierdurch auch ein ganz neuer Blick auf die Vergangenheit ermöglicht wird, ist ein schöner Nebeneffekt, doch nicht der eigentliche Grund, aus dem ich das Buch geschrieben habe. Ob es mir gelungen ist, überlasse ich dem Urteil der Leser.
Utrecht, September 2011