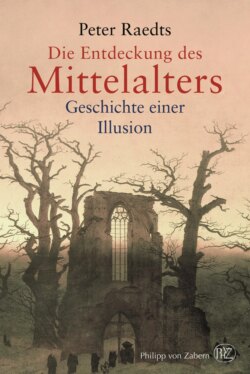Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zuschauen oder mitspielen
ОглавлениеProust war nicht der erste, der zutiefst beunruhigt war, weil das Band der Menschen zu ihrer Vergangenheit immer lockerer wurde. Schon 1874 hatte Friedrich Nietzsche in seinem polemischen Traktat Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben darauf hingewiesen, dass die Vergangenheit für den modernen Menschen anscheinend keinerlei Bedeutung mehr im Alltag habe. Nietzsche meinte, dass der Mensch in seinem Umgang mit der Vergangenheit „zum genießenden und herumwandelnden Zuschauer geworden und in einen Zustand versetzt [ist], an dem selbst große Kriege, große Revolutionen kaum einen Augenblick lang etwas zu ändern vermögen. Noch ist der Krieg nicht beendet, und schon ist er in bedrucktes Papier hunderttausendfach umgesetzt, schon wird er als neuestes Reizmittel dem ermüdeten Gaumen der nach Historie Gierigen vorgesetzt.“5 Den modernen Historiker verglich Nietzsche mit Polybius, der sich mit politischer Geschichte beschäftigt hat, um seine Schüler auf das Regieren des Staates vorzubereiten. Heutige Gelehrte seien dagegen nur neugierige Reisende oder Flöhe suchende Haarspalter auf den Pyramiden großer historischer Ereignisse, Müßiggänger, die begierig nach Zerstreuung und Sensation zwischen den angehäuften Kunstschätzen eines Museums herumstrichen.6 Sie sammelten alles, könnten jedoch keinem Gegenstand Bedeutung verleihen.
Was die unmittelbare Zukunft anging, sollte Nietzsche nicht Recht behalten. Gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts versuchten totalitäre Ideologen von links wie von rechts mit einer sehr voreingenommenen Interpretation der Vergangenheit sowohl der Gegenwart als auch der Zukunft wieder Form zu verleihen.7 Aber nachdem in der Folge des Zweiten Weltkriegs nicht nur Faschismus und Kommunismus sondern auch weniger totalitäre Systeme wie der demokratische Sozialismus, der politische Katholizismus und der Nationalismus mitsamt ihrer dazugehörigen Geschichtsschreibung in einer Dekonstruktionswelle entlarvt wurden, scheinen Proust und Nietzsche nun doch noch Recht zu bekommen. Mit dem Verlust einer Zukunftsperspektive ist schließlich auch die Vergangenheit in Scherben gefallen. Die Reste sind noch da, nur wozu dienen sie eigentlich?
Auf die Dauer führt das zu der unhaltbaren Situation, dass alles, was alt ist, gleich wichtig erscheint und zugleich bedeutsam genug, um aufgehoben und in einem Museum, einer Bibliothek oder einem Archiv ausgestellt zu werden, egal ob es sich nun um Bettpfannen, Hellebarden oder das Utrechter Psalter und Die Nachtwache handelt. In den letzten 20 Jahren hat so ziemlich jedes niederländische Dorf mindestens einen Raum eingerichtet, in dem irgendwelche alte Sachen gehortet werden. Auch die Restaurierung von Gebäuden oder ganzer Städte, wie Heusden in Brabant, hat einen nie zuvor gekannten Grad an Perfektion erreicht. Selbst Kirchen, die aufgegeben wurden, dürfen oft nicht abgerissen werden, um die Dorf- oder Stadtansicht nicht zu beeinträchtigen.
So entsteht die paradoxe Situation, dass alle Überreste der Vergangenheit sorgfältiger denn je zuvor erhalten werden, obwohl sie völlig fremd geworden sind und für die Gestaltung des jetzigen Lebens weniger Bedeutung haben denn je. Uns bleibt nur noch übrig, die Relikte zu sammeln, aufzupolieren, in Vitrinen zu präsentieren und ihre Schönheit zu bewundern. Jede andere Verbindung mit der Vergangenheit ist fraglich geworden. Nicht umsonst spricht man oft von einer Musealisierung der Kultur, ein treffender Ausdruck, der hervorragend vermittelt, dass jenes Band, das den heutigen Menschen noch mit der Vergangenheit verbindet, lediglich im Zuschauen besteht und nicht länger im Mitspielen. In einem Museum werden nur Gegenstände aufgehoben, die dem täglichen Gebrauch entzogen wurden und eine Welt verkörpern, die, wie interessant auch immer, nicht mehr unsere eigene ist.8 Wie Proust sagt, riecht das alles nach Grab. Um ein Beispiel zu nennen: Einen Kelch in der Kirche während der Messe zu benutzen, ist eine grundsätzlich andere Form mit der Vergangenheit umzugehen, als in einem Museum zu erklären, dass man in einer Messe Kelche benutzt hat.
Interesse an der Vergangenheit kann man anscheinend nur noch wecken, wenn diese Vergangenheit in Form eines kunstreichen Gegenstands präsentiert wird, den man aus sicherer Entfernung als hübsch anzusehendes Schauspiel bewundern kann. Nicht umsonst hat der englische Historiker Raphael Samuel für diese Form der Vergegenwärtigung den Begriff des „Gedächtnistheaters“ geprägt und bezeichnet die so präsentierte Vergangenheit als „Spielchen für das Heute“.9 Wie wesentlich bei solchen Präsentationen der Vergangenheit das Ästhetische, der Genuss sind, zeigt sich unter anderem daran, dass die Repliken alter Gegenstände und Gebäude häufig höher geschätzt werden als die Spuren der Vergangenheit selbst. Die berühmte Kopie von Da Vincis Letztem Abendmahl als Glasmalerei im Forest Lawn Memorial Park in Glendale (Kalifornien) ist für viele Besucher „eine Nachbildung, die besser ist als das Original, ein Fetisch, der uns den Verlust des ursprünglichen Werkes vergessen lässt“. Die frischen, grellen Farben der Glasmalerei blenden den Besucher so sehr, dass es ihm fortan unmöglich ist, „die abblätternde Bemalung an der Wand eines Klosterrefektoriums im fernen Mailand noch zu würdigen“.10
Dass man dies nicht als typisch amerikanische Überspanntheit abtun kann, beweist die Tatsache, dass das 1869 bis 1886 im Auftrag von Ludwig II. von Bayern gebaute Traumschloss Neuschwanstein für viele den Prototyp dessen darstellt, wie ein mittelalterliches Schloss eigentlich sein sollte, es aber leider nicht ist. Selbst die Konzentrationslager aus dem Zweiten Weltkrieg fallen bereits dieser Erscheinung einer Musealisierung zum Opfer. In vielen Lagern unternimmt man Bemühungen, das Elend zu ästhetisieren, indem man die Baracken abreißt und stattdessen pietätvolle Kunstwerke zum Andenken an die Opfer aufstellt. Hier offenbart sich eine Haltung gegenüber der Vergangenheit, die perfekt durch die in diesem Zusammenhang oft zitierte Anekdote von dem Kölner Prälaten illustriert wird, dem auf dem Sterbebett ein Kreuz gereicht wird, auf das er jedoch nur einen Blick wirft und sagt: „Schlampige Arbeit, achtzehntes Jahrhundert!“11 Jegliche Bindung an alles, was das Kreuz einmal repräsentiert hat, ist verflogen, geblieben ist nur die distanzierte Bewunderung eines fremd gewordenen, aber kuriosen und amüsanten Gegenstandes.
Die Behauptung, diese Haltung sei unter der heutigen Generation von Historikern oder auch nur unter ihren Lesern vorherrschend, würde dennoch zu weit gehen. Niemand bezweifelt, dass es mehr als nur ästhetischer Genuss ist, Bücher über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben und zu lesen, eher das Gegenteil ist der Fall. In Westeuropa und Amerika wurde die Vernichtung der europäischen Juden seit den 1960er-Jahren zum historischen Fundament unserer moralischen und politischen Überzeugung.12 Historiker wie Jacques Presser und Loe de Jong haben mit ihren Standardwerken über den Krieg nicht nur beschrieben, was während der Besatzung geschehen ist, für viele wurden sie in den Niederlanden, mehr als alle Priester, Pfarrer und Philosophen zusammen, zu den Hütern all dessen, wofür unser Land steht. In ihren Werken findet der Leser keinen unverbindlichen Postmodernismus, sondern einen drängenden Aufruf, heute ethisch einwandfrei zu handeln. Und dass ein solcher Aufruf beim Publikum ankommen kann, zeigt die Tatsache, dass alle Versuche, ihr Werk zu nuancieren, bis jetzt wenig Erfolg hatten. Die Niederlande wollen moralische Klarheit, keine Zweideutigkeit einer grauen Vergangenheit.13
Demnach hat sich immer ein eher engagiertes Interesse an der Vergangenheit erhalten. Es erhielt wieder neuen Auftrieb durch die seit zehn Jahren dramatisch verschlechterten Beziehungen zwischen der westlichen und der islamischen Welt, für die 9/11 zum Symbol wurde. In erster Linie führten die Anschläge in New York und Washington zusammen mit den Reaktionen darauf zu einer Unmenge von Fragen über das Verhältnis zwischen dem Westen und dem Nahen Osten im Laufe der Jahrhunderte. In Bezug auf die Politik gegenüber dem Irak und Afghanistan konnte der umstrittene Arabist Bernard Lewis, ursprünglich Spezialist für die Geschichte des syrischen Mittelalters, so zu einem der wichtigsten Berater der amerikanischen Regierung aufsteigen. Doch viel weitreichendere Folgen für die Beschäftigung mit Geschichte hat die Tatsache, dass dieses „Aufeinanderprallen der Zivilisationen“ der Auslöser für eine Welle des Zweifels war hinsichtlich der bis dahin für selbstverständlich gehaltenen – und daher kaum betonten – Überlegenheit der westlichen Kultur. Die Postmodernisten spielten zwar gerne mit dem Ausgestoßenen, dem Marginalen und dem Unterdrückten, doch wie sich jetzt zeigt, taten sie dies immer vor dem Hintergrund einer nie angezweifelten Hegemonie des Westens. Der unumstößliche Beweis dafür war die allgemeine Überzeugung, nur westliche Intellektuelle seien zu einem derart ironischen und spielerischen Umgang mit der Vergangenheit imstande.
Damit ist es nun vorbei. Die Ironie weicht ängstlichen und darum oft schrill klingenden Betrachtungen über die Identität des Westens, über die Werte, auf denen die westliche Kultur aufbaut, und über die Stellung, die sie in Zukunft zwischen anderen Kulturen einnehmen wird. Nicht nur der Islam wird jetzt als Bedrohung erfahren, plötzlich tauchen am Horizont auch Brasilien, (das wiedererstarkte) Russland, Indien und China als mögliche Rivalen des Westens auf. Dies alles zwingt zu einer neuen Auslegung der Geschichte, die nicht unverbindlich und ironisch ist, sondern Antworten auf drängende Fragen geben soll, wie zum Beispiel zur Stellung der Religion, die man bisher eigentlich für ein Auslaufmodell gehalten hat. In diesem neuen Klima erreichen Bücher, wie das von Jonathan Israel über den Ursprung der Aufklärung, fast Kultstatus.14
Die Einsicht, dass Geschichte kein Hobby ist, sondern wesentlich für die Positionierung der Menschen in der heutigen Gesellschaft, hat sich wieder durchgesetzt. Vor kurzem schrieb der deutsche Sozialhistoriker Dieter Langewiesche, dass die historische Wissenschaft absolut nicht von der Vergangenheit handelt, sondern ein ständiger Dialog zwischen Heute und Gestern ist, wobei das Heute die Tagesordnung bestimmt. Dadurch läuft die Geschichte Gefahr, wieder zu einer Legitimierungswissenschaft zu werden, wie sie es früher allzu oft war. Dennoch kann die Aufgabe der Geschichtsschreibung nicht nur mit wissenschaftlichen Kriterien umschrieben werden, die Historiker müssen auch ständig gesellschaftliche Erwartungen berücksichtigen.15 In seiner Abschlussrede als Dozent drückte der niederländische Historiker Willem Frijhoff dasselbe Gefühl etwas persönlicher aus: „Die Geschichte, die ich vertrete, ist […] existenziell. Sie sucht, was mich an der Vergangenheit berührt und zum Handeln anregt. Meine Identität liegt im Hier und Jetzt, und in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit.“16
Bis jetzt scheint diese Wendung zu einem persönlicheren Umgang mit der Vergangenheit an den Historikern des Mittelalters größtenteils vorbeigegangen zu sein. Das ist nicht allein ihre Schuld. Viele Mediävisten bemühen sich redlich, ihre Leser davon zu überzeugen, dass Reflexionen über die mittelalterliche Geschichte in den heutigen Zeiten unabdingbar sind, um allen neuen Herausforderungen die Stirn zu bieten. Das zeigen die zahlreichen, in den letzten Jahren erschienenen Bücher über einen weit zurückliegenden Konflikt zwischen Ost und West: die Kreuzzüge.17 Trotzdem gelingt den Autoren nicht ganz der Beleg, dass mehr Wissen über die Kreuzzüge zu einem besseren Verständnis der Probleme zwischen der westlichen und der islamischen Welt im 21. Jahrhundert beitragen könnte. Im heutigen Westen ist das intellektuelle und kulturelle Klima nun einmal so, dass man die Kreuzfahrer immer als eine Bande christlicher Terroristen sehen wird, aus einer uns fremd gewordenen Vergangenheit, an die wir lieber nicht erinnert werden. Sowohl Christentum als auch Terrorismus sind im Westen nicht besonders populär.
Ganz im Gegensatz zum Nahen Osten, wo die Geschichte der Kreuzzüge in den letzten 100 Jahren in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wurde, weil sie in den Augen vieler Muslime einen überraschenden Erklärungsansatz für die Aggressionen der westlichen Länder bietet, denen sie seit den letzten Tagen des Osmanischen Reiches ausgesetzt sind.18 Dass das Territorium der Republik Israel ungefähr mit dem des mittelalterlichen Königreichs Jerusalem übereinstimmt, macht die Parallele zwischen Mittelalter und Gegenwart in ihren Augen nur einleuchtender.
Darum machen andere Mediävisten aus der Not eine Tugend. Sie geben unumwunden zu, dass uns das Mittelalter endgültig fremd geworden ist, und dass gerade dies den Reiz dieser Zeit ausmacht. In einer aktuellen Einführung zum Studium der mittelalterlichen Geschichte erläutert Marcus Bull, dass die Kreuzzüge anders waren und nicht mit den heutigen Konflikten zwischen Ost und West verglichen werden können. Dasselbe gilt, nach Ansicht dieses Autors, für die ganze Mittelalterforschung: Sie bezieht sich nicht unmittelbar auf das Heute, macht uns aber bewusst, welchen Reichtum an fremden Gebräuchen, Traditionen und Kulturen es auf der Welt gibt.19 Die Kreuzzüge könnte man mit dem ganzen übrigen Mittelalter in einem völkerkundlichen Museum unterbringen, in dem das Publikum exotische Objekte wie Penisköcher und Schrumpfköpfe angafft, doch ansonsten trägt dies nicht zu einem besseren Verständnis des heutigen Weltgeschehens bei. In meiner Antrittsrede habe ich das als „Tourismus in der Zeit“ bezeichnet. Die Botschaft, dass fremde Kulturen interessant sind und dass Verschiedenartigkeit wundervoll ist, mochte vor zehn Jahren noch ankommen, im Augenblick genügt sie einfach nicht mehr den Erwartungen einer Leserschaft, die inzwischen ernsthaft anfängt, an der Vitalität ihrer eigenen Kultur zu zweifeln und deshalb wieder ernsthaft Fragen zur eigenen jüngeren oder älteren Vergangenheit stellt.
Es ist schade, aber auch typisch, dass die Historiker so große Mühe haben, eine persönlichere Geschichtsschreibung des Mittelalters zu entwickeln. Schon immer wurde die mittelalterliche Geschichte, mehr als andere Epochen, von „Kräuterfrauen“ beiderlei Geschlechts heimgesucht sowie von Menschen, die nach Höherem strebten, denen der Druck der modernen Zeit zu viel geworden war und die sich darum in den Ursprung des Grals vergruben, in das Komplott der Templer, in die Lage von Camelot, in das Weiterleben der Druiden und andere esoterische Fragen.20 Es werden zwar mehr gelehrte Studien über das Mittelalter veröffentlicht denn je zuvor, doch das beeinflusst kaum die zunehmende Tendenz im breiten Publikum, verstärkt sie sogar eher noch, die mittelalterliche Vergangenheit allein im Rahmen der Freizeitindustrie zur Sprache zu bringen. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit nur auf jene Aspekte des Mittelalters, die Vergnügungspotential besitzen: Auf Bauerntänze, bei denen viel getrommelt und geklimpert wird, lustige Rituale, schöne Geschichten über Ritter und Jungfrauen, Spanferkel, grob gewebte, aber solide Stoffe; und nicht zuletzt findet diese Aufmerksamkeit in Computerspielen Ausdruck. In ernsthaften Betrachtungen über den Zustand von Gesellschaft und Kultur nimmt man das Wort „Mittelalter“ dagegen nur noch in den Mund, wenn man sich fragt, ob die moderne Welt mit dem Ende der großen Geschichten am Beginn einer neuen Periode des Chaos und eines Rückfalls in die Barbarei steht.21
Man kann sich fragen, was eigentlich dagegenspricht, die mittelalterliche Vergangenheit auf so vergnügliche Weise kennenzulernen. Der heutige Mensch, für den die Vergangenheit praktisch unzugänglich geworden ist, erhält so zumindest noch eine kleine Chance, sie kennenzulernen.22 Diese Einstellung einer ästhetischen Distanz gewährt nur dem Anschein nach Zugang zur Vergangenheit, ist tatsächlich jedoch weit davon entfernt. Ein gewisses persönliches Interesse, das Bewusstsein eines gemeinsamen Schicksals oder von Kontinuität ist erforderlich, um richtige und präzise Fragen an die Vergangenheit zu stellen.23 Ein Ästhet engagiert sich nicht, wie Søren Kierkegaard schon bemerkt hat, er hält inne bei jenen Aspekten und Überbleibseln der Vergangenheit, die schön sind oder ein angenehmes Gefühl vermitteln, beziehungsweise über die er staunen kann, die für die Menschen dieser Vergangenheit selbst jedoch gar nicht existiert haben oder die, wenn es sie gab, auf jeden Fall unwichtig waren.24
Doch Schicksalsverbundenheit, die Überzeugung, dass der Forscher wesentliche Aspekte des Lebens mit dem Gegenstand seiner Forschung teilt, erlaubt es, tiefer in jene Bereiche der Vergangenheit vorzudringen, die für die Menschen damals selbst wichtig waren, und macht diese Vergangenheit zugleich relevanter für das Heute. Wer die kommunistische Bewegung untersucht, muss irgendwie die soziale Begeisterung, die alle Anhänger dieser Strömung angetrieben hat, mitfühlen können, um den Kommunismus zu begreifen und seine Folgen für die heutige Welt beschreiben zu können.25 Weil in unserer Kultur die Schicksalsverbundenheit hinsichtlich der mittelalterlichen Geschichte eigentlich nie eine Selbstverständlichkeit war, müssen sich Mediävisten mehr als andere Historiker immer wieder fragen, ob und wie sie zwischen unserer Gegenwart und der fernen Vergangenheit Brücken bauen können.