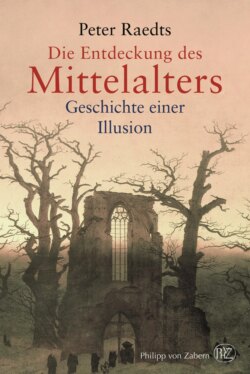Читать книгу Die Entdeckung des Mittelalters - Peter Raedts - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Heute und Gestern
ОглавлениеDie Art, wie die Humanisten und ihre Nachfolger mit der mittelalterlichen Geschichte umgingen, war in den letzten 30 Jahren Gegenstand einer Diskussion über den Umgang mit der Vergangenheit in der Frühmoderne. Diese Diskussion spitzte sich auf die Frage zu, ob man in dieser Epoche den ersten Ansatz eines modernen historischen Bewusstseins erkennen kann, mit der Fähigkeit, die Vergangenheit als etwas wahrzunehmen, was sich von der Gegenwart unterscheidet.88 Allgemein war man immer der Auffassung, dass bis Mitte des 18. Jahrhunderts von einem solchen historischen Bewusstsein nicht die Rede sein konnte, weil die Vergangenheit bis dahin nur als Verlängerung der Gegenwart gesehen wurde.89 In den letzten Jahren hat man das in Frage gestellt, in machen Punkten zu Recht.
Man kann nicht abstreiten, dass die Humanisten die Vergangenheit ganz anders betrachtet haben als die mittelalterlichen Historiker. Für das Mittelalter gilt zweifelsfrei, dass Gegenwart und Vergangenheit nicht als grundlegend verschieden betrachtet wurden. Man sah die Vergangenheit als ein einziges großes, undifferenziertes Ganzes, in dem alles zueinander in Beziehung stand und alles ineinander passte. In dieser Vergangenheit gab es kein Näher und kein Ferner, keine Epochen, mit denen man sich enger oder im Gegenteil weniger verwandt fühlte, alles war gleich alt, gleich weit entfernt, und unterschied sich zugleich nicht vom Heute, weil die Menschen immer und überall gleich waren. Eigentlich gab es gar keine Vergangenheit, sondern nur eine ewig dauernde Gegenwart. Alle Ereignisse wurden ihrer Zeitgebundenheit entkleidet.90
Doch die Humanisten isolierten die klassische Antike von der übrigen Geschichte als eine Epoche vorbildlicher Zivilisation, die verlorengegangen war. Und gerade durch dieses Bewusstsein einer Kluft, die sich zwischen ihrer eigenen barbarischen Zeit und der zivilisierten Antike auftat, erkannten sie, dass sich Gegenwart und Vergangenheit tatsächlich voneinander unterscheiden konnten. Die mittelalterlichen Reisenden betrachteten Rom als ein einziges großes Ganzes von alten Gebäuden, doch als Petrarca Rom besuchte, sah er zwei Städte: die heutige Stadt, in der Kirchen und Klöster dominierten, und die alte Hauptstadt des Römischen Reiches, von der nur noch Ruinen zeugten.91 Dieses schmerzliche Bewusstsein eines Verlustes veranlasste ihn, zur Erneuerung des alten Roms aufzurufen. Man kann sich sogar fragen, ob eine Bewegung wie die Renaissance überhaupt möglich gewesen wäre, ohne ein zuvor gewachsenes Bewusstsein, dass sich die barbarische Gegenwart schmerzlich von der antiken Vergangenheit unterschied. Erst wenn etwas endgültig verloren ist, kann der Ruf nach Erneuerung erklingen. In ihrem Streben nach einem Wiederaufbau der antiken Welt drangen die Humanisten tief in den Charakter des griechischen und römischen Altertums ein, vor allem in seine Literatur. In diesem Sinne kann man bei den Humanisten sehr wohl von einer ersten Form eines historischen Bewusstseins sprechen. Nur muss man hier auf zwei Gebieten große Einschränkungen machen.
An erster Stelle fanden die Humanisten keine Erklärung für die Tatsache, dass die Antike so anders war als ihre eigene Zeit; das Konzept einer Entwicklung war ihnen fremd. Petrarca konnte sich nur einen Grund denken, warum sich seine Epoche so sehr von der des Livius unterschied, nämlich den, dass alle Zeitgenossen gewissenlose Schurken seien, „die nur Wert auf Gold, Silber und körperlichen Genuss legen“. Die Humanisten konnten Veränderung nur als moralischen Verfall, als Degeneration verstehen.92
Außerdem waren die Humanisten überzeugt davon, dass es genüge die antike Geschichte und Literatur zu studieren, um dazu beizutragen, den Verfall aufzuhalten und die antike Zivilisation zu neuen Ehren zu bringen. Auch die Reformatoren glaubten, es sei möglich, zur Reinheit der christlichen Urgemeinde zurückzukehren, wenn man sich nur auf das Wort der Bibel konzentriere. Hierdurch erhielt die Geschichte vor allem eine pädagogische Funktion, weil sie der Jugend nachahmenswerte Beispiele für Tugend aus einer besseren Zeit lieferte. Der Ruf nach einer Wiederherstellung der Antike und des christlichen Altertums war schließlich nur möglich, weil die Humanisten, ebenso wie ihre mittelalterlichen Vorgänger, überzeugt waren, dass es neben allen Varianten menschlichen Verhaltens, denen man in der Geschichte begegnete, eine universelle menschliche Natur gäbe, mit daran gekoppelten Werte, die für alle Menschen zu allen Zeiten gleich seien.93 Bis 1650 zweifelte niemand daran, dass diese Universalität in der Bibel, im Christentum und in der Kultur der klassischen Antike konkrete historische Gestalt angenommen hat. Erst als sich die Einsicht durchsetzte, dass selbst die klassische Kultur und das Christentum keine universellen Ideale sind, auf die man letztendlich jede Menschlichkeit zurückführen kann, sondern rein zufällige Gestaltungen der menschlichen Existenz, drang auch die Erkenntnis durch, dass durch den unerbittlichen Lauf der Zeit nur Entwicklung, jedoch nie Erneuerung möglich ist.
Dennoch glaubten manche Forscher, schon im 16. Jahrhundert den Ansatz eines historischen Bewusstseins erkennen zu können. Französische Juristen wie Budé und Pasquier sowie englische antiquarians wie Spelman wären demnach schon durch ihr Studium des mittelalterlichen Rechts und der mittelalterlichen Institutionen zur Erkenntnis gelangt, dass sich das Mittelalter radikal von der Antike unterscheidet. Dadurch soll ihnen die Relativität alles Menschlichen, die gewöhnlich erst mit dem späten 18. und vor allem mit dem 19. Jahrhundert assoziiert wird, bereits bewusst geworden sein.94 Zweifellos haben schon diese Gelehrten die Grundlagen zu einer wissenschaftlichen Erforschung des Mittelalters gelegt. Allerdings ist es eine ganz andere Frage, ob sie auch imstande waren, den kulturellen Rahmen ihrer Zeit zu durchbrechen und in den Charakter einer anderen Zeit Einblick zu erhalten. Das ist ihnen nicht gelungen.
Alle diese Gelehrten haben sich für ihr Interesse an einer so barbarischen Zeit ausgiebig entschuldigt und darauf hingewiesen, dass das Mittelalter in keiner Beziehung den Vergleich mit der Antike oder der eigenen Epoche aufnehmen könne. Pasquier spricht von einer Blüte der französischen Literatur in der Zeit Ludwigs IX., genannt Ludwig der Heilige. Er gibt jedoch sofort zu, dass ihre Erzeugnisse unlesbar und nur nach mühsamer Übersetzung einigermaßen zu genießen sind. Das mittelalterliche Latein verurteilte er pauschal als barbarisch. Trotz ihrer mittelalterlichen Studien bewegten sich diese Männer weiter im Rahmen des Klassizismus und waren nicht imstande, in ihren Werken dem Mittelalter einen eigenen Platz einzuräumen.
Auch in einem anderen wesentlichen Punkt gelang den Rechtsgelehrten des 16. Jahrhunderts nicht der Durchbruch zu einem historischen Bewusstsein. Ein Jurist wie Hotman war durchaus imstande, das römische Recht in seinen historischen Kontext zu stellen und seine universelle Gültigkeit anzuzweifeln. Er zeigte auf, dass das französische Gewohnheitsrecht in einer völlig anderen historischen Umgebung entstanden ist und besser an die reale Rechtssituation im Frankreich des 16. Jahrhunderts angepasst war, doch weder er noch irgendein anderer Jurist seiner Zeit konnte beschreiben, wie sich dieses Recht entwickelt hatte: Es existierte als Ganzes bereits seit Urzeiten und war von Generation zu Generation weitergegeben worden. Wer etwas daran veränderte, wie zum Beispiel Ludwig XI., beging einen moralischen Frevel: Er wich von der Norm ab, die die Vorfahren geschaffen hatten.95 Genauso behauptete Hugo de Groot später, die staatlichen Institutionen der niederländischen Republik seien seit den Zeiten der Bataver unverändert geblieben, 1477 im Großen Privileg schriftlich fixiert worden, und nun durch die Zentralisierungspolitik Karls V. und Philipps II. bedroht. Durch ihren Aufstand sei es den Holländern gelungen, die alte Freiheit wiederherzustellen. „Diese kurze Geschichte […] zeigt, dass sich die Bataver, jetzt Holländer genannt, über 1700 Jahre lang derselben Regierung bedient haben, wobei die höchste Macht bei den Staaten lag und immer noch liegt.“96 Weder Hotman noch De Groot konnten sich vorstellen, dass sich eine Kultur wirklich verändert: Was jetzt war, musste schon immer so gewesen sein. Ebenso wie bei Petrarca war Entwicklung für sie gleichbedeutend mit moralischem Verfall.
Trotzdem beschäftigten sich im 16. und 17. Jahrhundert zahllose Gelehrte mit dieser Zeit moralischen Verfalls, und das sogar sehr intensiv. Sie legten die Grundlagen für die spätere wissenschaftliche Erforschung des Mittelalters, wovon die Geschichtswissenschaft bis heute profitiert. Dies wirft sofort die Frage auf, warum Gelehrte, die allenthalben beteuerten, wie sehr sie diese schauderhafte Zeit verabscheuten, sich dennoch die Mühe machten, ihre Überreste zusammenzutragen und in dicken Folianten aufzuzeichnen, die oft heute noch den Ausgangspunkt der Forschungsarbeit bilden.
Es gab zwei Gründe, warum sich die Humanisten trotz ihres Widerwillens mit der mittelalterlichen Vergangenheit beschäftigt haben. Ungeachtet des ganzen exaltierten Geredes über eine Wiedergeburt der Antike bestand das Mittelalter einfach weiter. Auch wenn das römische Recht große Bewunderung erregte, beruhte das ganze Rechtssystem in allen europäischen Ländern bis zur französischen Revolution, in England sogar bis heute, zum größten Teil auf der mittelalterlichen Gesetzgebung. Wichtige staatliche Körperschaften wie der oberste Gerichtshof in Frankreich (das Pariser Parlament), der deutsche Reichstag und der Maggior Consiglio in Venedig, sind im Mittelalter eingeführt worden. Die Privilegien der Kirche und die Freiheiten der Städte wurden im Mittelalter erlassen. Und gerade weil die Fürsten im 16. und 17. Jahrhundert ständig versuchten, an den einstmals gewährten Vorrechten, Freiheiten und Privilegien zu rütteln, wurden die mittelalterlichen Dokumente, in denen sie verzeichnet waren, so wichtig. Die französischen Juristen des 16. Jahrhunderts hätten sich nie mit dem Mittelalter beschäftigt, wenn die verworrene politische Situation ihrer eigenen Zeit und die Undurchsichtigkeit der französischen Gesetzgebung sie nicht dazu gezwungen hätten. Der Engländer John Selden sagte offen, dass sein Interesse der Antike galt, dennoch habe er sich in die Geschichte der Kirchenabgaben im Mittelalter vertieft, um im Kampf um die Vorrechte der englischen Kirche Klarheit zu schaffen.97 Kurzum, mittelalterliche Dokumente wurden nicht gesammelt, um Stoff für eine Geschichte des Mittelalters zu liefern, sondern um im Gerichtshof oder im Ratssaal benutzt zu werden.
Es gibt noch einen zweiten Grund, warum das Mittelalter erforscht wurde, und der hatte sehr wohl etwas mit Geschichtsschreibung und historischen Überlieferungen zu tun. Die humanistischen Gelehrten und Autoren waren nicht nur Bewunderer der Antike, sondern auch stolz auf Vaterland und Fürst, und diesen Stolz brachten sie unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass sie die ruhmreichen Taten der Ahnen besangen.98 Für sie war es ein großes Problem, dass in den antiken Quellen wenig oder gar nichts über diese illustren Vorväter stand. Julius Cäsar und vor allem Tacitus waren die einzigen antiken Autoren, die etwas über die Völker des Nordens erzählt hatten, doch obwohl sie viele interessante Fakten über Kelten und Germanen berichteten, war das insgesamt viel zu wenig, um dem Ruhm der Stammväter ausreichend Relief zu verleihen. Es gab keine andere Lösung, als die mittelalterliche Vergangenheit mit einzubeziehen, um mit den Taten von großen Fürsten wie Karl dem Großen, Ludwig dem Heiligen, Otto dem Großen, Friedrich Barbarossa oder Alfred dem Großen zu belegen, wie bewundernswert die Vergangenheit des Vaterlandes gewesen war. William Shakespeare steht hier einsam an der Spitze mit seinen unvergesslichen Königsdramen, in denen er die Monarchie der Tudors besang, die Erinnerung an die mittelalterlichen englischen Könige auf der Bühne wachrief und hierdurch lebendig hielt.
Die frühmodernen Sammlungen mittelalterlicher Dokumente haben ungewollt das Fundament für die Mediävistik gelegt, und die Geschichten der Historiker und Dichter dieser Zeit wurden zur Grundlage des späteren Mittelalterbildes. Widerwillig gaben die Humanisten zu, dass es trotz allem so etwas wie eine mittelalterliche Vergangenheit gab und diese sogar eine gewisse Inspiration liefern konnte. Selbstverständlich würde das Mittelalter nie den Vergleich mit der klassischen Antike aufnehmen können. Die Antike war der gemeinsame Besitz aller kultivierten Menschen, sie war das einzige allgemeingültige Modell und zugleich die universell gültige Norm für Regierung, Literatur, Bildung, Wissenschaft und Kunst. Dagegen fanden die Humanisten im Mittelalter, was ihr jeweils eigenes Volk von allen anderen unterschied, und warum ihr Volk unter Führung seiner Fürsten im Laufe der Zeit solche Gipfel erklommen hatte. Mit anderen Worten verkörperte die Antike das Universelle, das Verbindende zwischen allen Europäern, während das Mittelalter von Anfang an im Zeichen des Partikularen stand, das heißt der Eigenheiten jeden einzelnen Volkes.
Bis ins 18. Jahrhundert hinein dominierte die klassische Kultur, sie war die Grundlage einer ganz Europa umspannenden Republik der Gelehrten, zu der die gesamte politische und intellektuelle Elite gehörte, und in der Latein die Sprache der Wissenschaft, Französisch aber die Umgangssprache war. Doch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts keimte auch bei den wohlhabenden Bürgern, die bis dahin von der Elite ausgeschlossen waren, ein zartes Gefühl der Verantwortung für alle Staatsangelegenheiten auf und sie begannen zu fordern, dass auch ihre Interessen berücksichtigt werden sollten. Schließlich waren sie ja die Vertreter des Volkes und konnten die Belange der Nation besser wahrnehmen als die alte Elite, die sich in Sprache und Kultur dem eigenen Volk entfremdet hatte. Im Rahmen dieser Politisierung des patriotischen Gefühls wurde das Studium der eigenen Geschichte immer wichtiger, und deshalb nahm auch das Mittelalter in der Darstellung der europäischen Vergangenheit breiteren Raum ein. Die Welt, die im Mittelalter entstanden war, ging erst im Laufe des 18. Jahrhunderts zu Ende, so dass es nun zum ersten Mal möglich wurde, auf diese vergangene Epoche zurückzublicken, und zwar mit derselben Wehmut und Verwunderung, mit der Petrarca die Antike betrachtet hatte.