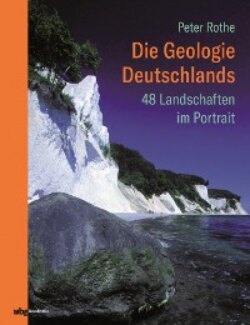Читать книгу Die Geologie Deutschlands - Peter Rothe - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Variskische Gebirgssystem – Deutschlands geologisches Rückgrat
ОглавлениеVariscisches, Varistisches, Variszisches oder Variskisches Gebirge – alle diese Schreibweisen werden verwendet. Der Begriff stammt von „Curia Variscorum“, wie die Stadt Hof in Bayern neulateinisch bezeichnet wurde.
Dementsprechend gebrauche ich hier die deutschsprachige Schreibweise variskisch, mit Ausnahme des Begriffs „Subvariszische Saumsenke“, die schon ursprünglich so geschrieben wurde. Der österreichische Geologe Franz Kossmat hatte schon 1927 eine Gliederung des wesentlich während der Karbon-Zeit strukturierten Variskischen Gebirges vorgestellt, das man volkstümlich gelegentlich auch als „Karbonische Alpen“ bezeichnet hat. Bis heute ist aber nicht sicher erwiesen, ob das jemals ein den Alpen vergleichbares Hochgebirge gewesen ist.
Zur geologischen Vorgeschichte der Varisiziden gibt es inzwischen wesentlich neue Erkenntnisse, die sich vor allem auf eine Vielzahl von Altersbestimmungen an winzig kleinen Zirkonkristallen stützen. Daraus lässt sich nun sogar die Herkunft der als ortsfremd im Gebirge erkannten Decken im südöstlichen Rheinischen Schiefergebirge rekonstruieren, die ihren Ursprung sowohl am Rand von Gondwana (also in Afrika) als auch im nördlich gelegenen Laurussia-Baltica-Kontinent haben. Das hier weiter auszuführen ginge aber zu weit, weil es mir letztlich um das geht, was man im Gelände sehen kann.
Die in Abb. 2 dargestellte Einteilung in unterschiedlich ausgeprägte, großräumliche Gesteinskomplexe ist im Wesentlichen auch heute noch gültig, nur die Entstehung wird in mancher Hinsicht jetzt anders interpretiert. Der Begriff „Karbonische Alpen“ suggeriert ein Hochgebirge, dessen einstmals sicherlich steileren Berge aber im Verlauf der vergangenen 300 Millionen Jahre so weit abgetragen worden sind, dass wir heute Mittelgebirge sehen, deren Formen mit der Schroffheit der Hochgebirge nicht mehr vergleichbar sind. Dennoch weiß man, dass sie in ihrer inneren Struktur und bezüglich ihrer Entstehung sich keineswegs grundlegend von den alpinen Gebirgen unterscheiden. Bei ihrer Bildung waren die gleichen Prozesse am Werk, die schon immer die Gebirge der Erde geformt hatten. Es ist auch nicht uninteressant zu wissen, dass Deckenüberschiebungen, wie sie die geologisch jungen Hochgebirge kennzeichnen, zuerst in einem Mittelgebirge erkannt wurden, nämlich schon 1883 in den Ardennen. Kossmat gliederte das Variskische Gebirge in die Großeinheiten Moldanubikum, Saxothuringikum, Rhenohercynikum und die Subvariszische Saumsenke.
Bereits 1930 wurde durch H. Scholtz zusätzlich noch die Mitteldeutsche Kristallinschwelle als Teil des Saxothuringikums eingeführt und durch Brinkmann (1948) ausführlicher definiert, weil man ein Liefergebiet für zeitlich begrenzt vorkommende klastische Sedimente brauchte (Abb. 2).
Die auch als Zonen (Moldanubische Zone etc.) bezeichneten Einheiten sind überwiegend in den östlichen Gebieten Deutschlands und den angrenzenden Ländern definiert worden, und ihre Namen sind durch die Geographie bedingt:
Moldanubikum heißt nach der Moldau und der Donau, Saxothuringikum nach Sachsen und Thüringen, Rhenohercynikum nach dem Rhein (bzw. dem Rheinischen Schiefergebirge) und dem Harz, und die Subvariszische Saumsenke bezeichnet etwa das Gebiet, in dem die Ruhrkohlen entstanden sind.
Damit lassen sich nun einzelne Gebirge in diese Zonen einordnen. Sie spiegeln deren geologische Besonderheiten: So sind die Gebirge in der Moldanubischen Zone besonders durch stark und mehrphasig metamorphe Gesteinskomplexe gekennzeichnet, vereinfacht kann man sagen, dass hier Gneise überwiegen.
Die Gebirge der Saxothuringischen Zone bestehen wesentlich aus Gneisen und Graniten und die der Rhenohercynischen Zone sind allenfalls von einer schwachen Metamorphose betroffen, d.h., ihre ursprünglichen Gesteine waren im Wesentlichen Sedimente.
Wenn man die räumliche Anordnung der Variskischen Gebirge durch Europa verfolgt, so zeigen sich charakteristische Richtungen. In Frankreich verläuft ein Gebirgsbogen von der Bretagne bis ins Zentralmassiv, der allgemein in nordwestlicher Richtung streicht; im Zentralmassiv dreht der Verlauf der Strukturen dann in eine Nordostrichtung und diese Richtung dominiert auch den Verlauf des Gebirges in Deutschland; wenn wir „variskische“ Richtung sagen, meint das immer ein Südwest-Nordost-Streichen. Die von Kossmat definierten Einheiten haben alle diese Streichrichtung und sie verlaufen alle mehr oder weniger parallel zueinander.
Im Zusammenhang mit ihrem Metamorphosegrad ließe sich in einem plattentektonischen Kontext behaupten, dass das Variskische Gebirge durch eine einst nach Südosten gerichtete Subduktion geprägt sein könnte. Dieses sehr grobe Bild wird aber durch eine Vielzahl von Beobachtungen modifiziert.
In den letzten Jahren wird zunehmend ein neuer Erklärungsansatz diskutiert, der die Kossmat’schen Zonen als Terrane auffasst. Terrane sind Krustenteile (Mikroplatten), die eine jeweils eigene Entstehungsgeschichte haben; sie sind meist in ganz anderen Bereichen entstanden und erst danach in ihre heutige Position gewandert. So wird das Rhenohercynikum einem als Avalonia bezeichneten Terran zugeordnet, das als Krustensplitter vom südlich gelegenen Gondwanaland schon im älteren Paläozoikum nach Norden driftete und sich dort in der Zeit des Silurs mit dem aus älteren, d.h. kaledonischen Einheiten zusammengesetzten Old-Red-Kontinent vereinigte. Avalonia war im Devon dann der Schelfbereich, in dem der oft rot gefärbte Verwitterungsschutt des Kaledonischen Gebirges abgelagert wurde.
Das zeitlich nachfolgende, Armorica genannte Terran, das ebenfalls vom Nordrand Gondwanas stammt, entspricht den südlich an das Rhenohercynikum anschließenden Zonen, die erst etwas später dort „angedockt“ hatten.
Die Geophysik hat inzwischen Hinweise dafür geliefert, dass die Grenzen zwischen den Kossmat’ schen Einheiten bzw. den Terranen tektonische Grenzen sind.
Mit der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB) in der Oberpfalz hatte man geplant, die Grenze zwischen Moldanubikum und Saxothuringikum zu durchbohren; das ist nicht geglückt, weil die Bohrung wegen technischer Probleme in etwas über 9000 m abgebrochen werden musste. Die Grenze lag nach den geophysikalischen Daten aber tiefer und es ist bei den Kosten einer solchen Bohrung ziemlich unwahrscheinlich, dass wir sie in absehbarer Zeit direkt erreichen werden.
Auch in vielen anderen Fällen muss auf die Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen verwiesen werden; zu den Großprojekten in dieser Hinsicht gehörten das Deutsche Kontinentale Reflexionsseismik-Programm DEKORP oder die Europäische Geotraverse EGT (Blundell et al. 1992).
Unabhängig vom Schema Kossmats hatten diese Forschungsprogramme zum Ziel, mehr über den tieferen Untergrund zu erfahren. Bestätigt wurde dabei die bei etwa 30 – 35 km Tiefe liegende Grenze zwischen Erdkruste und Erdmantel unter Deutschland, die als Mohorovicic-Diskontinuität, kurz Moho bezeichnet wird; es gibt allerdings Abweichungen von diesem Bild. Sie betreffen u.a. den Alpenraum, wo unter der Auflast des jungen Hochgebirges die Erdkruste bis zu einer Tiefe von 40 km „eingedellt“ ist (die alten Geologen nannten das die „Wurzelzone“ des Gebirges), oder den Oberrheingraben, unter dem ein hoch reichendes „Mantelkissen“ zu existieren scheint, das hier die Moho im Bereich des Kaiserstuhls bis auf etwa 24 km ansteigen lässt.
Eine sehr markante Linie besteht im Osten, wo der Untergrund einen nach Nordwesten streichenden Verlauf annimmt: Hier grenzt Mitteleuropa an die große Osteuropäische Plattform, die durch eine über 40 km dicke Erdkruste gekennzeichnet ist. Dieser Linie folgt in ihrer Richtung u.a. das Elbetal und sie setzt sich weit nach Nordwesten fort, wo sie nach ihren „Erfindern“ heute als Tornquist-Tesseire-Zone bezeichnet wird.
Man kann nun die einzelnen deutschen Gebirge bzw. Landschaften den Kossmat-Zonen zuordnen. Dann zeigt sich, dass der größte Teil des Schwarzwalds, der Bayerische Wald mit seinen Teilgebieten, aber auch die dazwischenliegenden und von jüngerem Deckgebirge überlagerten Bereiche zum Moldanubikum gehören; der nördlichste Schwarzwald, Odenwald, Spessart und Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Erzgebirge und Granulitgebirge zum Saxothuringikum; Hunsrück, Taunus und alle weiteren, geographisch definierten Teile des Rheinischen Schiefergebirges sowie der Harz zum Rhenohercynikum; und das weiter nördlich gelegene westfälische Steinkohlenrevier zur Subvariszischen Saumsenke.
Abb. 2: Die Gliederung des Variskischen Gebirges in Zonen, die jeweils ihre eigene geologische Geschichte haben: Ausschnitt aus der Darstellung der Europäischen Geotraverse (EGT, Blundell et al. 1992), Legende im Wesentlichen nach Franke (darin). Charakteristisch ist der Südwest-Nordost-Verlauf der einzelnen Zonen, die vor allem in Süddeutschland von mächtigem mesozoischem Deckgebirge überlagert sind. Vogesen, Schwarzwald, Odenwald, Spessart und Thüringer Wald bilden große tektonische Fenster, die den Blick in den Untergrund gestatten.
Nach Süden taucht das Variskische Gebirge unter die Molasse ab. Reste davon sind auch in den Alpen erhalten, dort sind sie aber im Zuge der Entwicklung dieses jungen Gebirges zerstückelt worden. Münchberger Masse und wahrscheinlich auch die nordöstlich davon gelegenen kleineren Einheiten bilden ebenso wie die am Ostrand des Rheinischen Schiefergebirges gelegenen Komplexe der Gießen-Decke (Sägezahn-Signatur) ortsfremd gelagerte Decken, die jeweils aus Südosten dorthin geschoben wurden.
Die tektonische Karte zeigt auch die jungen Einbruchszonen, die vom Oberrheingraben bis in die Hessische Senke und darüber hinaus Richtung Nordnordost verlaufen, und die nach Nordwesten orientierte Niederrheinische Bucht. Der Nordwest-Richtung folgen auch viele der landschaftsprägenden Brüche am Südwest-Rand von Böhmischer Masse, an den ostbayerischen Gebirgen und am Thüringer Wald.
Die jungen Vulkangebiete sind, von der Eifel über Westerwald, Vogelsberg und die Rhön mit ihren Randbereichen bis hin zum Egergraben und in die Lausitz, auf einer weitgehend Ost-West ausgerichteten Linie angeordnet, deren Parallele zu den Alpen hier Spekulationen über einen ursächlichen Zusammenhang nahelegt.
Das „Tertiär“ wird nomenklatorisch neuerdings in „Paläogen“ und „Neogen“ gegliedert, der ältere Zeitbegriff wird aber in diesem Buch dennoch beibehalten, auch um die in nahezu sämtlichen Fällen so zitierte Literatur erkennbar zu halten.
Bergbau und Geophysik haben gezeigt, dass sich dieser Bereich bis in den Untergrund der Nordsee verfolgen lässt – insofern gehört auch der Untergrund der Norddeutschen Tiefebene dazu. Dieses Beispiel zeigt besonders deutlich, dass die variskischen Baueinheiten bzw. deren Grenzen oft nicht an der heutigen Oberfläche zu finden sind, sondern von jüngeren Schichten überlagert werden. Um es mit einem Beispiel vorwegzunehmen: Die Schwäbische Alb liegt in der Moldanubischen Zone, sie wird im Buch aber im Wesentlichen unter dem Aspekt ihrer jurazeitlichen Schichtfolge behandelt, obwohl der moldanubische, aus Kristallingesteinen bestehende Untergrund sich in Bohrungen und anhand von jungvulkanischen Auswürflingen nachweisen lässt; und auch der Meteoritenimpakt im Nördlinger Ries hat entsprechende Gesteine an die Oberfläche befördert.
Die Grenzen zwischen den variskischen Baueinheiten sind gelegentlich auch unter jüngeren, postvariskischen Ablagerungen verhüllt. Die mit der Heraushebung des Gebirges einhergehende Abtragung hat zur Perm-Zeit mächtige Schuttmassen geliefert, die sich in Trögen zu viele Tausende Meter mächtigen klastischen Ablagerungen angesammelt haben. Sie sind durch eine eigene Dynamik während der Spätphasen der variskischen Gebirgsbildung entstanden, die nun statt Einengung der Erdkruste und Faltung zu einer Dehnung geführt hat; die Folge waren tief reichende Brüche, die auch wieder Magmen den Weg zur Erdoberfläche eröffnet hatten. Solche Tröge sind an ihren Gesteinen etwa von der Saar bis nach Thüringen und darüber hinaus zu verfolgen.
Die regionale Geologie von Deutschland wird wesentlich durch die Variskischen Gebirge bestimmt. Das gilt nicht nur für die Bereiche, in denen deren Gesteinskomplexe zutage treten, sondern auch für die, in denen variskische Einheiten durch jüngere Ablagerungen verhüllt sind. Insofern sind selbst der Bereich der Alpen und deren Vorland durch variskische Strukturen mitbestimmt.
Geographisch geschult, sind wir gewohnt, vom Schwarzwald, vom Spessart, Taunus, der Schwäbischen Alb, dem Münsterland, dem Harz oder der Norddeutschen Tiefebene zu sprechen. Es bietet sich daher auch für den Zweck dieses Buches an, auf diesen Schulkenntnissen aufzubauen und Gebirge und Tiefländer in diesem Ordnungsschema vorzustellen. Als Geologe ist man auf der anderen Seite immer geneigt, das Problem der Darstellung zunächst einmal erdgeschichtlich anzugehen und so mit den ältesten Bildungen anzufangen. Dem folgen auch die Darstellungen in den neueren Büchern zur Geologie einzelner Bundesländer. Dann merkt man schon sehr bald, dass es mit dem Variskischen Gebirge allein nicht getan ist, weil auch die Ereignisse der wesentlich älteren kaledonischen Gebirgsbildung ihre Spuren in unseren Landschaften hinterlassen haben. Die meisten sind allerdings inzwischen so verwischt, dass man sie nur noch mit Mühe entziffern kann. Viele Kollegen führen noch heute einen erbitterten Streit, wie viele und welche der mechanischen Deformationen in den Variskischen Gebirgen eventuell einer kaledonischen Gebirgsbildung zugeschrieben werden können.
Im Zuge der ständig weiter verfeinerten physikalischen Altersbestimmungen an Mineralen und Gesteinen lässt sich heute auch noch wesentlich weiter und genauer zurückschauen. Zirkone im Bayerischen Wald haben ein verlässliches Alter von > 3800 Millionen Jahren ergeben (Gebauer et al. 1989), das darauf hinweist, dass wir es hier mit ganz alter kontinentaler Erdkruste zu tun haben; man könnte sich also durchaus weitere Gebirgsbildungsphasen zwischen dieser Zeit und dem altpaläozoischen Kaledonischen Gebirge vorstellen.
Alle Gebirge werden heute überwiegend im Kontext der Plattentektonik interpretiert; das muss man auch im Einzelfall berücksichtigen, wenn man Krustenstapelung, Metamorphosegrad, Deckenüberschiebungen oder fragliche Anteile ozeanischer Kruste diskutiert. Die Forschungen haben inzwischen bestätigt, dass es praktisch auch in allen unseren Mittelgebirgen eine den Alpen vergleichbare Deckentektonik gibt: in den Kristallingebieten von Schwarzwald, Harz, Erzgebirge und – besser verständlich – im Rheinischen Schiefergebirge und im Lahn-Dill-Gebiet. Damit werden diese Mittelgebirge auch bezüglich ihrer Entstehung den Alpen vergleichbar, wo die Strukturen noch besser erhalten geblieben sind. Die Kriterien in den von Sedimentgesteinen gekennzeichneten „Schiefer“-gebirgen sind überwiegend die Fossilien, die ein Übereinander von Gesteinspaketen anzeigen, bei denen gelegentlich ältere über jüngeren Schichten liegen. Dazu kommen manchmal auch Strukturen, die auf eine entsprechende mechanische Beanspruchung hinweisen, etwa Schrammen oder zermahlenes Gestein an der Basis solcher Decken. In den Kristallingebieten, wo paläontologische Alterskriterien fehlen, weil die Fossilien durch die Metamorphose zerstört sind, beruhen die Nachweise auf den an den Gesteinen ermittelten Druck- und Temperaturverhältnissen und auch der zunehmenden Anzahl von physikalischen Altersbestimmungen: Ältere und vormals unter höheren Drücken und Temperaturen gebildete Gesteine können auf weniger beanspruchten und jüngeren liegen, und solche Lagerungsverhältnisse sind vielfach erst nach den Laborstudien erkennbar.
Was man bisher nicht verstanden hatte, waren Gesteinskomplexe, die nicht zu denen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu passen schienen. Im Falle der Gießen-Decke war es anhand der geochemischen Charakteristik noch möglich, deren Gesteine aus einem fernen Ozean herzuleiten. Inzwischen hat man aber weitere solcher Decken erkannt, die auf sehr unterschiedliche und auch ferne Herkunftsgebiete verweisen. So sind im Rheinischen Schiefergebirge inzwischen mehrere ortsfremd entstandene Gesteinskomplexe nachgewiesen worden. Die Methode dazu lässt sich mit dem aktuellen Begriff „Provenienzforschung“ beschreiben, wie er auch bei Kulturgütern verwendet wird. Geologen arbeiten ähnlich, um den Entstehungsort von Gesteinskomplexen zu ermitteln, was im Zuge plattentektonischer Bewegungen zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Kriterien dafür sind die inzwischen zahlreichen Altersbestimmungen an Zirkonkristallen (Mende et al. 2018).
Das hier in seinen Strukturen vorgestellte Variskische Gebirge hatte, wie alle Gebirge, eine Vorgeschichte, die sich im Wesentlichen unter Wasser abspielte. Hier ist zunächst vom Rhenohercynischen Ozean die Rede. Über altkonsolidiertem präkambrischem Untergrund, wie ihn die Schollen von Eckergneis im Harz in winzigen Ausmaßen anzeigen, die vielleicht der Granit des Brockenplutons an die Oberfläche geschleppt hatte, entwickelte sich während des Devons durch Dehnung dieser alten Kruste ein Ozean, in den vom nördlich gelegenen Old-Red-Kontinent klastisches Material eingetragen wurde. Das war lange Zeit hindurch ein Flachmeer, in dem sandige Sedimente überwogen; gelegentlich kam es auch zu vulkanischen Ereignissen, die meist durch rhyolithische Tuffe und Begleitgesteine, aber auch Basalte dokumentiert sind.
Mit zunehmender Krustendehnung wurde dieses Meer tiefer und die Ablagerungen wurden feiner im Korn. Diese pelagische Zeit hat nicht nur überwiegend tonige Sedimente eines tieferen Wassers hinterlassen, sondern auch eine Vielzahl sehr unterschiedlicher vulkanischer Gesteine und Riffkarbonate. Lokal kann man daraus eine Art Südsee-Szenario rekonstruieren, allerdings dürften sich kaum Tiefseeverhältnisse darin entwickelt haben. Am Schelfrand bzw. auf submarinen Vulkanschwellen, die sich vor allem im oberen Mitteldevon entwickelt hatten, wuchsen Riffkarbonatkomplexe auf, die auch kalkigen Schutt in die benachbarten Beckenbereiche geschüttet hatten. Die wesentlich aus Korallen und Stromatoporen zusammengesetzten Riffbauten sind manchmal Hunderte von Metern mächtig und zeigen damit eine kontinuierliche Absenkung des Schelfrandes bzw. des vulkanischen Untergrundes an, die durch Aufwuchs immer wieder kompensiert wurde. Der Vulkanismus war überwiegend durch Basalte gekennzeichnet und dauerte zunächst bis in das tiefere Oberdevon hinein an; heute begegnen wir den Gesteinen in der grünlich gefärbten Version, die als Diabas bezeichnet wird. Ob die grünen, auf Chlorit und/oder Epidot zurückgehenden Farben durch eine leichte Metamorphose grünschieferfaziell überprägt wurden oder im unmittelbaren Anschluss an die Förderung der Basalte durch autometasomatische Meerwasser-Alteration entstanden sind, ist noch immer Gegenstand fachlicher Diskussionen. Erwiesen ist dagegen, dass es sich um sogenannten Intraplattenvulkanismus handelte; von tektonisch bedingten Ausnahmen abgesehen, gibt es im Rhenohercynikum keine echten ozeanischen Basalte.
In diese Zeit fallen auch weltweite Ereignisse, die in den Gesteinsfolgen der Variskischen Gebirge dokumentiert sind: Der Kellwasserkalk (Abb. 3) des unteren Oberdevons im Harz und im Rheinischen Schiefergebirge zeigt mit seinen schwarzen Lagen die kurzzeitigen Ereignisse an, die u.a. zum globalen Aussterben der Stromatoporen-Korallen-Riffgemeinschaft geführt hatten. Mehrere weitere solcher „Schwarzschieferereignisse“, die auf anoxische Episoden in den devonischen und karbonischen Weltmeeren hinweisen, sind mindestens europaweit gut zu verfolgen, machen aber ein weltweites Aussterbeereignis wahrscheinlich.
Als im höchsten Oberdevon die Bodenbewegungen der variskischen Gebirgsbildung einsetzten, kam es wieder zu einer verstärkt klastischen Sedimentation, die ihren Höhepunkt im Unterkarbon hatte. Dabei wurden vor allem Grauwacken gebildet, die sich während der dadurch belegten Flyschphase nach Art einer Front über das Rheinische Schiefergebirge hinweg nach Nordwesten bewegten.
Wie in jeder Entwicklung von Gebirgen üblich, folgte auch in den Variskischen Gebirgen auf die Flyschphase ein Molassestadium, in dem hauptsächlich während des Oberkarbons die vor dem nun gefalteten Gebirge liegende Saumsenke mit dem Schutt der aufsteigenden Gebirgsteile aufgefüllt wurde. Das war ein Raum zwischen Land und Meer, in dem sich Küstensümpfe entwickeln konnten, deren Versenkung und Überdeckung mit klastischen Sedimenten später zur Bildung von Steinkohlen führte.
Noch später wurde die gebirgsbildende Einengung wieder durch Dehnung der Erdkruste abgelöst und die landfest gewordenen Bergketten unterlagen der Abtragung, deren Schuttmassen sich während der Rotliegendzeit in den Binnensenken sammelten.
Die geschilderten paläogeographischen Verhältnisse sind eigentlich nur im Rhenohercynikum gut zu verfolgen, weil die Gesteinsfolgen dort überwiegend nicht metamorph sind. Vom Old-Red-Kontinent abgesehen, sind auch die Liefergebiete für manche der sandigen Sedimentfolgen nicht immer zweifelsfrei zu rekonstruieren. Aus Vergleichen mit den Nachbarregionen ergeben sich aber vielfach schlüssige Argumente, etwa aus einer nach der Bretagne benannten Mikroplatte, die als Armorica bezeichnet wird: Von dort kamen gut sortierte Sande, die sich sogar mit silurischen und altdevonischen Faunen im Harz und bei Gießen entsprechend einstufen und teilweise noch bis in das Ordovizium zurückverfolgen lassen.
Abb. 3: Kellwasserkalk. Nach einem Bach im Harz benannte Gesteinsassoziation, in der im Kalk dunkle Lagen schwarzer Tonschiefer vorkommen, die sehr reich an Biomasse sind. Damit haben wir auch in Deutschland einen Hinweis auf das weltweite Massenaussterben im unteren Oberdevon. Neuer Aufschluss im Kellwassertal (Harz). (Wikimedia Commons/nosmisiso)
Andere sandige Ablagerungen werden auf die südlich gelegene Mitteldeutsche Kristallinschwelle zurückgeführt, die im Devon in Erscheinung trat.
Am Südrand des Rhenohercynikums schließt sich ein Streifen metamorpher Gesteine an, der im Hunsrück, im Taunus und im südöstlichen Harz aufgeschlossen ist und der zusammenfassend als Nördliche Phyllitzone bezeichnet wird (Abb. 2). Er trennt das Rhenohercynikum von der südlich anschließenden Mitteldeutschen Kristallinschwelle; die Grenze ist eine scharf ausgebildete, tief reichende Störungszone, die u.a. als Hunsrück- bzw. Taunus-Südrandstörung bezeichnet wird.
Anders als es die Bezeichnung Phyllitzone nahe legt, sind die Gesteine durch eine mittelgradige grünschieferfazielle Metamorphose überprägt worden, wenn man von kleinen isolierten Gneisvorkommen absieht, deren präkambrisches Alter sie als Teil des alten Untergrundes kenntlich macht. Die Ausgangsgesteine waren tonige und sandige Sedimente und, besonders im Taunus, vielfach auch rhyolithische bis basaltische Vulkanite, woraus sich auch ein Vergleich mit einem Inselbogen ergibt.
Die Altersstellung dieser Gesteinskomplexe war lange Zeit spekulativ, aus Mangel an Fossilien hatte man die infolge der Metamorphose auch alt erscheinenden Gesteine einem nicht näher bestimmten „Vordevon“ zugeordnet. Nach physikalischen Altersbestimmungen und Funden von Mikrofossilien, die die Metamorphose überdauert hatten (Sporen, Acritarchen), weiß man heute, dass wenigstens ein Teil der Vulkanite ordovizisches bis silurisches Alter hat und einige der datierten Metasedimente in das Devon zu stellen sind. Unter den genannten Vulkaniten gibt es auch ozeanische Basalte. Gesteine der Nördlichen Phyllitzone sind im Harz in der Zone von Wippra aufgeschlossen; dazu gehören Grauwacken, Phyllite, Quarzite und Grünschiefer. Fossilfunde deuten an, dass mindestens ein Teil davon ordovizisches Alter hat und dass die Schichtfolgen auch devonische und eventuell sogar unterkarbonische Anteile enthalten. Neben einer Vielzahl vulkanischer Intraplatten-Gesteine, die heute als Metavulkanite vorliegen, gibt es auch in der Zone von Wippra ozeanische Basalte.
Infolge ihrer vielfältigen Überprägung ist es außerordentlich schwierig, die Gesteinskomplexe der Nördlichen Phyllitzone zu einem stimmigen paläogeographischen Bild zusammenzufügen.
Nachdem man festgestellt hat, dass sich die Gesteine und deren Alter von denen des nördlich anschließenden Rhenohercynikums nicht grundlegend unterscheiden, wäre die einfachste Interpretation die, dass hier nur der metamorph überprägte Südrand des Rhenohercynischen Beckens vorliegt. Im südlichsten Bereich der Phyllitzone deutet sich ein Gürtel von Grauwacken an, die diese von der Mitteldeutschen Kristallinschwelle trennen; in diesem Bereich kommen auch die Basalte mit Ozeanbodencharakteristik vor (sog. MOR-Basalte), wie sie, zusammen mit Grauwacken, die als Fremdkörper auf dem Rhenohercynikum liegende Gießen-Decke kennzeichnen. Danach läge dann hier deren Wurzelzone.
Im Süden schließt sich die Mitteldeutsche Kristallinschwelle an, die aus metamorphen und plutonischen Gesteinskomplexen aufgebaut wird; bei den Metamorphiten lassen sich Paragesteine (aus Sedimenten entstanden) und Orthogesteine (aus Magmatiten entstanden) unterscheiden. Die Gesteine der Mitteldeutschen Kristallinschwelle kommen fensterartig am Westrand des Oberrheingrabens bei Albersweiler, im Odenwald, im Spessart, im nördlichen Thüringer Wald und im Kyffhäuser an die Oberfläche; sonst sind sie nur aus Bohrungen unter den Sedimenten der Saar-Nahe-Senke und im Untergrund der Rhön bekannt.
Ein Vergleich der Geologie dieser Einzelgebiete hat ergeben, dass sie sich zwar ähneln, im Einzelnen aber doch so stark unterscheiden, dass man inzwischen sogar über eine Zusammensetzung aus einzelnen Krustensplittern (Terrane) spekuliert. Auch die Altersbestimmungen an den Gesteinen liefern sehr unterschiedliche Daten:
So reichen die Vorkommen in der Pfalz vom Kambrium (Albersweiler) bis ins Karbon (Neustadt) – was etwa, soweit es die älteren Anteile betrifft, auch für den Odenwald gilt, während im Spessart und in Thüringen auch Gesteine präkambrischen Alters gefunden wurden. Bisher gibt es nur sehr wenige verlässliche biostratigraphische Einstufungen, so z.B. im Spessart, wo in Quarziten der Geiselbach-Formation Sporen silurischen Alters gefunden wurden; die daran anschließenden Gesteinskomplexe hat man aufgrund der Lagerungsverhältnisse dann vom Ordovizium bis ins obere Präkambrium zurückverfolgt.
Die Metamorphose im Bereich der Mitteldeutschen Kristallinschwelle hat überwiegend die Amphibolitfazies erreicht, nur die Vorkommen in der Pfalz sind geringer beansprucht und in Bohrungen in Südbrandenburg sind sogar nicht metamorphe Grauwacken angetroffen worden. Die entscheidende Prägung geschah während der variskischen Gebirgsbildung, ältere Ereignisse sind aber wahrscheinlich.
Die Verschiedenheit der einzelnen Gebiete äußert sich auch darin, dass die individuellen Krustenblöcke unterschiedliche maximale metamorphe Beanspruchung erfahren hatten und das auch noch zu unterschiedlichen Zeiten. Ihre Hebung in das heutige (oder ältere) Erosionsniveau erfolgte ebenfalls zu unterschiedlichen Zeiten. Was an Gemeinsamkeiten bleibt, die man im Gelände ohne Hilfsmittel erfahren kann, ist ihr Aufbau aus diversen metamorphen Anteilen, in die mehr oder weniger große Plutone eingedrungen sind, die ihrerseits meist auch ein entsprechendes Ganggefolge hatten (Näheres bei den einzelnen Gebirgen).
Mit der daran anschließenden Saxothuringischen Zone, die sowohl durch hoch- als auch schwachmetamorphe Gesteinskomplexe gekennzeichnet ist, betritt man auch bezüglich der Interpretation wieder etwas sichereren Boden.
Der vielfach gut aufgeschlossene Bereich umfasst etwa das Thüringische Schiefergebirge, den Frankenwald und das Vogtland, und er lässt sich darüber hinaus nach Osten in das Erzgebirge bis zum Elbtalschiefergebirge verfolgen; damit ist gleichzeitig gesagt, dass auch Fichtel- und Erzgebirge sowie das Granulitgebirge zum Saxothuringikum gehören, wo teilweise hochmetamorphe Gesteine anzutreffen sind. Für die Konstitution des Saxothuringikums ist es erforderlich, einen eigenen Ozean zu rekonstruieren und diesen in einem plattentektonischen Konzept auch in eine räumliche und zeitliche Beziehung zum Rhenohercynischen Ozean zu bringen.
Man kann sagen, dass dieser Ozean sein Nordufer am Südrand der Mitteldeutschen Kristallinschwelle und sein Südufer am Nordrand des anschließenden Moldanubikums hatte; im Osten war möglicherweise der Rand der Osteuropäischen Plattform seine Grenze.
Der Ozean war ein Riftbecken, dessen Ablagerungen zeitlich vom Kambrium bis ins Devon reichen. Im höheren Devon und im Unterkarbon schloss sich dieser Ozean wieder, während sich gleichzeitig der Rhenohercynische Ozean zu öffnen begann; dabei wurden seine Gesteine teilweise unter das südlich angrenzende Moldanubikum subduziert – es existierte dort also ein aktiver Kontinentalrand. Vom Kambrium bis in das untere Ordovizium überwogen klastische Schelfsedimente und vulkanische Gesteine, vom oberen Ordovizium bis ins Unterkarbon folgten hemipelagische Sedimente, die eine Vertiefung des Meeres anzeigen, und im Karbon schließlich Flyschablagerungen. Diese Bildungen werden als thüringische Fazies zusammengefasst, der eine als bayerisch bezeichnete Fazies von Ablagerungen tieferen Wassers, teilweise mit Hornsteinen gegenüberstand, die sich aber ebenfalls aus küstennahen Flachwasserbildungen heraus entwickelt hatte; auch darin sind am Ende Flyschsedimente enthalten.
Es hat immer erhebliche Interpretationsschwierigkeiten gegeben, die beiden, räumlich eng benachbarten Faziesbereiche in ihrer Beziehung zueinander zu erklären, obwohl schon lange vor den heute ziemlich gut abgesicherten Deckenüberschiebungen von solchen tektonischen Kontakten die Rede war (Suess 1912). So wird heute die Gesteinsfolge der bayerischen Fazies als Teil einer ortsfremd lagernden Deckeneinheit angesehen, die ihren Ursprung im südöstlich gelegenen sogenannten Tepla-Barrandium hatte, das den nördlichen Teil des Moldanubikums bildet. Zusammen damit wurden wahrscheinlich auch weitere Decken über das Fichtelgebirge hinweg transportiert, die den Deckenstapel der Münchberger Masse aufgebaut hatten. Die Grünschiefer und Amphibolite an deren Basis repräsentieren dabei den alten basaltischen Ozeanboden, der im Süden durch die Erbendorf-Linie mit ihren Serpentinitkörpern gekennzeichnet wird.
Heute werden auch die beiden anderen kleineren Fremdelemente innerhalb des Saxothuringikums, nämlich die Gesteinskomplexe von Wildenfels und Frankenberg, als klippenartige Deckenreste interpretiert. Zu den Problemen im Saxothuringikum gehört auch die Erklärung der hochmetamorphen Kernzonen im Erzgebirge und im Granulitgebirge, in denen sogar Eklogite und Granulite vorkommen, beides Gesteine, die nur unter enormem Druck entstanden sein konnten. Die metamorphen Mantelgesteine, die diese Kerne außen umgeben, sind nämlich unter wesentlich geringeren Drücken gebildet worden. Die gemessenen physikalischen Alter zeigen mit 340 bis 360 Millionen Jahren aber für alle Einheiten variskische Alter.
Um dieses Problem zu lösen, hat Franke (in Dallmeyer et al. 1995) vorgeschlagen, dass die Kernbereiche vorvariskischen Untergrund repräsentieren könnten, der schon vor Beginn der Ablagerung der paläozoischen Sedimente herausgehoben war und danach einen zweiten metamorphen Zyklus mit diesen zusammen durchlief, wobei die variskischen Alter in den entsprechenden „geologischen Uhren“ eingestellt wurden; damit entspricht das gemessene Alter dem thermischen Ereignis, gibt aber nicht in allen Fällen das ursprüngliche Alter der Gesteine selbst an.
Der deutsche Anteil des südlich an das Saxothuringikum anschließenden Moldanubikums ist im Osten im Bayerischen Wald und im Westen überwiegend nur im Schwarzwald aufgeschlossen; über das Rheintal hinweg gehören auch die Vogesen überwiegend zum Moldanubikum. Man kennt entsprechende Gesteine aber auch aus Bohrungen, die das Deckgebirge der Schwäbischen Alb durchteuft haben, sowie aus dem Nördlinger Ries, sodass ein zusammenhängender Verlauf dieser Zone anzunehmen ist. Seine gut studierte Typusregion ist aber Böhmen, das außerhalb des in diesem Buch behandelten Bereiches liegt; dort gibt es in der Mulde von Prag eine als Barrandium bezeichnete Gesteinsfolge, die die nahezu einzigen Vorkommen kambrischer bis mitteldevonischer Gesteine im Moldanubikum darstellen, welche nicht metamorph überprägt wurden, weil sie auf einem altkonsolidierten präkambrischen Untergrund auflagern. Alles Übrige sind Metamorphite, die z.T. bereits cadomisch, kaledonisch und schließlich variskisch überprägt wurden. Das macht es verständlich, warum man in diesen polymetamorphen Gesteinen kaum noch etwas von den ursprünglichen Verhältnissen erkennen kann. Die Ausgangsgesteine waren wahrscheinlich Sedimente und Magmatite, deren Alter vom Jungpräkambrium bis mindestens in das Silur reichten.
Innerhalb des metamorphen Moldanubikums sind heute nicht nur in Böhmen, sondern auch im Schwarzwald und in den Vogesen Deckenüberschiebungen erkannt worden; Hauptkriterium hier ist, dass unter hohen Drücken gebildete Gesteinskomplexe über solchen niederer Metamorphose angetroffen werden. Die Deckenüberschiebungen erfolgten im Zusammenhang mit der variskischen Gebirgsbildung, während der auch die meisten granitischen Gesteine gebildet wurden. Dabei lassen sich ältere granitische Komplexe, die noch von der Tektonik betroffen und teilweise Scherbewegungen ausgesetzt waren, von jüngeren unterscheiden, die keine solche Beanspruchung mehr erkennen lassen.
Es gibt Hinweise auf einen etwa spiegelbildlichen Verlauf der variskischen Zonen: Im Südosten des Böhmischen Massivs schließen sich Zonen an, die als Moravo-Silesikum und Sudetikum bezeichnet werden und nach den Landschaften in Mähren, Schlesien und den Sudeten benannt sind. Das Moravo-Silesikum gilt als Äquivalent der Saxothuringischen und das Sudetikum als das der Rhenohercynischen Zone; so kann man die Faltenstränge bogenartig um den moldanubischen Kernbereich Böhmens herum verfolgen – was allerdings, wie bereits gesagt, den Rahmen unserer Darstellung verlässt.
Alle plattentektonischen Erklärungsansätze für die mitteleuropäischen Variskischen Gebirge haben mit dem Problem zu kämpfen, dass man, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine richtigen ozeanischen Basalte bzw. die mit ihnen zusammen sonst üblichen Ophiolithkomplexe gefunden hat. Unbestritten bleibt aber, dass es Dehnungsprozesse gegeben hat, die zur Entwicklung größerer Becken geführt haben, und ebenso unbestritten ist, dass die Füllung dieser Becken später gefaltet und zusammengeschoben wurde; die Kruste wurde also erheblich verkürzt und dabei wurde auch ein Teil dieser Beckeninhalte subduziert. Für die schon im Devon beginnenden Flyschphasen führte diese Einengung auch zu Überschiebungen, die sogar das Ausmaß von Decken erreichen konnten. Deren Transport erfolgte im Bereich der Münchberger Masse bzw. der Gießen- und Ostharz-Decken nach Norden sowie im südlichen Schwarzwald und in den Vogesen nach Süden. Damit ist ein Wandern der Bewegungen von einer inneren Kernzone des Gebirges jeweils nach außen erkennbar.
Nach bzw. mit dem Aufstieg des Gebirges entstanden die Molassen, die den Abtragungsschutt darstellen, der in Binnentrögen und am Außenrand des Gebirges abgelagert wurde. Im Variskischen Gebirge entstanden so zur Zeit des Oberkarbons die Ablagerungen der Subvariszischen Saumsenke mit ihren Steinkohlen, die nachfolgend ebenfalls noch in die Faltung einbezogen wurden; entsprechendes gilt für den südöstlichen Bereich der oberschlesischen Kohlebecken. Damit endeten die Einengungsprozesse. Es folgten, im höchsten Oberkarbon und im unteren Perm, Scherungs- und Dehnungsprozesse in der Erdkruste, bei denen sich Nordwest-Südost und Nordnordost-Südsüdwest verlaufende Störungen entwickelten.
Daneben blieb im Gebirge aber die alte, durch den Faltungsprozess verursachte Südwest-Nordost-Richtung noch erhalten. Ihr folgten die Tröge, in denen sich ebenfalls ab dem Oberkarbon, verstärkt aber während des Rotliegends, die Binnenmolassen ablagerten, zu denen u.a. auch die Saarkohlen gehören. Diese Binnentröge sind infolge des aktiven Einsinkens gelegentlich mit kilometermächtigen klastischen Sedimentfolgen verfüllt worden; ihr aktives Einsinken ist eine Folge der Dehnungstektonik, die an den nachfolgenden Störungen in diesen Ablagerungen beobachtet werden kann. Durch die Krustendehnung wurden nun auch wieder Gesteinsschmelzen die Wege geöffnet, die sich vielfach mit den permischen Sedimenten verzahnten; die meisten sind rhyolithisch, was gelegentlich zu explosivem Vulkanismus oder zum domartigen Aufdringen des zähplastischen Materials geführt hat. Solche Schmelzen haben ihren Ursprung in der Kruste, während die ebenfalls in dieser Zeit gebildeten intermediären und vor allem die basischen Gesteine durch tiefer reichende Brüche erklärbar sind, die auch Schmelzen aus dem Erdmantel als Aufstiegswege dienten.
Gebirgsbildung geht immer auch mit einer Aufheizung von Gesteinen einher – infolge der Stapelung von ganzen Krustenpaketen kommt es im tieferen Teil zur Metamorphose und darüber hinaus auch zur Aufschmelzung. Die dabei entstehenden Gesteinsschmelzen steigen auf, weil sie leichter sind als ihre Umgebung, und dringen in Form von Plutonen in die Rahmengesteine ein. Solche Schmelzen haben meist eine granitähnliche Zusammensetzung und sie unterscheiden sich damit grundlegend von den basaltischen Schmelzen, die im Normalfall den Beginn und den Verlauf von ozeanischen Becken begleiten. In früheren Definitionen hatte man in diesem Fall von einem „initialen“ Vulkanismus gesprochen und die granitischen Schmelzen einem „synorogenen“ Magmatismus zugeordnet.