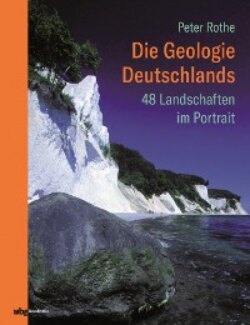Читать книгу Die Geologie Deutschlands - Peter Rothe - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеGemäß diesem Anspruch scheint es vermessen, hier eine regionale geologische Beschreibung Deutschlands vorzulegen, die sich nicht nur an die Fachgeologen wendet. Die gute Aufnahme meiner Bücher ›Erdgeschichte‹, und ›Gesteine‹ durch einen breiten Leserkreis hat mich aber bewogen, nach den stofflichen und zeitlichen Aspekten nun in einem weiteren Buch auch noch die räumlichen aufzugreifen – und damit eine Trilogie komplett zu machen.
Zu Landschaften habe ich eine emotionale Beziehung. Zu meinem Beruf als Geologe in Lehre und Forschung gehört es, den interessierten Zuhörern die Entstehung von Landschaften zu erklären. Wenn ich eine Exkursion plane, sind Karten zwar die Basis, meine Kenntnisse über Landschaften verdichten sich aber weit darüber hinaus zu inneren Bildern, die sich aus Erfahrung über Gesehenes oder aber einer Imagination der Landschaft aus dem darüber Gelesenen ergeben: eine vielfältige „mental map“, die durchaus auch mit Erinnerungen an Erlebnisse in den betreffenden Gebieten aufgeladen sein kann. Die meisten der in diesem Buch geschilderten Landschaften kenne ich aus eigener Geländeerfahrung, von Exkursionen mit Studierenden, Reisen und Wanderungen mit Freunden. Es wäre schön, wenn sich für die Leser aus dem einen oder anderen Kapitel dieses Buches ähnliche Bilder auftun würden, im Zusammenspiel zwischen Gekanntem, selbst Erfahrenem und dem hier Aufgeschriebenen.
Geologen beginnen ihre Beschreibungen immer mit den ältesten Gesteinskomplexen, die in der behandelten Gegend anzutreffen sind; das ist in jeder Erläuterung zu einer geologischen Karte nachzulesen und dieses Prinzip gilt auch für Bücher, in denen die Erdgeschichte dargestellt wird. Dies ändert sich nur, wenn man für die Entschlüsselung der Gesteinsfolgen im Untergrund auf Bohrungen angewiesen ist, deren Profile dann bei ungestörter Abfolge der Schichten zunächst von oben nach unten gelesen werden. Man könnte dies auch bei regionalgeologischen Beschreibungen anwenden, wobei dann im Extremfall mit der Beschreibung der Bodenbildungen zu beginnen wäre. Da diese aber nur den letzten dünnen Schleier über die Landschaft breiten, werden sie auch hier kaum einmal erwähnt. Die Entstehung der Landschaftsformen ist die Domäne der Physischen Geographie, die ihre Erklärungsansätze allerdings nicht ohne die geologischen Gegebenheiten begründen kann. Von diesen Gegebenheiten soll hier vor allem die Rede sein.
Als Geologe beginne ich im Einführungskapitel mit dem für Deutschland wichtigsten System der Variskischen Gebirge und diskutiere kurz deren Entwicklung, die heute nicht ohne plattentektonischen Ansatz erfolgen kann. Diese Gebirge hatten schon ältere Vorläufer, die allerdings nicht überall gut zu erkennen sind – besser haben es zumeist die Kollegen der europäischen Nachbarländer. Über den wahrscheinlichen Untergrund des Rheinischen Schiefergebirges erfährt man z.B. mehr aus dem Studium der Ardennen.
„Der hohe Bildungswert der Geologie beruht vornehmlich darauf, dass sie unser Auge öffnet für eine ganze Welt von natürlichen Erscheinungen und Vorgängen, an denen die meisten Menschen achtlos vorübergehen“ (Johannes Walther, Professor für Geologie an der Universität Halle [1860 – 1937]. Von ihm stammt die erste Geologie Deutschlands (1910).
„Die Grundlage jeder regionalgeologischen Betrachtungsweise bildet die Stratigraphie. Auf sie muss sich auch die regionaltektonische Untersuchung einer Landschaft stützen. Es würde aber eine Regionale Geologie sicherlich einseitig sein, wenn man nicht auch die anderen Teile unseres Faches mit berücksichtigen würde. Aus diesem Grunde stellen von jeher regionalgeologische Vorlesungen an Dozenten wie an Hörer die höchsten fachlichen Anforderungen; sie bilden gewissermaßen das „Hohe Lied“ unserer Fachvorlesungen“ (Paul Dorn 1951/1960).
Auch Landschaften im Sinne der Geographie sind letztlich Konstrukte. Früher hatte ich einmal geschrieben, dass sich die Erforschung von Inseln allein deshalb so großer Beliebtheit erfreut, weil man es auf ihnen mit klar abgegrenzten Bereichen zu tun hat. Im vorliegenden Fall ist das natürlich anders: Die Alpen sind nicht auf Bayern beschränkt und das Rheinische Schiefergebirge findet zwangsläufig seine geologische Fortsetzung jenseits der Landesgrenzen, z.B. in den Ardennen. Weit darüber hinaus ist es Teil eines großen Gebirgssystems, das über England, die Bretagne, das französische Zentralmassiv usw. bis nach Süd-Portugal reicht und Entsprechungen selbst noch in Marokko hat. Auch im Osten greift es weit über Deutschlands Grenzen hinaus.
Anders als die Erdgeschichte, die immer zunächst den zeitlichen Bezug herstellen muss, befasst sich Regionale Geologie mit einzelnen Gebirgen oder Landschaften, die sie in ihrer Entstehung zu begreifen sucht. Das ist nur möglich, wenn man zeitliche und stoffliche (d.h. die Gesteine) Gegebenheiten auch räumlich miteinander kombiniert, sozusagen die „innere Architektur“ einer Landschaft zu konstruieren sich bemüht, um daraus das Geschehen abzuleiten, das zum heute Beobachtbaren geführt hat. Ablagerungen mit einem, meist durch Fossilien, definierten Alter können in der Folgezeit auf unterschiedliche Weise deformiert werden: Durch Einengung (des betreffenden Bereichs) der Erdkruste können sie zusammengedrückt, gefaltet, zerrissen oder überschoben werden, sodass manchmal ältere über jüngere Gesteinskomplexe zu liegen kommen, oder sie werden infolge von Dehnungsprozessen auseinandergerissen, wobei dann Grabenstrukturen entstehen, wie z.B. der Oberrheingraben. Die Plattentektonik hat eine ganze Reihe solcher Prozesse erklärbar gemacht, dennoch sind bei Weitem nicht alle entsprechenden Phänomene schon endgültig ausgedeutet.
Das Buch möchte dazu beitragen, die deutschen Landschaften in ihrem geologischen Werdegang ein wenig besser zu verstehen. Der Stand der Erforschung ist, obwohl manche Gegend schon seit Jahrhunderten Gegenstand geologischer bzw. „geognostischer“ Untersuchungen ist, noch immer nicht in allen Gebieten gleich. Auch der Kenntnisstand des Autors ist unterschiedlich, und schließlich bedingen auch die Komplexitätsunterschiede der geologischen Gegebenheiten die Darstellung. Dennoch habe ich versucht, zu einem einigermaßen einheitlichen Bild zu kommen.
So ist es bei der Behandlung der einzelnen Landschaften für den Aufbau dieses Buches vielleicht nicht so sehr von Belang, die gesamte dort am Aufbau beteiligte Schichtenfolge mitsamt ihren Entstehungsbedingungen durchzudeklinieren. Vielmehr soll ein Gesamteindruck vermittelt und auf interessante Details hingewiesen werden, die auch zu sehen sind oder die für die Geologie der betreffenden Gegend Besonderheiten darstellen oder prägend sind.
Im Text wird deshalb gelegentlich auf besonders interessante Punkte oder Orte hingewiesen, die der näheren Betrachtung lohnen. Diese Hinweise sind subjektiv und durch gewisse Vorlieben des Verfassers zumindest beeinflusst. Dennoch sind sie nicht willkürlich ausgewählt. Sie sollen einen Bezug herstellen zur Landschaft und ihrem geologischen Werdegang, und sie sollen dazu anregen, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Anregungen dazu geben auch die Bilder, die mir durch den Verlag in großzügiger Weise bewilligt wurden und die in der 4. Auflage erheblich erweitert werden konnten.
Bei den Abbildungen sind Fotos und Zeichnungen etwa zu gleichen Anteilen vertreten. Die Landschaftsfotos sind mit den Augen des Geologen gemacht und ich habe dabei weitgehend versucht, die Zusammenhänge zu beleuchten bzw. das Typische einer Landschaft einzufangen. Fast instruktiver noch als Fotos sind die Blockbilddarstellungen des Kollegen Wagenbreth, von denen einige fast direkt übernommen, gelegentlich noch etwas vereinfacht und mit Farben gestaltet wurden.
Im Text wird immer wieder auch auf Rohstoffe verwiesen, die in ihrem Ursprung stets an die lokalen und/oder regionalen geologischen Prozesse gebunden sind.
In einem Einführungskapitel wird zunächst der großgeologische Rahmen erörtert, in den dann später die einzelnen Landschaften eingeordnet und bezüglich ihrer individuellen Ausprägung dargestellt werden.
Fast alle farbigen Zeichnungen wurden neu angefertigt, wobei wir in den meisten Fällen bereits auf geeignete Vorlagen zurückgreifen konnten. Das betrifft in besonderem Maße einige der geologischen Übersichtskärtchen, die dem Buch des Kollegen Walter (›Geologie von Mitteleuropa‹) entnommen, farbig aufbereitet und gelegentlich auch verändert worden sind. Die kleine Auswahl kann aber geologische Karten nicht ersetzen, die man bei weitergehendem Studium natürlich hinzuziehen sollte.
Um Platz zu sparen, werden in einigen Fällen auch Profile präsentiert, die die Schichtfolgen in einem bestimmten Gebiet darstellen.
Im Text sind gelegentlich, aber eher spärlich, die Arbeiten von Kollegen zitiert, sofern sie unmittelbaren Bezug zum Thema haben; dabei habe ich mich wesentlich auf aktuelle Arbeiten beschränkt, alles andere hätte den Rahmen gesprengt. Weiterführende Literatur ist jeweils an den Kapitelenden aufgeführt. Am Ende des Buches ist ein Glossar angefügt, das wichtige Fachausdrücke erklärt. Für Leser, die mehr wissen wollen über die stofflichen Gegebenheiten und die Zeitbezüge im Werden der Landschaft, darf ich auf meine Bücher ›Gesteine‹ und ›Erdgeschichte‹ verweisen, die zuvor im selben Verlag erschienen sind.
Das beträchtliche Wagnis, ein Buch wie das vorliegende zu schreiben, lässt sich ohne einen entsprechenden Mitarbeiterstab heute nicht mehr eingehen. So habe ich vielen Personen zu danken, die daran beteiligt waren.
Roswitha Osthoff, meiner langjährigen Sekretärin, vorab; sie wurde niemals müde, meine nicht immer gut lesbare Handschrift in das Typoskript zu übersetzen und geduldig die ständigen Änderungen einzuarbeiten. Martin Schmitteckert hat den überwiegenden Teil der Zeichnungen ausgeführt; das beschränkte sich nicht allein auf die Digitalisierung der vorhandenen Abbildungsvorlagen, sondern er hat die meisten unter Zuhilfenahme geologischer Karten oder Profile sehr gewissenhaft überprüft und entsprechend korrigiert. So erscheint es mir gerechtfertigt, seine vorzügliche Arbeit auch durch die Erwähnung im Titel zu würdigen. Für die sorgfältige Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses und beider Register danke ich Susanne Blattner. Ronald Burger hat im Internet herausgefunden, welcher Bergbau wann eingestellt wurde, und Constanze Blübaum hat vielfältige PC-Hilfe geleistet.
Die meisten der behandelten Landschaften haben wir auf Exkursionen und Geländepraktika kennengelernt, und dort haben uns die örtlichen Steinbruchbetreiber ihre Betriebe zugänglich gemacht; sie einzeln hier aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Viel habe ich von den Autoren profitiert, die mir während meiner langjährigen Tätigkeit als Schriftleiter für den Oberrheinischen Geologischen Verein Beiträge zu dessen Exkursionsprogramm geliefert hatten; das gilt in gleicher Weise für meine Tätigkeit als Herausgeber der „Sammlung geologischer Führer“ des Borntraeger-Verlags, und es wird auch im Literaturverzeichnis deutlich, in dem viele andere Kollegen ihre Aufsätze vermissen werden; meine diesbezügliche Auswahl ist willkürlich und vor allem auf eher verständliche Zusammenfassungen beschränkt.
Einige der Fotos stammen von meinen Studenten bzw. Seniorenstudenten; deren Namen sind bei den Abbildungen angeführt. Die ganz wenigen Bilder aus den 1960er Jahren stammen aus meiner studentischen Tätigkeit im hessischen Eisenerzbergbau.
Bei der WBG hat Harald Vogel als vormaliger Lektor den Gedanken einer Regionalen Geologie aufgegriffen und mich zum Schreiben ermutigt, in seinem Nachfolger Wolfram Schwieder hatte ich stets einen freundlich-konzilianten Gesprächspartner. Das fachliche Lektorat von Gerd Hintermeier-Erhard hat dem Manuskript den nötigen Feinschliff gegeben. In der Herstellung haben anfangs Karl Ferger und dann vor allem Myriam Nothacker ganz vorzügliche Arbeit geleistet. Schließlich bin ich glücklich darüber, dass die graphische Bearbeitung auch dieses Buches in den Händen von Elke Göpfert, Marion Mayer und Joachim Schreiber lag.