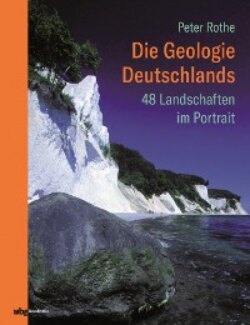Читать книгу Die Geologie Deutschlands - Peter Rothe - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Zeit nach der Variskischen Gebirgsbildung – ein neuer Baustil
ОглавлениеVom ausgehenden Paläozoikum an, vor allem aber seit dem Mesozoikum nimmt dann das landschaftsbildende Geschehen einen gänzlich anderen Verlauf. Gneise, Granite und die damit verwandten Gesteine der älteren Gebirgsbildungen, auch die gefalteten Sedimentgesteine, fasst man unter dem Begriff Grundgebirge zusammen. Mit dem jüngsten Paläozoikum beginnt das von solchen Deformationen nicht mehr oder kaum noch betroffene Deckgebirge. Das alte Gebirge wurde zusehends eingeebnet, es entstand zunächst eine weit reichende Landoberfläche, aus der z.B. im Schwarzwald immer noch einzelne Höhenrücken herausragten, die als Schuttlieferanten wirksam waren. In der nachfolgenden Zechsteinzeit entwickelte sich ein Meeresbereich, dessen Ablagerungen vor allem im Untergrund von Norddeutschland zu finden sind; sie reichen insgesamt von der südlichen Nordsee bis weit nach Polen hinein. Damals wurden unter weitgehend ariden Klimabedingungen Karbonate, vor allem aber Evaporite gebildet und es entstanden Anhydrit, Gips, Steinsalz und die wertvollen Kalisalze. Dieses aus Norden eindringende Meer hatte Ausläufer bis weit nach Süddeutschland hinein, wo dann anstelle der Salze randnahe Karbonate und der vom Schwarzwald bekannte Karneoldolomit gebildet wurden. Man kann die Salzbildungsfolgen heute in insgesamt 7 Zyklen gliedern, von denen die jüngsten vor allem im Nordseebereich entwickelt sind. Seitdem man aber auch in den früher zum Unteren Buntsandstein gezählten Schichten evaporitische Bildungen angetroffen hat (meist nur in Bohrungen, wo diese noch nicht aus den Gesteinen herausgelöst sind), werden die entsprechenden Schichten heute in den Zechstein eingeordnet.
Im Zusammenhang mit der zunehmenden Einebnung des Variskischen Gebirges werden am Übergang vom Perm zur Trias die im Rotliegend noch überwiegend grobklastischen Schuttablagerungen zunehmend feiner, bis im Buntsandstein Sand, Silt und Tone vorherrschen, die in Süddeutschland nur durch gelegentliche Gerölllagen unterbrochen werden. Die Sedimente stammen aus einem im Südwesten gelegenen Liefergebiet, u.a. dem Französischen Zentralmassiv, und wurden durch pendelnde Flüsse mit episodisch stark wechselnder Wasserführung über ganz Deutschland bis in den Bereich der Nordsee verteilt.
Auf ihrem Weg wurden die Sedimente auch zunehmend feinkörniger. Die Flusslandschaft war von Dünen und kleinen, episodisch austrocknenden Tümpeln begleitet, in deren Schlamm gelegentlich größere Wirbeltiere ihre Fußstapfen hinterlassen haben (z.B. die Fährten des „Handtiers“ [Chirotherium]). Die Mächtigkeit des Buntsandsteins, die in Schwarzwald und Odenwald einige Hundert Meter beträgt, erreicht schon in Hessen und Niedersachsen über 1000 m und kennzeichnet damit eine Beckensituation, die weitgehend den Verhältnissen der Zechsteinzeit entspricht.
Dallmeyer et al. 1995, Franke 1989, 1997, 2000, Franke et al. 1995, Okrusch et al. 1990, Weber & Behr 1983
In der nachfolgenden Muschelkalkzeit bestimmte dann wieder das Meer die Szenerie. Der Einbruch kam diesmal aus dem südlich angrenzenden Tethysmeer, in dem auch die Wiege der Alpen zu suchen ist. Die Ablagerungen sind, wie schon der Name sagt, wesentlich Kalke und gelegentlich Tone, die die Kalke untergliedern. Von den Beckenrändern her wurde aber auch Sand eingetragen, sodass man im Saarland z.B. von Muschelsandstein spricht. Das Muschelkalkmeer war ein Flachmeer, das gelegentlich verbrackte, mit Teilbereichen, in denen sich aus den Gesteinen auch unterschiedliche Tiefen und unterschiedlich starke Wasserbewegungen rekonstruieren lassen (z.B. Tonplattenfazies in tieferen und Schaumkalkbänke im flachen Wasser); daneben gab es Priele wie im Wattenmeer, durch Trockenrisse angezeigte Auftauchbereiche u.a.m.
Im Mittleren Muschelkalk war das Becken von der Tethys weitgehend abgeriegelt, das Wasser dampfte immer wieder ein, und es kam zur Bildung von Steinsalzlagerstätten (Heilbronn, Kochendorf). Die leichte Löslichkeit des Salzes führt z.B. im Bereich des mittleren Neckartals zur Auslaugung der Salzgesteine, sodass bis heute der hangende Kalk des Oberen Muschelkalks oft in Form großer Schollen abbricht.
Vollmarine Verhältnisse herrschten hauptsächlich während des Oberen Muschelkalks, wie man an den Ceratiten, deren Verwandte in der Tethys lebten, und an den berühmten Seelilienfunden erkennen kann.
Im Keuper überwog dann wieder eine eher festländisch geprägte Landschaft. Die nun weiter erniedrigten Randgebiete lieferten nur in ihrer unmittelbaren Nähe noch grobes, sonst aber weitgehend feinkörniges Material, das z.T. sogar durch Winde verfrachtet wurde. Es entstanden flachgründige Playaseen, deren Wasser zeitweise eindampfte und Evaporite hinterließ (hier hat z.B. die Schichtbezeichnung „Gipskeuper“ ihren Ursprung). Phasenweise wurde die Landschaft von großen Flusssystemen geprägt, deren Hinterlassenschaften als Sandsteine rinnenförmig in die liegenden Tone eingetieft sind (Schilfsandstein und mehrere aufeinander folgende Stubensandsteine). Die Erosion hat sie heute aus den weicheren Begleitgesteinen herauspräpariert, wobei dann Bergrücken wie Heuchelberg oder Stromberg entstanden sind.
Mit dem Jura erlebte auch Deutschland einen erneuten Meereseinbruch, der zu großräumigen Überflutungen führte. Zu Beginn entstanden im randlichen Bereich vor allem Sande, insgesamt überwogen aber dunkle Tone, die zur Bezeichnung Schwarzjura für den unteren Anteil geführt haben. Im Mitteljura herrschten dann Sand- und Tonablagerungen eines recht flachen Meeres, wobei im Küstenbereich und um große Inseln herum die einstmals wirtschaftlich wichtigen oolithischen Eisenerze entstanden sind (Ostalb, aber auch im Bereich des südlichen Oberrheingrabens und an der unteren Weser). Diese meist braun gefärbten (daher Braunjura) Gesteine werden im Oberjura dann durch mächtige Karbonatkomplexe abgelöst, deren helle Farben den Begriff Weißjura geprägt haben. Sie bilden die charakteristischen Landschaften der Schwäbischen und Fränkischen Alb, sind aber auch vielfach am Aufbau der Mittelgebirge im südlichen Niedersachsen beteiligt. Die Karbonate sind meistens Flachwasserbildungen, in denen neben gut gebankten und oftmals durch Mergelzwischenlagen getrennten Kalksteinen auch massige, oft dolomitische Partien entwickelt sind, die wenigstens teilweise als Riffe interpretiert werden müssen. Auch dieses Meer drang zunächst von Süden aus dem Tethysraum vor und hat sich während des obersten Weißjura wieder dorthin zurückgezogen. Das norddeutsche Weißjurameer dagegen hatte Verbindung zum Nordseeraum, sodass dessen Gesteine und Fossilien eher eine Verwandtschaft zum Jura Englands erkennen lassen.
Die Regression und die durch diese räumliche Teilung bereits eingeleiteten Verhältnisse, nämlich ein trennender Festlandsbereich zwischen beiden Teilmeeren etwa im Gebiet des Rheinischen Schiefergebirges, leitet zu den Verhältnissen der unteren Kreidezeit über, die durch brackische Ablagerungsräume, Sumpfwälder und Flusssysteme gekennzeichnet waren. Das erklärt die kohleführenden Wealden-Ablagerungen in den kleinen Gebirgen Südniedersachsens, die u.a. im Deister und in den Bückebergen entwickelt sind (und die dort zu der heute gebräuchlichen Bezeichnung „Bückeberg-Formation“ geführt haben).
Erst während der Oberkreide gerieten wieder weite Bereiche unter Meereseinfluss; das betraf allerdings, von einzelnen großen Buchten im Randgebiet des Bayerischen Waldes abgesehen, vor allem Norddeutschland, wo im Münsterland und an seinen Rändern etwa 2000 m mächtige Oberkreide gebildet wurde. Darüber hinaus ist Oberkreide im Untergrund des gesamten norddeutschen Flachlands erbohrt und kommt an der Ostseeküste, z.B. auf Rügen, auch wieder an die Oberfläche. Die Gesteine sind weitgehend kalkig, meist als Schreibkreide entwickelt und enthalten lagenweise Feuersteine.
Im Südosten entstanden zu dieser Zeit sandige Ablagerungen, die auf den festlandsnahen Randbereich Böhmens bzw. auf die diesen umgebenden variskischen Gebirgsteile der Sudeten zurückzuführen sind. Sie bilden die heute von der Erosion zerfressene Landschaft des Elbsandsteingebirges bzw. der südlichen Lausitz. In Richtung Dresden gehen diese küstennahen Sandablagerungen allmählich auch in die plattigkalkigen Sedimente des sogenannten Pläners über, die damit tieferes Wasser anzeigen. Das übrige Deutschland war zu dieser Zeit Festland, auf dem die chemische Verwitterung immer intensiver wurde und vor allem während des Alttertiärs unter feuchtheißem Klima die Gesteine des Untergrundes zersetzte und mächtige Tonablagerungen einer gelegentlich Zehnermeter dicken Verwitterungsdecke hinterließ.
Damals entwickelten sich auch die weitläufigen Rumpfflächen der Mittelgebirge, die zeitgleich und im Anschluss an die Heraushebung von Wasserläufen zertalt wurden. Auf geologischen Karten ist oft erkennbar, dass diese tektonisch vorgeprägten Kluftsystemen folgen.
Die jüngeren Tertiärablagerungen sind, von kurzzeitigen Meereseinbrüchen in zuvor entstandene Senkungsgebiete abgesehen, meist fluviatile und limnische Sedimente, unter denen vor allem die Braunkohlen des älteren und des jüngeren Tertiärs (Eozän, Mio-Pliozän) eine besondere Stellung einnehmen.
Die Senken, in denen sie sich bildeten, sind entweder tektonisch bedingte Grabenstrukturen oder durch Auslaugung von meist zechsteinzeitlichen Salzgesteinen im Untergrund bedingt. Viele unserer heutigen Flusssysteme wurden bereits im Pliozän, zum Teil sogar schon früher angelegt.
Wie die paläozoischen Ablagerungen durch die variskische Gebirgsbildung und deren ausklingende Bewegungen strukturell geprägt wurden, so sind auch die Gesteine des Mesozoikums von einer Tektonik betroffen worden, die man nach den frühen Untersuchungen von Hans Stille in den niedersächsischen Gebirgen als Saxonische Tektonik bezeichnet. Die dabei entstehenden Gebirge hat man Bruchfaltengebirge genannt. An ihrer Genese, die sich im Gegensatz zu den „richtigen“ Gebirgen in einem sehr oberflächennahen Stockwerk abspielt, ist in vielen Fällen das Salz im Untergrund als wesentlicher Faktor beteiligt. Die Bewegungen begannen schon im obersten Jura und man konnte dabei – ähnlich wie im Paläozoikum – mehrere Phasen unterscheiden, die vor allem innerhalb der Kreideschichtenfolge erkennbar sind und bis in das Alttertiär hinein verfolgt werden können.
Diese Tektonik ist im Zusammenhang mit der Entstehung der Alpen zu sehen bzw. in einem noch weiteren Rahmen mit der Erweiterung des Atlantiks. Die entsprechenden Spannungen in der Erdkruste haben zu meist Nordwest streichenden Einengungsstrukturen geführt, wie sie großräumig im sogenannten Niedersächsischen Tektogen vom Teutoburger Wald bis in den Raum des Harzvorlandes beobachtet werden können. Dabei kam es gelegentlich sogar zu kleinräumigen Deckenüberschiebungen oder zur Überkippung ganzer mesozoischer Schichtpakete wie am nördlichen Harzrand. Man spricht deshalb auch von „subhercynischen Bewegungen“, die mitunter sogar in einzelne Phasen untergliedert werden können (Wernigeröder, Ilseder Phase, beide innerhalb der Oberkreide).
Den Einengungsstrukturen, die unter Mitwirkung des Salzes im Untergrund viele der Bergzüge im südlichen Niedersachsen bewirkt haben, stehen große Dehnungsfugen gegenüber, die die Landschaft in Form von tektonischen Gräben durchziehen – wie der Leinetalgraben bei Göttingen; diese haben vielfach Nord-Süd-Richtung. Das Zerbrechen der Gesteinsfolgen bedingte schließlich eine Vielzahl von Schollen, die oft auch in unterschiedliche Richtungen gekippt sind. Im Zusammenhang damit ist auch zu erklären, warum im Niedersächsischen Tektogen so viele unterschiedlich alte Gesteine in den verschiedenen kleinen Gebirgen anzutreffen sind.
Die junge Tektonik hat eine Vielzahl von Brüchen verursacht, die oft auch morphologisch in der Landschaft zu verfolgen sind. Das prominenteste Beispiel ist der Oberrheingraben, dessen Bruchsystem sich über die Wetterau und die Hessische Senke nach Norden weiterverfolgen lässt; die annähernd Nord-Süd verlaufenden Störungssysteme sind an der Oberfläche noch am Westrand des Harzes in Gestalt des Leinetalgrabens erkennbar und verlieren sich dann unter den eiszeitlichen Ablagerungen des Norddeutschen Tieflands. Ihre Fortsetzung ist, allerdings meist nur im Untergrund auch dort an ganzen Schwärmen Nord-Süd verlaufender Salzstrukturen zu erkennen, die den Störungen folgen; sie reichen bis in die südliche Nordsee (vgl. Abb. 218).
Im Südwesten begrenzen Oberrheingraben und im Südosten Donaurandbruch und Fränkische Linie ein als Südwestdeutsche Großscholle bezeichnetes Areal, dessen mesozoische Schichtfolgen im Süden unter die Molasseablagerungen des Alpenvorlands abtauchen. So entsteht ein Dreieck, an dessen Rändern es letztlich bis heute immer wieder zu Bewegungen kam. An diesen Störungslinien sind einerseits beträchtliche Vertikalbewegungen nachgewiesen (das nordostbayerische Grundgebirge ist an der Fränkischen Linie um etwa 1000 m gehoben worden), andererseits auch größere Blattverschiebungen, d.h. horizontaler Versatz von Schollen gegeneinander.
Der Nordwest-Verlauf von Donaurandbruch und Fränkischer Linie setzt sich in die westlichen Randstörungen des Thüringer Waldes fort, der an solchen Linien horstartig herausgehoben ist.
Diese vielfach in Deutschland zu beobachtende Nordwest-Richtung der Störungen ist zwar meistens als geologisch jung einzustufen, sie hat aber geometrische Entsprechungen auch im alten Grundgebirge, wie man am entsprechenden Verlauf des Pfahls im Bayerischen Wald erkennen kann. Dessen Quarzfüllung ist zwar jung, die Störung, der er folgt, grenzt aber unterschiedliche Gneise voneinander ab und ist sicherlich schon variskisch angelegt.
Während man die jungen Nordwest streichenden Störungssysteme in einer etwas gewagten plattentektonischen Argumentation als Fortsetzungen von Transformstörungen des sich öffnenden Atlantik in den Festlandsbereich hinein auffassen könnte, ist eine solche Deutung für die ältere Anlage entsprechender Richtungen nicht möglich.
Die Nordwest-Richtung ist auch im Bereich des Elbetals bestimmend. Mit der Annäherung an den gleichsinnig verlaufenden Südwest-Rand der Osteuropäischen Plattform, der sich auch geophysikalisch abzeichnet und nordöstlich davon durch eine wesentlich dickere Erdkruste bestimmt wird, scheint die Nordwest-Richtung hier schon lange vorgegeben. Jüngster Ausdruck davon sind die Bewegungen an der Lausitzer Überschiebung.
Außer zu den erwähnten größeren Störungen, die sich, wie z.B. der Donaurandbruch, gelegentlich auch markant in der Landschaft zeigen, haben die jungen Krustenbewegungen zu eher weitspannigen Deformationen geführt, die man in einigen der durch mesozoische Gesteine geprägten Gebiete vor allem Südwestdeutschlands nachweisen kann. Da sind manchmal lang gestreckte Beulen erkennbar, furchenartige Senkungsbereiche und auch Flexuren oder Brüche, die, wie das sogenannte Schwäbisch-Fränkische Lineament, vom Schwarzwald am Nordrand der Schwäbischen Alb entlang bis über das Ries hinaus auf größere Entfernungen zu verfolgen sind. Eine Südwest-Nordost-Orientierung mancher dieser Strukturen deutet darauf hin, dass sich hier variskische Richtungen aus dem Untergrund in das Deckgebirge hinein durchgepaust haben. Die sogenannte Neckar-Jagst-Furche markiert z.B. den Grenzbereich zwischen Saxothuringikum und Moldanubikum im Untergrund.
Die Vertikalbeträge der Einsenkung sind oft nur mühsam zu ermitteln und erreichen meist nicht mehr als einige Zehnermeter. Dennoch reichen solche weitspannigen Einsenkungen aus, um die Erosion jüngerer Gesteine in den Zentren zu verhindern. So sind z.B. in der an den Kraichgau anschließenden Stromberg-Mulde die höheren Keupersandsteine und in der Löwensteiner Mulde (die morphologisch die Löwensteiner Berge bildet) sogar noch Zeugenberge aus Schwarzjura erhalten geblieben.
Zur Südwest-Nordost-Orientierung kommen auch hier Nordwest streichende Grabenstrukturen und Nordnordost verlaufende Brüche.
Zu den Nordwest-Strukturen gehört der Bonndorfer Graben, der aus dem Schwarzwald heraus zum Bodensee verläuft, der durch seine Erdbeben berüchtigte Hohenzollern-Graben oder der Filder-Graben bei Stuttgart, wo etwa 100 m Absenkung nachweisbar sind. Die Nordnordost verlaufenden Brüche orientieren sich mit dieser Richtung am Oberrheingraben; parallel dazu sind solche Störungen noch weit davon entfernt im Odenwald (Michelstädter Graben) oder im Kraichgau nachweisbar.
Am Steigerwald folgt dieser Richtung eine Gruppe von kleineren Basaltgängen, die als Heldburger Gangschar bekannt ist; das weist hier auf Dehnung der Erdkruste hin. Die dabei entstehenden Spalten haben dann die Basaltschmelzen als Aufstiegswege benutzt.
Über das Alter der Bewegungen, die die Deformationen im Deckgebirge verursacht haben, gibt es kaum konkrete Hinweise. Man liegt aber mit einer Einstufung in das Jungtertiär sicherlich nicht ganz daneben, zumal die treibende Kraft von den Alpen ausgehen muss.
Schnelle Änderungen im Verlauf von Flüssen zeigen darüber hinaus an, dass die Bewegungen noch bis in die heutige Zeit andauern. Sie liefern auch Hinweise darauf, dass die erwähnten tektonischen Strukturen nicht alle gleichzeitig entstanden sind (Simon 2002).
Der Bereich der Südwestdeutschen Großscholle ist auch als Schichtstufenland bekannt. Die mesozoischen Sedimentgesteine fallen insgesamt flach nach Südosten ein, sodass man von einer Schollenkippung ausgehen kann, die den gesamten Gesteinsstapel erfasst hatte. An der Donau tauchen die Schichten dann unter die Ablagerungen der Molasse in Richtung auf die Alpen ab. An ihren nördlichen Rändern griff die Erosion an, die auf unterschiedlich widerstandsfähige Gesteinsbänke traf und durch bevorzugte Abtragung der weicheren Schichten dann die härteren Stufen herauspräpariert hat. Erstaunlich ist, dass gelegentlich selbst nur 50 cm mächtige Sandsteine oder Kalksteine, etwa im Keuper, solche Stufenbildner sein können.
Deutschlands Quartärlandschaft hat sich zwischen dem skandinavischen Inlandeis und der Hochgebirgsvergletscherung des Alpenraums entwickelt, wobei die nordischen Gletscher zeitweise weit bis nach Mitteldeutschland und die Alpengletscher in das als Alpenvorland bezeichnete Gebiet, das zuvor die Molasse bedeckt hatte, vorgestoßen waren. Anzeichen für eine Vergletscherung gibt es auch in einigen unserer Mittelgebirge. Bisher kündeten davon vor allem die im Schwarzwald und im Bayerischen Wald gefundenen Kare, von denen manche noch mit Seen gefüllt sind. Seit einigen Jahren sind aber auch in den weniger hohen Mittelgebirgen Hinweise gefunden worden, die eine weiterreichende mächtige Eisbedeckung wahrscheinlich machen. Die Indizien dafür sind Gletschertöpfe und Abflussrinnen in den Felsen u.a. von Nordvogesen, Nordschwarzwald, Pfälzer Wald, Vogelsberg, Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Oberpfälzer Wald, Teutoburger Wald und im Harz sowie den kleinen Gebirgen in seinem nördlichen Vorland – Gebieten also, die bisher insgesamt zum sogenannten Periglazialen Raum gezählt wurden (Ortlam 1994).
Der überwiegende Flächenanteil ist aber durch die Bildungen zwischen den großen Eisfronten gekennzeichnet: Das ist der Bereich der großen Sanderflächen, der Schmelzwasserrinnen und Urstromtäler, die parallel zum Eisrand verliefen, sowie der Frostmusterböden einer eiszeitlichen Tundra. Der Wechsel von Kalt- und Warmzeiten hat eine Fülle von unterschiedlichen Sedimenten hinterlassen, deren Über- und Nacheinander die Klimaveränderungen abbildet, die sich bei uns in den vergangenen über 2 Mill. Jahren seit Beginn der quartären Eiszeit ereignet haben.
Zu den oben erwähnten Kaltzeitzeugen kommen noch die Findlinge, die mit ihrer Petrographie zugleich Auskunft über ihre unterschiedlichen Herkunftsgebiete geben; dabei sind granitische und porphyrische Gesteine spezifischer als Gneise oder Quarzite anzusehen (Dietrich & Hoffmann 2003).
Warmzeitzeugen sind Torfe und Seesedimente wie Kalkmudden oder Kieselgur und die in Lößprofilen konservierten Böden. Flussterrassen bieten einigen Stoff für Diskussionen, weil ihre Höhenlage durch tektonische Vertikalbewegungen mitbestimmt ist, die durch die Erosion bzw. Aufschotterung modifiziert werden. Heute sagt man, dass die Aufschotterung vor allem während der Kaltzeiten erfolgt ist. Das nachfolgende Einschneiden des Flusses in sein Schotterbett sei indes weniger durch eine Erwärmung mit höherer Wasserführung als durch die Tieferlegung der Erosionsbasis gesteuert, die ihrerseits wieder für eine Kaltphase spricht.
Immer schon ist der Löß als Kaltzeitbildung interpretiert worden, dessen chemische Verwitterung zu Lößlehm in den Warmzeiten aber erst die fruchtbaren Böden hervorgebracht hat, die vor allem die Bördenlandschaft vor dem Nordrand der Mittelgebirge bestimmen. Mächtiger Löß begleitet auch den Oberrheingraben in seinen Randbereichen, geringe Mächtigkeiten und manchmal sogar nur Spuren davon sind aber praktisch überall nachweisbar, inzwischen sind sie sogar auf der Schwäbischen Alb gefunden worden (Eberle et al. 2002).
Damit ist auch gesagt, dass die Landschaft, deren geologischer Bau sich erst aus ihrem Untergrund heraus erläutern lässt, praktisch überall erst einmal von dem befreit werden muss, was ich etwas respektlos als „jungen Dreck“ bezeichne. Dazu gehören praktisch alle Quartärablagerungen und natürlich die Böden.