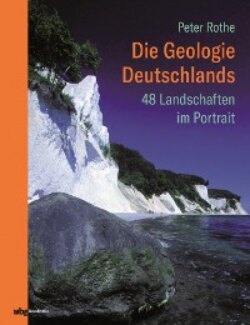Читать книгу Die Geologie Deutschlands - Peter Rothe - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Westerwald
ОглавлениеMit fast 1000 km2 Flächenerstreckung ist der Westerwald nach dem Vogelsberg eines der größten zusammenhängenden tertiären Vulkangebiete Deutschlands (vgl. Abb. 1, 5). Wenn man sich diesem Mittelgebirge von Süden her nähert, ist eine treppenförmig ansteigende Morphologie deutlich, die durch übereinander gestapelte mächtige basaltische Lavaströme zustande kommt. Diese Basalte überlagern noch den südwestlichen Randbereich der Dillmulde (die auch Dill-Eder-Mulde heißt, vgl. Abb. 10) und bedecken darüber hinaus das unterdevonische Grundgebirge, das hier im Wesentlichen aus Quarziten, Siltsteinen und Tonschiefern des Emsiums aufgebaut wird; einzelne Basaltdurchbrüche reichen sogar bis in das Stadtgebiet von Limburg an der Lahn. Wie in vielen anderen Gebieten mit Tertiärvulkanismus in Deutschland lagern auch im Westerwald dessen Produkte nicht direkt auf dem Grundgebirge, das seit seiner Entstehung vor Hunderten von Millionen Jahren weitgehend Festland war und spätestens seit der Kreidezeit einer terrestrischen Verwitterung unterlag. Die entsprechenden Tone, die dabei überwiegend aus den devonischen Tonschiefern entstanden sind, bilden z.T. Zehnermeter mächtige Verwitterungsdecken, die noch über ihren Ausgangsgesteinen lagern, oder Ansammlungen solchen Materials, das in flache Senken umgelagert wurde. In solchen See- und Sumpflandschaften sind durch eine entsprechende Vegetation auch die Voraussetzungen für die Bildung von Braunkohlen geschaffen worden. Die Tone sind teilweise vielleicht schon im jüngeren Mesozoikum, hauptsächlich aber wohl weitgehend während des Alttertiärs entstanden, als hier noch ein feuchtheißes Tropenklima vorherrschte, das die chemische Verwitterung begünstigte. In dieser Zeit sind auch sogenannte Tertiärquarzite gebildet worden, weil gelöstes SiO2 die Sandsteine verkittet hatte.
Unter den entstandenen Tonmineralen überwiegt Kaolinit, der vielen der Westerwälder Tone ihre weiße Farbe verleiht (Abb. 23). Eines der Hauptgewinnungsgebiete ist das Kannenbäckerland um Höhr–Grenzhausen, das seinen Namen den aus dem lokalen Rohstoff verfertigten Gefäßen verdankt. Einen besonders interessanten Aufschluss bietet die Westerwälder Tongrube „Petschmorgen“ der Firma Sibelco bei Moschheim, weil dort Tone unterschiedlicher Ausprägung von einem Basalt überflossen wurden, der das Liegende rot „gefrittet“ hatte (Abb. 24). Oberhalb dieser Tongrube führt ein „Tonwanderweg“ mit Erläuterungstafeln vorbei (Themenweg Ton: Boden-Niederahr-Moschheim-Boden).
Abb. 23: Tongrube am Ortsrand von Breitscheid (Westerwald). Die überwiegend kaolinitischen, weißen Tone entstanden während des Tertiärs unter tropischem Klima durch Verwitterung paläozoischer Schiefer (Thielmann 1999: Chronik der Westerwälder Thonindustrie).
Die Datierung der Westerwälder Tone ist problematisch, weil ortsfeste Verwitterungsdecken praktisch keine Fossilien enthalten. Das wurde erst an den umgelagerten Tonen möglich, weil darin auch Pollen mit abgelagert wurden, und erst recht, als sich die Braunkohlenvegetation zu entwickeln begann, die ihren Höhepunkt im Miozän hatte.
Einen Glücksfall in dieser Hinsicht stellt die Lokalität von Enspel im nordwestlichen Westerwald dar, wo man schon vor über 100 Jahren auf Fossilien in Sedimenten gestoßen war, die von Basalt überlagert waren. Mit dem fortschreitenden Abbau des Basalts wurde eine flächenhafte Verbreitung der Sedimente deutlich, die seit 1990 von Mitarbeitern des Landesamtes für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz systematisch ergraben wurden. 1996 kam eine Forschungsbohrung hinzu, die etwa 140 m mächtige Seesedimente angetroffen hat; im tieferen Teil folgen noch 90 m vulkaniklastische Ablagerungen und darunter etwa 25 m zerbrochene Devongesteine (Felder et al. 1998).
Hier ist also eine vulkanisch entstandene Hohlform (Maar) durch einen tertiären See ausgefüllt worden; die aus seinen Ablagerungen inzwischen geborgenen Fossilien geben dem Fundort den Rang einer Fossillagerstätte, die zeitlich in das Oberoligozän eingestuft ist. Im Hangenden folgen noch 100 m Basalt, der die Erosion der Seesedimente verhindert hatte.
Zu den Fossilien gehören neben Pflanzen auch Insekten und Wirbeltiere, u.a. Krokodile. Besondere Bedeutung kommt einem als „Stöffel-Maus“ (der Stöffel ist der Berg an der Grabungsstelle) bezeichnetes Nagetier zu, das mit Häuten an den Extremitäten kurze Gleitflüge ausführen konnte (Storch et al. 1996).
Die meist sehr gute Erhaltung der Fossilien ist auf die oft bitumenreichen, fein laminierten Seesedimente zurückzuführen, was das Vorkommen vergleichbar mit Messel oder dem Eckfelder Maar in der Eifel, bzw. Sieblos in der Rhön macht. Den Seesedimenten von Enspel sind aber immer wieder vulkanische Komponenten eingelagert, die auf weiter anhaltende Ausbrüche während der Seephase hinweisen.
Abb. 24: Tongrube „Petschmorgen“ der Firma Sibelco bei Moschheim. Der weiße Ton ist hier von einem Basaltlavastrom überflossen worden, der den Ton am Kontakt „gefrittet“ hat (Foto: Dipl.-Ing. Norbert Schiedt, Exkursion 2018).
Altersbestimmungen an Westerwälder Vulkaniten zeigen zwei Maxima der Ausbrüche: Die älteren erfolgten vom Oberoligozän bis ins untere Miozän (24 bis 19 Mill. Jahre) und hatten ihr Zentrum nördlich von Montabaur, die jüngeren im oberen Miozän bis Pliozän (8 bis 5 Mill. Jahre) mit einem Schwerpunkt um Rennerod.
Die Förderprodukte sind überwiegend Basalte (Laven und Tuffe), es gibt aber auch im Westerwald, vor allem unter den frühen Vulkaniten, Trachyte und intermediäre Gesteine. Solche Vorkommen im Südwesten zeigen eine gewisse Ähnlichkeit zum dort anschließenden Siebengebirge. Die im östlichen und im Hohen Westerwald vorherrschenden Nephelingesteine, vor allem Olivinnephelinite, zeigen an, dass die meisten der Magmen direkt dem Erdmantel entstammen.