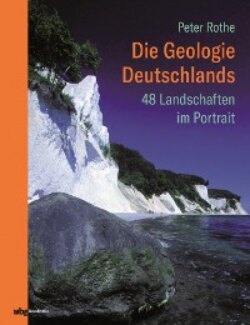Читать книгу Die Geologie Deutschlands - Peter Rothe - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lahn- und Dillgebiet
ОглавлениеWer mit aufmerksamem Blick für natürliche Bausteine durch Weilburg, Limburg oder Dillenburg geht, wird an Häusern, Kirchen und im Straßenpflaster eine ungewöhnliche Vielfalt an Gesteinen entdecken. Es sind alles Rohstoffe aus der näheren Umgebung und sie sind fast alle entstanden, als diese Gegend eine Art von äquatornah gelegener devonischer Südsee gewesen ist, mit Vulkanen, Riffen und zwischen solchen Schwellen liegenden Becken, in die Tone, Sande und Kalke geschüttet wurden.
Auf kleinstem Raum lässt sich das im Stadtgebiet von Weilburg studieren, wo mittel- und oberdevonische Gesteine bis hin zu unterkarbonischen verbaut worden sind und die sowohl Sedimente als auch Vulkanite umfassen.
Die Lahn bildet eine Mäanderschlinge um die Stadt, die engste Stelle ist durchtunnelt, um Eisenbahn und Schiffen den weiteren Weg zu ersparen; seit Kurzem gibt es auch einen Straßentunnel. Steilhänge und Tunnels bieten reichlich Aufschlüsse: Schalstein, Diabas, Keratophyr, Rotschiefer, Massenkalk, Plattenkalk, Kramenzelkalk, ja sogar Roteisenstein kommen in Tagesaufschlüssen im weiteren Stadtgebiet vor und vielfach gibt schon das Mauerwerk Zeugnis von der lokalen Geologie. Im Vergleich mit den unterdevonischen Taunusgesteinen lassen sich hier wesentlich engräumiger gefaltete Strukturen beobachten; vor allem in den Schiefern sind kleinräumige Spezialfalten („Knickfalten“) ausgebildet, die oft nur im Meter- bis Zentimeterbereich liegen (Abb. 11).
Im Großbereich des Rheinischen Schiefergebirges bildet das Lahn-Dill-Gebiet zwei bzw. drei relativ schmale Zonen mit einer eigenständigen geologischen Entwicklung (vgl. Abb. 10). Geographisch liegt es zwischen Taunus und Westerwald. Tektonisch bilden die als Lahn- und Dillmulde (auch Dill-Eder-Mulde) bezeichneten Gebiete zwei durch die geologisch eigenständige Hörre-Zone voneinander getrennte Großmulden, die ihrerseits in zahlreiche kleinere Teilmulden und die dazu gehörigen Sättel gegliedert werden. Die tektonische Teilgliederung ist auch durch das unterschiedliche Verhalten der Gesteine während der variskischen Gebirgsbildung zu erklären: Massige Gesteinskomplexe reagieren meist spröde und mit Brüchen, während Tone und Sande eher zu Faltung neigen; beides ist dort gelegentlich auf engem Raum nebeneinander zu beobachten.
Großtektonisch gehört das Gebiet zum heute Avalonia genannten Terran, das letztlich einen vom südlichen Gondwanaland herangedrifteten Krustenstreifen darstellte, der wie die anderen Bereiche des Rhenohercynikums dann zum Schelfgebiet wurde (vgl. Taunus). So bilden zwar Gesteine des Unterdevons auch im Lahn-Dill-Gebiet die Basis, die Landschaft wird aber wesentlich durch mittel- bis oberdevonische und unterkarbonische Gesteine geprägt.
Abb. 11: Rotschiefer des Oberdevons mit kleinräumigen Knickfalten. Guntersau, Mündung der Weil in die Lahn.
Im Zuge einer Vertiefung des Meeres während des Mitteldevons wurde der Schelf ausgedünnt und infolge dieser Dehnung kam es zu vulkanischen Eruptionen, die sowohl kieselsäurereiche als auch basaltische Schmelzen förderten.
Dieser Vulkanismus und die ihn begleitenden Brüche hatten das untermeerische Relief beträchtlich modifiziert: Auf hoch liegenden Schollenrändern entstanden aus Trachyten und Rhyolithen aufgebaute Vulkane, die örtlich sogar über den Meeresspiegel aufragten und dort von Pflanzen besiedelt werden konnten. Die Hauptmasse aber waren Basalte, die vom oberen Mitteldevon an bis ins Oberdevon hinein große untermeerische Vulkankomplexe aufgebaut hatten. Ihre mächtigen Pillow-Laven, die man in vielen Steinbrüchen und an Straßenböschungen beobachten kann, sind geradezu ein Kennzeichen dieser Gegend. Daneben bilden Schichtlaven grobbankige, viele Meter mächtige Gesteinsbänke. Im Zentrum der aus vielen Einzelvulkanen zusammengewachsenen Schwellen kam es auch zu Intrusionen von Lagergängen, lokal lassen sich sogar hoch liegende Magmakammern studieren, die in den älteren Sedimenten stecken geblieben und in sich geschichtet sind. Zumindest im Spätstadium sind die Eruptionen in relativ flachem Wasser erfolgt, was man aus den infolge vieler Gasblasen porösen Gesteinen ableiten kann. Durch Differenziation der Magmen sind auch hier noch einmal vergleichsweise geringe Mengen trachytischer und rhyolithischer Gesteine entstanden.
Die ehemaligen Blasenhohlräume in den als Diabas bezeichneten Basalten sind später mit hellen Mineralen (meist Calcit) ausgefüllt worden; dadurch sehen sie aus wie Mandeln im Kuchen, was zu der Bezeichnung Diabasmandelstein (Abb. 12) geführt hat. Mandeln deshalb, weil die vormals runden Blasen durch die Auflast abgeplattet wurden. Die Diabase sind überwiegend grünlich gefärbt, was auf Chlorit und/oder Epidot zurückzuführen ist. Man diskutiert noch immer, ob das durch Metamorphose oder aber durch eine Meerwasser-Alteration im Anschluss an die Förderung passiert ist.
Abb. 12: Diabasmandelstein. Die millimetergroßen Blasenhohlräume sind mit Calcit gefüllt.
Im Zusammenhang mit den Diabasen kommen Gesteine vor, die von den alten Bergleuten wegen ihres Bruchverhaltens als „Schalstein“ bezeichnet wurden: in Platten spaltbare, geschieferte Gesteine, deren Bestandteile überwiegend basaltische Lapilli, Bruchstücke von Basalten und beigemischte Sedimentgesteinskomponenten (oft Riffkalkbruchstücke) sind (Abb. 13). Der Begriff Schalstein wurde früher mit Diabastuff gleichgesetzt, was sich heute nicht mehr halten lässt. Die Komponenten dieser vulkaniklastischen Gesteine können nämlich auf sehr unterschiedliche Weise transportiert worden sein, wobei neben der explosiven Tätigkeit, die echte Lapilli- und Aschentuffe liefert, auch untermeerische Schuttströme („debris flows“) wirksam gewesen sind, die von den Vulkanhängen ausgingen und dort aufgehäuftes Material, u.a. Pillow-Brekzien, in die Becken verfrachtet hatten.
Schalstein bildet meist Sattelstrukturen, weil das Gestein im Gegensatz zu den in den Trögen zwischen den Vulkankomplexen abgelagerten Tonen starrer auf die Faltung reagiert. Das gilt auch für die als Keratophyr bezeichneten sauren Vulkanite (Abb. 14).
Diese vulkanischen Komplexe haben Flachwasserverhältnisse geschaffen, die dann riffbildende Organismen als Siedlungsraum nutzen konnten. Das waren vor allem die kalkigen Stromatoporen, aber auch Algen, Korallen, Echinodermen und Brachiopoden. So entstanden vor allem in der Lahnmulde bis über 300 m mächtige Riffkalke, die als „Lahnmarmor“ nicht nur lokal Bedeutung als Bausteine hatten. Diese Gesteine sind allerdings kein Marmor im petrographischen Sinne, sondern schleif- und polierfähige Kalksteine. Vor allem in der bunten Version „Unica“ (Abb. 15) sind solche Kalke in einem meterlangen Profilschnitt am rechten Ufer der Lahn gegenüber von Villmar als Geotop aufgeschlossen und weltweit an prominenten Gebäuden verbaut worden. Dazu zählt u.a. das Empire State Building, die Eremitage in St. Petersburg und der Moskauer Kreml, und in Deutschland sind sie u.a. im Dom von Trier, in der Mannheimer Jesuitenkirche, in Amorbach und in der Frankfurter Paulskirche zu finden (man sieht das, wenn dort Reden, auch anlässlich von Buchpreisverleihungen, gehalten werden). Auch der Nepomuk auf der alten Lahnbrücke in Limburg besteht aus Lahnmarmor, hier allerdings in der grauen Varietät von Wirbelau (Abb. 16 a, b), in der man sehr schön die Stromatoporen sehen kann, die die wesentlichen Riffbildner sind. Am rechten Ufer der Lahn, gegenüber von Villmar, gibt es seit 2016 ein neues Lahnmarmor-Museum. Die Steinbrüche um Limburg, Diez und bei Villmar zeugen heute noch von einer einst sehr umfangreichen Abbautätigkeit, und der Limburger Dom und die Lubentiuskirche in Dietkirchen stehen auf solchen Riffkarbonaten (Abb. 17). Bei Steeden und Dehrn gibt es darin Höhlen, die in prähistorischer Zeit besiedelt waren. Auch die Kubacher Kristallhöhle bei Weilburg ist in solchen Riffkalken entstanden.
Abb. 13: Schalstein im unteren Weiltal bei Essershausen.
Abb. 14: Keratophyr an der Guntersau bei Weilburg. In der Umgebung von viel Diabas und Schalstein mal ein helleres Gestein, das von Quarz und Feldspat dominiert ist.
Abb. 15: Lahnmarmor, hier in der Varietät „Unica“. Bunte, durch Hämatit rot gefärbte devonische Riffkalke aus Stromatoporen, Korallen, Echinodermen und anderen Organismen, lagenweise auch Riffschutt. Alte Steinbrüche bei Villmar/Lahn. Die Varietät „Unica“ wurde u.a. in der Würzburger Residenz und im Käppele, im Schloss Bruchsal und im Berliner Dom verbaut. Naturdenkmal.
Der prominenteste Aufschluss in solchen Karbonaten ist der Großsteinbruch der Firma Schäfer Kalk in Hahnstätten (Abb. 18); er gehört geografisch zwar zum Taunus, steht aber in der nach SW streichenden Fortsetzung der Lahnmulde. Die Abbauprodukte sind im Wesentlichen hochreine calcitische Riffkalke des Mittel- und Oberdevons, wobei in Spalten auch der karbonzeitliche Erdbacher Kalk anzutreffen ist. Eine Besonderheit sind hier in Karsthöhlen eingeschwemmte alttertiäre Sedimente, die nach Pollen und Sporen Paläozän-Alter haben und damit die ältesten Tertiärsedimente im Rheinischen Schiefergebirge bilden (Anderle 2019); entsprechende Reste werden aber in den nächsten Jahren dem Abbau zum Opfer fallen. Am Top der in der Gegend insgesamt von Löß bedeckten Schichtfolge ist sehr gut ausgebildeter Kegelkarst entwickelt.
Abb. 16: a) Nepomuk-Statue aus Stromatoporenkalk auf der alten Lahnbrücke in Limburg; b) Detail des Stromatoporenkalks, der die porigen Strukturen der Organismen zeigt.
Abb. 17: Die romanische Lubentiuskirche von Dietkirchen an der Lahn steht auf einem Riffkalkklotz aus Lahnmarmor.
Abb. 18: Kalksteinbruch in Mitteldevonischem Massenkalk der Firma Schäfer Kalk in Hahnstätten (Werksfoto freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dipl.-Geol. Steffen Loos).
Von den Riffen aus wurde gelegentlich kalkiges Material in die benachbarten Meeresbecken geschüttet, das dann die Kalkbänke zwischen den tonigen Sedimenten bildet. Auf tiefer gelegenen Schwellen sind Kalk und Ton auch zusammen abgelagert worden. Die Kalke bilden hier aber meist keine durchgängigen Schichten, sondern sind sekundär in diesem tieferen Wasser teilweise wieder aufgelöst worden. So entstanden allmählich isolierte Kalkknollen in einer tonigen Matrix; man spricht da von Kalkknotenschiefern, meist aber von „Kramenzelkalken“, weil die Gesteine Ähnlichkeit mit Ameisenbauten (Kramenzeln) haben. Da die Tone oft rot gefärbt sind, ergeben sich sehr reizvolle Gesteine, die man u.a. im Stadtgebiet von Weilburg (z.B. am Schiffstunnel) findet (Abb. 19).
Vulkanismus und Riffkalkbildung beherrschten das Gebiet vom oberen Mitteldevon bis in das tiefe Oberdevon; danach starben die meisten Rifforganismen, wahrscheinlich infolge einer weltweiten Krise (Abkühlung? Kellwasserereignis, Abb. 3) aus.
Im Gegensatz zur Lahnmulde mit ihren vielen Riffen ist für die Dillmulde nur das große Riff zwischen Langenaubach und Breitscheid zu nennen, das sich auch unter die Basaltdecke des Westerwalds fortsetzt.
An der Wende vom Mittel- zum Oberdevon und während des tieferen Oberdevons kam es zur Bildung von Roteisenstein, der in dieser geologischen Position den über die Region hinaus verwendeten Begriff Lahn-Dill-Typus geprägt hat (Abb. 20).
Roteisenstein wurde noch bis in das Jahr 1983 untertägig abgebaut, die Gruben sind aber bis auf das sehenswerte Besucherbergwerk Grube „Fortuna“ bei Oberbiel und einen Stollen bei Oberscheld (Grube „Ypsilanta“) inzwischen alle geschlossen. Das Eisen wurde schon in prähistorischer Zeit gewonnen, wo die Erzlager über Tage ausbissen. Das Eisen war lange Zeit hindurch ein Wirtschaftsfaktor in der Gegend, der Anlass gab, noch um 1960 über einen Ausbau der Lahn für den Erztransport nachzudenken.
Abb. 19: Kalkknotenschiefer („Kramenzelkalk“) des Oberdevons am Schiffstunnel in Weilburg/Lahn.
Abb. 20: Roteisenstein vom Lahn-Dill-Typus. Grube Lindenberg zwischen Münster und Wolfenhausen, Lahnmulde. Zollstock als Maßstab (Foto von 1961).
Abb. 21: Halden des Dachschieferbergbaus am Ortsrand von Langhecke (Foto von 2011). Detailbild vom streifigen grauen Schiefer.
Die Entstehung der Erze wurde früher wesentlich im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vulkanismus diskutiert, weil die Lager oft im Grenzbereich zwischen Diabas und hangenden oberdevonischen Sedimenten anzutreffen sind (daher der Begriff „Roteisenstein-Grenzlager“).
Inzwischen hat man herausgefunden, dass die Vulkane wohl nur die Wärmequelle waren, die das Meerwasser erhitzt hatten. Das in den Gesteinen eingeschlossene heiße Wasser hatte aus dem Nebengestein Metalle mobilisiert, mit dem aufsteigenden Porenwasser abtransportiert und in Form der Erzlager wieder abgesetzt. Für diese diagenetischen Vorgänge, die im Anschluss an die Eruptionstätigkeit begannen, war der hochporöse und auch aus reaktionsfreudigem vulkanischem Glas bestehende Schalstein besonders geeignet. Dessen Kompaktion nach der Ablagerung hatte das metallgesättigte Porenwasser in Form von Schloten nach oben transportiert, was auch die außer dem Grenzlager existierenden „Schalsteinlager“ erklärt (Flick et al. 1990, Nesbor et al. 1993). Übertageausbisse von Roteisenstein kann man heute u.a. noch gegenüber dem Bahnhof von Dillenburg und in der Nähe der Weilmündung in die Lahn an der Straße nach Kirschhofen finden. Das Oberdevon ist durch eine besondere Gesteinsvielfalt gekennzeichnet: Schwarz- und Rotschiefer, Plattenkalke, Kramenzelkalke, Sandsteine, Alaun- und Kieselschiefer sowie Vulkanite wechseln sich auf kleinem Raum ab, was auf die Entwicklung des untermeerischen Reliefs zurückgeführt werden kann, das weiterhin durch die Vulkanbauten bestimmt wurde. Die Gesteinsfarben zeigen auch die Sauerstoffverhältnisse im Wasser an: Stark reduzierende Bedingungen führten zu Alaunschiefern, oxidierende zu Rotschiefern. Mittel- bis oberdevonische Dachschiefer in der südlichen Lahnmulde wurden bei Langhecke und Weinbach früher in größerem Umfang abgebaut. Sie sind durch feinstkörnige, meist submillimeterdicke, Lagen von Quarz gebändert und heller als die Dachschiefer von der Mosel, vom Mittelrhein oder vom Sauerland und lassen sich auch nicht ganz so dünn spalten; das erfordert zwar stärkere Dachkonstruktionen, die Kosten dafür wurden aber durch längere Haltbarkeit ausgeglichen. Heute sieht man sie fast nur noch an historischen Gebäuden (Abb. 21).
Schwarze Kalksteine im tiefen Oberdevon bilden das Kellwasserereignis auch hier ab, bei dem die Riffe in weltweitem Maßstab abgestorben waren (vgl. Harz).
Ein Gestein, dem immer besondere Aufmerksamkeit galt, sind die früher „Dillenburger Tuffe“, heute „Dillenburg-Formation“ genannten bunt gemischten Gesteine, die jetzt als Abtragungsschutt von Vulkaninseln gedeutet werden.
Im Unterkarbon wurde das kleinräumige Relief durch pelagische Sedimente dann weitgehend ausgeglichen. Die unterkarbonischen Sedimente bilden als Hangenbergschiefer, Liegende Alaunschiefer, Kulmkieselschiefer und Kulmtonschiefer und spätere Grauwacken das weitgehend klastische Ablagerungsgeschehen ab, die Grauwacken kennzeichnen schon die Flyschphase. Im Stadtgebiet von Herborn kann man am „Heiligen Berg“ u.a. schöne Muscheln in den Kulmtonschiefern finden (Posidonia becheri, ein Leitfossil für das Unterkarbon).
Lokal wurden auch noch Karbonate gebildet. Im devonischen Riffkomplex von Erdbach-Breitscheid sind in der Dillmulde, mit Schichtlücke über dem im Oberdevon abgestorbenen Riff, noch Kalke des Unterkarbons nachgewiesen worden, die als Erdbach-Kalk sogar eine stratigraphische Stufe, das Erdbachium, mitbegründet haben.
Der Erdbach-Breitscheider Riffkomplex ist stark verkarstet; die Höhlen darin waren prähistorisch besiedelt, die Forschung darin ist auch heute noch im Gange.
Weitaus bedeutender für die Landschaft sind aber unterkarbonische Basalte, die als Deckdiabas bezeichnet werden und eine dem devonischen Vulkanismus ähnliche submarine Landschaft vor allem aus Pillow-Vulkanen aufgebaut hatten. Im Gegensatz zum Devon herrschten im Unterkarbon aber wegen der größeren Wassertiefen Laven vor; diese Magmen sind relativ schnell aus dem Erdmantel hochtransportiert worden, was man vor allem aus den darin enthaltenen häufigen und großen Olivinknollen ableiten kann.
In der östlichen Lahnmulde gibt es neben der „normalen“ paläozoischen Abfolge Gesteinskomplexe, denen die Begriffe „Gießener Grauwacke“ und „Paläozoikum der Lindener Mark“ zugeordnet werden. Sie waren schon früher Geologen aufgefallen, weil sie nicht recht zu der normalen Entwicklung in ihrer Umgebung passten. Besonders deutlich wird das in der Lindener Mark am westlichen Stadtrand von Gießen, wo Quarzite (Andreasteich-Quarzit) ordovizische Fossilien und Kalke Ostrakoden und Orthoceren des Silurs enthalten, auf die unterdevonische Tonschiefer und kalkige Sandsteine folgen bzw. als Schlammstrom-Komponenten in diese eingelagert sind. Ein entsprechend aufgebautes Profil gibt es, von kleinräumigen Ausnahmen (Hörre, Kellerwald und Südharz, s. dort) abgesehen, nirgendwo sonst im Rheinischen Schiefergebirge.
Lindener Mark und die jetzt als Gießen-Decke (vgl. Abb. 5, 6) bezeichnete Einheit der Gießener Grauwacke werden heute als allochthon angesehen. Der Name sagt es schon: Die Einheiten bilden die Reste einer tektonischen Decke, wobei die Gesteine der Lindener Mark möglicherweise basale, darin eingeschuppte Anteile der Gießen-Decke darstellen. Deren Gesteine sind schwarze Tonschiefer und Kieselschiefer von außerordentlich geringer Mächtigkeit: In den nur 50 m dicken Schichten steckt die gesamte Zeitspanne vom Emsium bis zum Oberdevon. Solche geringen Sedimentationsraten sind sonst im Rhenohercynikum nicht zu beobachten, sie passen nur zu hochpelagischen Bedingungen. Darin eingeschaltete Diabase, die auch am Südrand der Decke vorkommen (wo sie infolge der Tektonik stark mechanisch zerschert sind – gut sichtbar am alten Bahnhof von Kraftsolms, Abb. 22), haben geochemisch MORB-Zusammensetzung, müssen also in einem echten ozeanischen Plattenbereich gebildet worden sein. Das unterscheidet sie von fast allen anderen Diabasen im Rheinischen Schiefergebirge.
Ein kleiner Teil seiner Gesteine, d.h. die Tiefwassersedimente und ozeanischen Basalte der Gießen-Decke sind auf den kontinentalen Schelfbereich im Nordwesten obduziert worden. Beim Deckentransport über den Taunus hinweg sind möglicherweise auch Fetzen der Phyllitzone mitgenommen worden, die in der Lahnmulde heute als Solmstaler Phyllite Teile der Gießen-Decke bilden. Sie sind tektonisch stärker beansprucht und höher metamorph als die Gesteine ihrer Unterlage.
Abb. 22: Diabas („vergrünter“ Basalt) des Mitteldevons, durch Tektonik stark zerschert und anschließend zu einer Brekzie verkittet. Basisbereich der Gießen-Decke, die hier nach Nordwesten auf Phyllite des Oberdevons (im Vordergrund) überschoben ist. Der Basalt der Gießen-Decke hat als fast einziges Vorkommen im gesamten Rheinischen Schiefergebirge die chemische Zusammensetzung von Ozeanbodenbasalten (MORB, Mid Ocean Ridge Basalt). Zusammen mit anderen Gesteinen ist er aus einem südlich des Taunus gelegenen, heute nicht mehr nachweisbaren Ozean als Decke hierher verfrachtet worden. Profil am alten Bahnhof Kraftsolms.
Tektonische Beanspruchung mit einer Schubtendenz nach Nordwesten ist in der südlichen Lahnmulde vielfach zu beobachten, es gibt kleinräumige Aufschiebungen von älteren auf jüngere Einheiten und entsprechende Überschiebungen mit Schubweiten von mindestens 5 km. Diese Tektonik macht auch verständlich, warum in der Lahnmulde eine grobe Altersabfolge zu beobachten ist: Auf das Unterkarbon im Nordwesten folgen Mittel- und Oberdevon im Zentrum und im Südosten unteres Mitteldevon und schließlich das Unterdevon des Taunus.
Man muss den Gesamtraum von Lahn-, Dillmulde und Hörre zusammen sehen (vgl. Abb. 5, 6). In dem nur 2 bis 8 km breiten Streifen der Hörre, der sich vom Westerwald bis nordwestlich von Marburg erstreckt, sind im Gegensatz zu Lahn- und Dillmulde keine oberdevonischen und unterkarbonischen Vulkanite entwickelt, außerdem unterscheiden sich auch die Sedimente (Grauwacken schon im Oberdevon und klastische Kalke), sodass man von einem Trog mit eigenständiger Entwicklung ausgehen muss. Dessen oberdevonische bis unterkarbonische Gesteine sind wesentlich klastische Bildungen (Grauwacken, Sandsteine, Siltsteine), aber auch Kalke und kieselige Gesteine. Charakteristisch ist ein intensiver Schuppenbau mit nach Südosten einfallenden Überschiebungen. Die Hörre hat nach neueren Untersuchungen heute den Status einer tektonischen Decke; die Gesteine dort sind im Unterschied zu ihrem Liegenden und Hangenden frei von Vulkaniten (Abb. 10). Die Hörre lässt sich anhand ähnlich ausgebildeter Gesteinsfolgen als eigenständiger Gebirgszug bis in den Harz (dort Acker-Bruchberg-Zug) und darüber hinaus bis Gommern bei Magdeburg verfolgen. Das erweitert den Katalog solcher ortsfremden Gesteinskomplexe, zu denen vor allem die Gießen-Decke gehört, inzwischen aber noch mehrere andere, die man mit Hilfe der in der Einleitung erwähnten Provenienz-Analyse entdeckt hat. Sie bestehen aus Ordovizischen und Devonischen Sedimentgesteinen, die während der Kollision von Laurussia mit Gondwana nach NW auf das südliche Rhenohercynikum aufgeschoben wurden (Mende et al. 2018). Zu diesen Rhenohercynischen kommen nun noch weitere Decken, deren Merkmale auf ein westafrikanisches Hinterland verweisen; sie werden als Armorikanische Ferndecken bezeichnet (vgl. Abb. 10 und Nesbor 2019).
Im Lahntal gibt es eine Reihe von Mineralquellen (Selters, Biskirchen usw.), die sich von denen am Südrand des Taunus in ihrer chemischen Zusammensetzung insofern unterscheiden, als sie wesentlich Kohlensäuerlinge sind; man führt das auf den tertiären Vulkanismus im nahen Westerwald zurück. Diese Mineralwässer scheinen wesentlich an junge, Nord-Süd streichende Verwerfungen gebunden, die sich mit Ost-West streichenden Störungen kreuzen.
Bender et al. 1997, Königshof et al. 2010, Krebs 1966, Mende et al. 2018, Nesbor 2004, 2007, 2019, Nesbor & Flick 1988, Nesbor et al. 1993, Rietschel 1966, Thews 1996