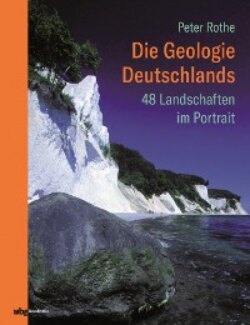Читать книгу Die Geologie Deutschlands - Peter Rothe - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Taunus
ОглавлениеVon der Mainebene im Süden aus betrachtet, schwingt sich der Taunus, noch im 19. Jahrhundert allgemein nur „Die Höhe“ genannt, in Form großer Treppenstufen allmählich auf seine höchsten Erhebungen um 800 m hinauf, die eine von Bad Nauheim bis ins Mittelrheintal bei Assmannshausen reichende, Nordost-Südwest verlaufende Kammlinie zusammensetzen. Diese Richtung ist geologisch begründet, denn die Gesteinskomplexe folgen allesamt mehr oder weniger dem variskischen Streichen. Treppenstufen sind auch im Osten zu beobachten, wo das Gebirge an Nord-Süd verlaufenden Störungen staffelbruchartig zur Ebene der Wetterau hin absinkt. Die geographische Begrenzung im Westen bildet definitionsgemäß das Rheintal, obwohl sich die variskischen Strukturen in den Hunsrück hinein fortsetzen – der geologisch junge Rhein hat da keinen Einfluss. Der Taunus-Südrand ist durch eine steile Störungszone geprägt, die die Begrenzung zum anschließenden Saar-Nahe-Trog mit seinen mächtigen permokarbonen Sedimenten markiert. So bildet das Mittelgebirge den südlichsten Teilbereich des Rechtsrheinischen Schiefergebirges. Die Nordgrenze, wiederum geographisch definiert, bildet die Lahn.
Die erwähnten Treppenstufen kann man am Kapellenberg in Hofheim erlaufen, wo das am Gipfel anstehende Oligozän trepppab über Miozän und Pliozän in die Flussterrassen des Mains übergeht. Das hat vor allem mit der jungen Hebung im Tertiär zu tun, die dem geologisch alten, wesentlich aus unterdevonischen Gesteinen aufgebauten Gebirge erst seine heutige Kontur gegeben hat. Die Hebung hält bis heute noch an. Längs- und Quertäler darin sind tektonisch vorgeformt, ebenso auch die tertiären Senken, die innerhalb des Gebirges eine gewisse Sonderstellung einnehmen: Idsteiner Senke, Limburger und Usinger Becken. Alle drei sind tektonische Senkungszonen, die dem allgemeinen Hebungstrend des Gebirges entgegenlaufen und ein eigenständiges Lokalgeschehen dokumentieren.
Der Taunus besteht zum überwiegenden Teil aus klastischen Gesteinen des Unterdevons, meist sind es Sand- und Siltsteine, Quarzite und Tonschiefer (Taunus-Antiklinorium, Abb. 5, 6).
Im südlichen Randbereich sind ihnen streifenartig schmale Zonen metamorpher Gesteine vorgelagert, deren Ausgangsprodukte zumeist Tonschiefer, aber auch Vulkanite waren, die später in Phyllite, Grünschiefer bzw. sogenannte Serizitgneise umgewandelt wurden (vgl. Abb. 4). Sie werden heute der Nördlichen Phyllitzone des Rhenohercynikums zugerechnet (vgl. Abb. 2) und als Vordertaunus-Einheit bezeichnet (Anderle 1998). Man findet sie im gesamten Vordertaunus, von Bad Homburg bis ins Rheintal, z.B. bei Eppstein, Kronberg, Mammolshain und unter den Burgruinen von Königstein und Falkenstein. Diese Gesteine haben durch Chlorit und Epidot vielfach grüne Farben.
Abb. 4: Serizitgneis und verwandte Gesteine der Vordertaunus-Einheit vom Taunus-Südrand.
Abb. 5: Geologische Übersichtskarte des Rheinischen Schiefergebirges (n. Walter 1992, veränd.). Das im Wesentlichen aus Gesteinen des Unterdevons aufgebaute Gebirge ist tektonisch in zahlreiche Sättel und Mulden gegliedert, die den für die Rhenohercynische Zone des Variskischen Gebirges kennzeichnenden Südwest-Nordost-Verlauf zeigen. Dieser Richtung folgen auch einzelne prominente Überschiebungen älterer auf jüngere Gesteinskomplexe. Die meist senkrecht dazu verlaufenden Querstörungen (einfache Striche) sind hier nur in wenigen Fällen dargestellt. Eine Ausnahme bildet die in der Nähe des Ostrandes eingezeichnete Gießen-Decke, deren Gesteine aus einem südlichen Bereich über den Taunus hinweg nach Norden verfrachtet worden sind.
Nur am Südrand von Hunsrück und Taunus, der an die mächtige permokarbonische Füllung der Saar-Nahe-Senke grenzt, sind schmale Zonen metamorpher Gesteine entwickelt. Am Ostrand greift Zechstein der Hessischen Senke in Form der Korbacher und Frankenberger Bucht auf das Gebirge über. Im Norden geht das Schiefergebirge in das Karbon der Subvariszischen Saumsenke über, das seinerseits von Kreideschichten des Münsterlandes überdeckt ist. Im Nordwesten greift das Tertiär der Niederrheinischen Bucht tief in das Gebirge ein.
Abb. 6: Querprofil durch das Rheinische Schiefergebirge vom Taunus-Südrand bis zur Subvariszischen Saumsenke (n. Walter 1992, veränd.). Das aus geophysikalischen Untersuchungen ermittelte und an Tagesaufschlüssen festgemachte Profil zeigt, dass im Untergrund des hauptsächlich aus devonischen Gesteinen aufgebauten Gebirges älteres Paläozoikum, noch tiefer wahrscheinlich sogar Präkambrium die Sockelgesteine bilden. Ältere als devonische Gesteine sind nur im Ebbe-Sattel und im Remscheid-Altenaer Sattel bis an die Oberfläche gelangt (vgl. auch Abb. 5).
Im Profil zeigt sich auch der tektonische Baustil, der von nach Südosten einfallenden Schaufelflächen geprägt ist; auch die steileren Aufschiebungen folgen diesem Plan. Im südlichen Taunus-Randbereich herrschen steil einfallende tiefe Brüche, im nördlich anschließenden Ruhrkarbon lässt die tektonische Beanspruchung dagegen deutlich nach. Die Gießen-Decke ist in diesem Szenario ein Fremdelement, das einem südlich anschließenden Ozean entstammt, dessen Existenz nicht mehr nachweisbar ist.
Frühere Altersangaben für diese Metamorphite, auch auf den geologischen Karten, erschöpften sich in dem etwas hilflosen Begriff „Vor-Devon“, was alles sein konnte, sogar Präkambrium. Inzwischen gibt es U-Pb-Altersbestimmungen an Zirkonen, die für die Vulkanite oberes Ordovizium und Silur belegen; das waren im Wesentlichen Andesite und Rhyolithe, die heute als metamorphe Grünschiefer bzw. Serizitgneise vorliegen, welche in einer neueren Nomenklatur jetzt als Meta-Andesite bzw. Meta-Rhyolithe bezeichnet werden. Ursprünglich scheinen sie in einem vulkanischen Inselbogen am Rande von Avalonia gebildet worden zu sein, als dieses Terran mit Laurentia kollidierte.
Auch die heute als Phyllite vorliegenden und nach Lokalbezeichnungen Eppsteiner bzw. Lorsbacher Schiefer genannten ehemaligen Tonschiefer mit sandigen und kalkigen Einlagerungen sind jetzt datiert worden: Sporenfunde zeigen, dass sie teilweise devonisch sind (Emsium und Oberdevon), es gibt aber auch Hinweise, die sogar unteres Ordovizium belegen. Am Aufbau der metamorphen Vordertaunus-Einheit sind neben Sedimenten auch Vulkanite beteiligt. Die Ausgangsgesteine der Metamorphite der Vordertaunus-Einheit scheinen in einem Inselbogenmilieu über einer Subduktionszone entstanden zu sein, wobei man diesen alten Ozean allerdings nicht mehr nachweisen kann, weil die ozeanische Kruste zwischen der Avalonia genannten Platte im Norden (die den Unterbau des Rheinischen Schiefergebirges bildet) und der südlich anschließenden, vom Nordrand Gondwanas herangedrifteten Armorika-Platte verschluckt wurde.
Dieser als Rheischer Ozean bezeichnete Ozean existierte bis zum Unterkarbon. Älteres Paläozoikum um Gießen scheint einen Rest von dessen ehemaligem Nordrand zu belegen (siehe unten „Lahnmulde“).
Das Subduktionsgeschehen hatte auch zu gelegentlicher Stapelung von Gesteinspaketen geführt. Die abgeleiteten Druck- und Temperaturverhältnisse bei der Metamorphose werden mit etwa 4 bis 6 kb und etwa 300 °C angegeben, was einer niedrigtemperierten Grünschieferfazies entspricht.
Im Norden schließt sich an die metamorphe Südrandzone der heute als Taunuskamm-Einheit bezeichnete Streifen an, der im Wesentlichen aus Sedimenten des älteren Unterdevons besteht. Im Gegensatz zu den in mehreren Phasen höchst kompliziert verschieferten Serien der Vordertaunusgesteine ist hier eine etwas einfachere Tektonik erkennbar, die nach heutigen Erkenntnissen wesentlich durch einen Schuppenbau gekennzeichnet ist; dabei sind Schichtfolgen ganz oder teilweise wiederholt und übereinander gestapelt worden.
Sie bestehen (stratigraphisch von unten nach oben) aus den Grauen Phylliten, deren Schiefer und Sandsteine nach Fossilien erst vor Kurzem in das oberste Silur eingestuft wurden. Darauf folgen die Bunten Schiefer des Gedinniums, die ihre roten Farben aus den Verwitterungsprodukten des Old-Red-Kontinents im Norden mitgebracht haben und deren Ausgangssedimente durch Flüsse transportiert wurden. Man hat sie am Roten Kreuz (bei der Auffahrt zum Großen Feldberg) in Stollen abgebaut, um Dachschiefer zu gewinnen; dieses Gesteinsband begleitet den Taunus-Südrand über Kloster Eberbach bis nach Assmannshausen, wo am Höllenberg Deutschlands teuerster Rotwein darauf wächst. Darin eingelagert gibt es auch Quarzite, die infolge ihrer Härte den Brunhildis-Felsen am Gipfel des Großen Feldbergs aufbauen. Zur tektonisch definierten Taunuskamm-Einheit gehören aber auch noch kleinere Vorkommen von Tonschiefern des Unter-Emsiums und mitteldevonische Riffkalke, die z.B. bei Köppern und Bad Nauheim angetroffen wurden.
Stratigraphisch folgt der Hermeskeil-Sandstein (nach dem Hunsrück-Dorf benannt), ein eher schwach verfestigtes Gestein unterhalb des Feldberggipfels, das für die Landschaft nicht annähernd die Bedeutung hat wie der darauf folgende, nächstjüngere Taunusquarzit, der mit vielen Hundert Metern Mächtigkeit die Geologie und die Morphologie dieses Gebirges ganz wesentlich prägt. Infolge seiner Härte bildet er auch die prominenten Berge des Taunuskamms (Altkönig, Kleiner Feldberg, Glaskopf, Hohe Kanzel), die Gegend der Saalburg, Köppern (dort der riesige Steinbruch der Firma Holcim, Abb. 7) und den Winterstein bei Bad Nauheim. Die keltischen Ringwälle am Altkönig sind aus diesem Material aufgeschichtet worden.
Hermeskeil-Sandstein und Taunusquarzit gehören in das Siegenium und lassen sich als Flachmeerablagerungen deuten.
Der Taunuskamm bildet eine weit reichende Überschiebungszone, wo älteres auf jüngeres Unterdevon nach Nordwesten überschoben wurde (Taunuskamm-Überschiebung, vgl. Abb. 5).
Durch tektonische Vorgänge während der variskischen Gebirgsbildung ist der Taunusquarzit auch eingemuldet worden; gelegentlich ist sogar eine Doppelmulde entwickelt, deren Kernbereiche aus dem harten Gestein heute zwei lokale Gebirgszüge aufbauen, die die Verwitterung in Form einer klassischen Reliefumkehr herauspräpariert hat.
Die in der Schichtenfolge nächstjüngeren Ablagerungen des Emsiums sind überwiegend Sand-, Silt- und Tongesteine und sie nehmen weite Bereiche vor allem im Hintertaunus ein (Abb. 8). Entsprechend werden sie heute als Hintertaunus-Einheit zusammengefasst (Anderle 1998). Darin eingeschaltete, manchmal bis zu einigen Metern mächtige Gesteinsbänke des Unter-Emsiums enthalten vulkanische Komponenten. Diese Porphyroide reichen in ihrer Zusammensetzung von rein vulkanischen Ablagerungen, die den Lenne-Vulkaniten ähneln, bis zu Mischgesteinen von rhyolithischem Material mit Schelfsedimenten. Die Vulkane vermutet man im nordöstlichen Rheinischen Schiefergebirge (Kirnbauer 1991).
Abb. 7: Großer Steinbruch der Firma Holcim bei Köppern. Der hier seit Langem in Abbau stehende Taunusquarzit ist von einzelnen Klüften durchzogen, an denen hydrothermale Eisenlösungen aufgestiegen sind (Foto von 2011).
Abb. 8: Steilgestellte, gefältelte Tonschiefer des Ober-Emsiums. Taunus, an der B 275 östlich von Esch.
Zu den großflächig vorkommenden Gesteinen im südwestlichen Hintertaunus gehören die vielfach dunklen Gesteinsserien des Hunsrückschiefers; heute wird dieser zeitlich überwiegend dem Unter-Emsium zugeordnet. Als Faziesbezeichnung ist dieser Begriff allerdings weiter reichend. Die Quertäler in dieser Gegend, z.B. das Aartal, bieten teilweise schöne Aufschlüsse, in denen auch die komplizierte Tektonik anschaulich wird.
Wenn man sich das Schichtpaket aus Schiefern des Gedinniums und Taunusquarzit stark vereinfacht zusammengefaltet vorstellt, so entsteht eine Mulde aus den wasserstauenden Schiefern, in deren Kern der geklüftete Quarzit liegt. Diese Situation ist im vorderen Taunus gegeben und man hat sie sich schon vor über 100 Jahren für die Wassergewinnung zunutze gemacht, indem man vom Taunus-Südrand her Stollen in die Schiefer getrieben hat, bis man zum Wasser führenden Quarzit kam. Dieses Grundwasser, das sich aus den hohen Niederschlägen am Taunuskamm speist, steht in der Muldenposition unter erheblichem hydrostatischem Druck. Durch Einbau von Dämmtüren in die Stollen konnte man diese gleichzeitig als unterirdische Reservoirs nutzen. Entsprechende Stollen gibt es inzwischen am gesamten Taunus-Südrand.
So ist der Taunus in eine Folge von Gesteinsstreifen gegliedert, die überwiegend Südwest-Nordost streichen. Kompliziert wird das Bild, wenn man sich vor Augen führt, dass die Vergenz der Falten nördlich der Taunuskamm-Überschiebung nach Nordwesten weist, während im Süden, einschließlich der metamorphen Gesteinsstapel, alles nach Südosten überkippt ist, sodass sich insgesamt eine Fächerstellung rekonstruieren lässt. Man stellt sich vor, dass die Falten zunächst einmal nordwestvergent angelegt waren und dass sie durch eine danach erfolgte Rückrotation in ihre heutige Lage gebracht wurden; dabei entstand auch eine zweite Schieferung in den Gesteinen. Infolge der gebirgsbildenden Vorgänge sind die Einheiten aber auch quer zum Streichen zerrissen, was an Nordwest-Südost verlaufenden Querstörungen erkennbar ist. Solchen Querstörungen folgen sehr oft auch die Täler, weil die Tektonik Schwächezonen geschaffen hat, die den Verlauf der Gewässer bestimmen.
Man muss annehmen, dass diese Bewegungen primär ein variskisches Alter haben. Diese „Sollbruchstellen“ sind aber in geologisch jüngerer Zeit, wahrscheinlich auch im Tertiär, wiederbelebt worden, und sie sind teilweise auch mineralisiert. Zeugnis davon geben die Nordwest-Südost streichenden Quarzgänge, die im Einzelfall noch heute als prominente Härtlinge die Landschaft prägen wie die Eschbacher Klippen bei Usingen. Dieser als „Usinger Gang“ bezeichnete Gang ist mit bis zu 80 m Mächtigkeit über 5 km weit zu verfolgen. Primär war darin Schwerspat abgeschieden worden, der erst später durch Quarz ersetzt wurde; deshalb werden sie heute als Pseudomorphosenquarzgänge bezeichnet. Neue Bestimmungen haben ein Rotliegend-Alter ergeben. Es sind also Zerrspalten, die infolge einer Dehnung der Erdkruste erst nach der variskischen Gebirgsbildung aufgerissen sind. Ihr Material, meist reiner Quarz, wurde zeitweise für die optische Industrie und die Porzellanherstellung gewonnen. Heute sind die Klippen beliebte Kletterfelsen (Abb. 9).
Der Taunus scheint nach der Zeit des Unterdevons, spätestens jedoch seit der variskischen Gebirgsbildung weitgehend Festland gewesen zu sein, vielleicht eine große Insel. So jedenfalls lassen sich die Riffkalke interpretieren, die zur Zeit des oberen Mitteldevons an seinen Rändern bei Bad Nauheim und Butzbach und, schon über dem Rhein, bei Stromberg am Hunsrück wuchsen.
Solche Kalke bei Wetzlar gehören schon zum Ablagerungsraum des Lahntroges, den die Geologen zusammen mit entsprechenden Bildungen im Dillgebiet heute als Lahn-Dill-Synklinorium bezeichnen. Im Sinne der geographischen Abgrenzung gehört die südliche Lahnmulde aber noch zum Taunus.
In der Zeit nach der variskischen Gebirgsbildung war der Taunus bis heute Hochgebiet, auf dem Verwitterung und Abtragung herrschten. Das hat zu Zehnermeter dicken Tonschichten geführt, die allerdings nur in Senkungsgebieten wie der Idsteiner Senke oder dem Limburger Becken noch weitgehend erhalten sind.
Umlagerungsvorgänge im mittleren Tertiär haben gelegentlich die Korngrößen des Verwitterungsmaterials sortiert, wobei zum einen Kiese und Sande, zum anderen Tone abgelagert wurden, die u.a. die Rohstoffe für die Tonindustrie bilden. Auffällig sind dabei die weißen Milchquarzschotter, deren Material aus den vielen Kluftfüllungen stammt, die man überall in den devonischen Gesteinskomplexen beobachten kann. Die lange Festlandszeit hatte das Gebiet weitgehend in eine Rumpffläche verwandelt, was sich heute noch in der überwiegend ebenen Landschaft des Hintertaunus zeigt. Die Quarzitzüge der Taunuskamm-Einheit dagegen haben der Verwitterung widerstanden und bilden deshalb die höchsten Erhebungen.
Die Senkungsgebiete sind durch eine junge Bruchschollentektonik geprägt, bei der durch vertikale Versätze während des Tertiärs ein sehr kleinräumiges Schollenmosaik entstanden ist; das zugehörige Störungssystem zeigt vorwiegend Nord-Süd- und Ost-West-Richtungen. An dieses System sind auch Mineralquellen geknüpft. Die Nord-Süd verlaufenden Störungen zeigen an, dass sich die Bruchstrukturen des Oberrheingrabens bis in den Taunus hinein auswirken (Anderle 1974).
Den Taunus-Südrand begleitet eine größere Anzahl an Mineral- und Thermalquellen; sie bilden eine Bäderlinie, die so klingende Namen wie Bad Homburg, Bad Soden oder Wiesbaden („Aquis Mattiacis“) vereint. Die Thermalwässer (Wiesbaden, Kochbrunnen > 65 °C) sind durch die große Störungszone bedingt, an der Oberflächenwässer bis in Tiefen von etwa 2000 m absinken und dort geothermal aufgeheizt werden. Eine weitere Wärmequelle könnten tertiäre Basaltschlote bilden, die auch CO2 liefern.
Für salinare Wässer wird einerseits ein Transport aus dem Werra-Fulda-Gebiet mit seinen Zechsteinsalzen, andererseits auch eine Herkunft aus dem Miozän des Oberrheingrabens entlang von Störungen diskutiert.
Anderle 1974, Anderle 2019, Anderle & Eckert 1976, Anderle et al. 1990, Thews 1996
Abb. 9: Eschbacher Klippen bei Usingen im Taunus. Mauerartig herausgewitterte Quarzfüllung einer kilometerlangen Gangspalte in unterdevonischen Sedimentgesteinsfolgen.
Abb. 10: Geologische Übersichtskarte zum Lahn-Dill-Gebiet (Nesbor 2019). Neben den autochthonen Einheiten sind hier auch die zahlreichen neu definierten ortsfremden Decken abgebildet.