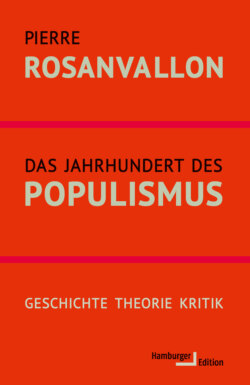Читать книгу Das Jahrhundert des Populismus - Pierre Rosanvallon - Страница 12
1Eine Auffassung des Volkes: das homogene Volk
ОглавлениеDie populistischen Bewegungen haben gemein, das Volk zu einer zentralen Figur der Demokratie zu erheben. Eine Tautologie, könnte man meinen, denn der demos ist definitionsgemäß der Souverän in einem System, das sich auf ihn beruft. Jede gute Demokratie kann also in diesem sehr allgemeinen Sinne nur populistisch sein. Doch diese Selbstverständlichkeit ist in der Praxis ebenso unklar wie sie sich begrifflich aufzudrängen scheint. Denn wer ist dieses gebieterische Volk? Diese Frage wurde immer schon gestellt. Anfangs schwankten die Bezugnahmen zwischen denen auf ein ziviles Volk, als Figur der politischen Allgemeinheit und Ausdruck einer Einheit, und denen auf ein soziales Volk, das de facto mit einem besonderen Teil der Bevölkerung gleichgesetzt wurde. Als die Amerikaner 1776 ihre Unabhängigkeitserklärung mit We the People unterzeichneten, hatten sie Ersteres im Sinn. Ebenso wie die Protagonisten der Französischen Revolution, die ständig Volk und Nation (die explizit nur auf einen historischen und politischen Begriff verweist) im Munde führten. Dieses Volk entsprang einem Verfassungsprinzip oder einer politischen Philosophie, bevor es noch eine konkrete Existenz annahm (eine Existenz zumal, die sich auf eine selten einige Wählerschaft reduzierte). Doch als man 1789 von dem Volk sprach, das die Bastille gestürmt hatte, bezog man sich auch auf eine Menge mit einem Gesicht. Ein solches hatten auch jene, die sich 1789 auf dem Marsfeld versammelten, um das Föderationsfest zu feiern, oder jene, die 1830 und 1848 Barrikaden bauten. Das Volk nahm in diesen Fällen eine spezifische Erscheinung an. Das Volk von Michelet oder Victor Hugo hatte eine fassbare Gestalt, die der kleinen Leute (weswegen Letzterer seinem Hauptwerk den Titel Die Elenden gab). Man konnte in diesen Fällen von einem sozialen Volk sprechen. Man musste von ihm erzählen und es in Szene setzen, um es aus seinen besonderen Existenzformen herauszuschälen und ihm Ehre zu erweisen. Nach und nach setzte sich ein eher soziologischer Ansatz durch, um seine Konturen zu schärfen. Das soziale Volk erhielt nun Namen wie Proletariat, Arbeiterklasse oder »Volksschichten« (ein Plural, der der Komplexität seiner sozialen Zusammensetzung Rechnung trug). Diese Klassensprache spezifizierte seine Bedeutung. Doch diese Reduktion wurde durch die statistische Tatsache der Größe einer Arbeiterschaft mit ausgeprägter Identität korrigiert. Zumal die marxistische doxa in der Arbeiterklasse die Wegbereiterin eines neuen Universalismus ausmachte, den der klassenlosen Gesellschaft.
Diese beiden Völker, das Volk als Klasse und als Bürgerschaft, fielen zwar nicht zusammen, waren aber Teil der gleichen Erzählung und der gleichen Vision des Wahrwerdens einer zugleich als Regierungsund Gesellschaftsform verstandenen Demokratie. Diese Perspektive trübte sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein. Und zwar auf doppelte Weise. Zunächst durch den Schwund einer Wählerschaft, die sich zunehmend der Stimme enthielt, als Ausdruck der Ablehnung der traditionellen Parteien und eines Gefühls, schlecht repräsentiert zu werden; ein Schwund, der auch mit dem Niedergang der demokratischen Leistungsfähigkeit von Wahlen zusammenhängt.1 Ferner, und soziologisch gesprochen, durch die Tatsache der Individualisierung des Sozialen sowie der Veränderung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, in denen sich neue Ausbeutungs-, Ausgrenzungs- und Herrschaftsmodalitäten abzeichnen. Umwälzungen, die zu selten beschrieben werden und die das Gefühl, schlecht repräsentiert zu werden und unsichtbar zu sein, bei einem wachsenden Teil der Bevölkerung in den meisten Ländern verstärkt haben. Das Volk ist unter diesen Bedingungen »unauffindbar« geworden.2 In diesem Kontext ist der populistische Volksbegriff entstanden, als vermeintlich angemessenerer Kommentar zur Gegenwart und Teil einer Perspektive, die zur Neubegründung der Demokratie anregt.