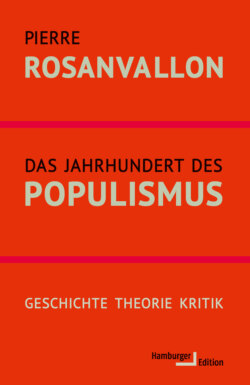Читать книгу Das Jahrhundert des Populismus - Pierre Rosanvallon - Страница 19
Der unmittelbare Ausdruck des Volkes
ОглавлениеSchließlich gibt es in populistischer Perspektive ein implizites Verständnis der Evidenz des Gemeinwillens, sobald der Sieg über die Feinde des Volkes einmal errungen ist. Das entspricht der politischen Philosophie von Carl Schmitt. Für Schmitt10 geht das Bekenntnis zur öffentlichen Akklamation als vollendete Form der Demokratie nämlich einher mit einer Kritik an den mit dem Pluralismus des liberalparlamentarischen Ansatzes verbundenen Illusionen. Denn für ihn war das Volk, das sich im Kampf gegen seine Feinde herausbildet, zwangsläufig homogen und einstimmig. Ohne Schmitts Vorstellung von ethnischer Homogenität zu übernehmen, haben seine »populistischen Leser*innen« wie Chantal Mouffe oder Ernesto Laclau doch seine Idee von Einstimmigkeit als regulatorischer Horizont des demokratischen Ausdrucks bewahrt, mit allem, was dies im Hinblick auf die Ablehnung argumentativer und deliberativer Theorien beinhaltet.11 Politische Teilhabe definiert in diesem Rahmen kein aktives Bürgerengagement, das sich auf die Formulierung persönlicher Meinungen und die Konfrontation der Standpunkte gründet, sie verweist vielmehr auf die Tatsache, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen.12 Das ist eine Form von Rousseauismus in Verbindung mit Annahmen über die Vorzüge und Potenziale der Volksspontaneität, des gesunden Menschenverstandes der Massen. »Alle Individuen«, äußerte sich Chávez 2007 in typischer Manier, »erliegen Irrtümern und Verlockungen, nicht aber das Volk, das ein enormes Bewusstsein für das eigene Wohl und das Maß seiner Unabhängigkeit besitzt. Deshalb ist sein Urteil aufrichtig, sein Wille stark, und niemand kann es bestechen oder auch nur bedrohen.«13 Eine Sichtweise, die direkt jenen Passagen des Gesellschaftsvertrags entsprungen scheint, die davon ausgehen, dass der Gemeinwille sich nicht irren könne.
Eine solche unmittelbare Demokratie erfordert keine strukturierten politischen Organisationen, die nach dem Prinzip der internen Demokratie funktionieren; sie fördert vielmehr ein Vorgehen, sich zu einem bestehenden politischen Angebot zu bekennen. Interne Demokratie würde nämlich heißen, dass Strömungen existieren, Strategiedebatten, Konkurrenz zwischen Individuen, auf diese Weise sind Parteien üblicherweise strukturiert. Eine Bewegung kann hingegen nur ein kohärentes und zusammengehöriges Ganzes bilden, nach dem Bild des homogenen Volkes, dessen Geburtshelfer und Ausdruck sie sein will. Deshalb befindet sie sich im Einklang mit der neuen Welt der sozialen Netzwerke, in der sich die Kategorie des followers eingebürgert hat, um die typische Art der Beziehung zwischen den Individuen und einem Initiativpunkt zu bezeichnen.
Die Medienkritik, die im Zentrum der populistischen Rhetorik steht, muss im Hinblick auf dieses Unmittelbarkeitsprinzip verstanden werden. Trumps Beschimpfungen der Journalisten, Orbáns Vorwürfe gegen die Gefolgsleute von George Soros oder Mélenchons Aufrufe zu einem »gesunden und gerechten Hass auf die Medien« sind keine bloßen Wutausbrüche. Sie mögen zwar auch der Verärgerung und dem Groll über widerstrebende Kräfte entspringen, sind aber in erster Linie charakteristisch für eine Theorie unmittelbarer Demokratie, die den Anspruch vermittelnder Organe – und die Presse ist eines der wichtigsten von ihnen –, eine aktive Rolle bei der Gestaltung des öffentlichen Lebens und der Bildung der öffentlichen Meinung zu spielen, als strukturell illegitim zurückweist. Die Medien sind für sie Störfaktoren, die den Ausdruck des Gemeinwillens beeinträchtigen, und keine Organe, die zu seiner Bildung notwendig sind. Eine Illegitimität, die man als funktional bezeichnen könnte – hinsichtlich der Prämisse demokratischer Spontaneität –, verbunden mit einer moralischen Illegitimität, die aus der vermuteten Abhängigkeit von Partikularinteressen und Geldmächten resultiert.
1Chantal Mouffe, Das demokratische Paradox, S.22.
2Jean-Marie Le Pen, »Pour une vraie révolution française«, National Hebdo, 26. September 1985. Er grenzte sich damit von der Maurras’schen und konterrevolutionären Tradition des Rechtsextremismus ab, die den demokratischen Gedanken verwarf. Dieser Artikel markierte auch eine Abwendung von seiner eigenen vorherigen Skepsis eines »Churchilldemokraten«. Vgl. sein vorheriges Manifest Les Français d’abord von 1984.
3Ebd.
4Siehe das Kapitel »Rendre le pouvoir au peuple« des Programms Le Grand Changement, mit einem Vorwort von Jean-Marie Le Pen.
5Siehe exemplarisch Yvan Blot, Les Racines de la liberté (Kap. VIII, »Le modèle suisse«, und Kap. IX »Le recours: la démocratie authentique«) und La Démocratie directe: une chance pour la France.
6Rede im Zenith de Nantes, 26. Februar 2017. Sie sah sich zu diesem Zeitpunkt mit mehreren strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert, die sich sowohl auf die Abläufe in ihrer Partei als auch auf die Tatsache bezogen, dass sie persönliche Mitarbeiter*innen im Front national vom europäischen Parlament hatte bezahlen lassen.
7Siehe den typischen Artikel von Alain de Benoist, »Vers une juridictature«, Éléments, Nr. 178, Mai-Juni 2019. Siehe, in derselben Nummer, das gesamte Dossier »Les juges contre la démocratie. Pour en finir avec la dictature du droit«.
8Vergleiche meine diesbezüglichen Ausführungen (»Historische Anmerkungen zur Richterwahl«) in: Demokratische Legitimität. Unparteilichkeit, Reflexivität, Nähe.
9Die Formel stammt von Wladislaw Surkow, der in den 2000er Jahren die Rolle des organischen Intellektuellen und spin doctors für Putin spielte.
10Carl Schmitt (1888–1985) war einer der großen deutschen Rechtsgelehrten des 20. Jahrhunderts. Als fundierter Kritiker des Liberalismus und Parlamentarismus vertrat er eine realistische Sicht der (als Freund-Feind-Konflikt definierten) Politik und eine rassistische und unanimistische Auffassung des Volkes. Seine Entwicklung in Richtung Nationalsozialismus trug dazu bei, sein Denken zu diskreditieren; aber er wurde in den 1980er Jahren »wiederentdeckt«, von einer extremen Rechten auf der Suche nach Vordenkern und einer extremen Linken, die von seiner antiliberalen Radikalität und seinem Kult der Stärke fasziniert war.
11Siehe dazu Philippe Urfalino, »Un nouveau décisionnisme politique: la philosophie du populisme de gauche«, Archives de philosophie, Januar 2019. Hier ist daran zu erinnern, dass die Kritik an den »diskutierenden Klassen« sich wie ein roter Faden durch das antiliberale (heute würde man sagen, rechtsextreme) Denken zieht, von Donoso Cortés über Barrès und Maurras bis zu Carl Schmitt. Sie ist auch die Wurzel des Antiintellektualismus, der diese Autoren vereint. Ihrer Meinung nach muss die Logik der Intellektuellen zurückstehen hinter dem Instinkt der einfachen Leute, der allein eine richtige Beziehung zur Realität ausdrückt.
12So lautet übrigens die explizite Definition von Alain de Benoist in: Démocratie: le problème.
13Zitiert in dem Werk von Cas Mudde und Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populismus: eine sehr kurze Einführung, S.40.