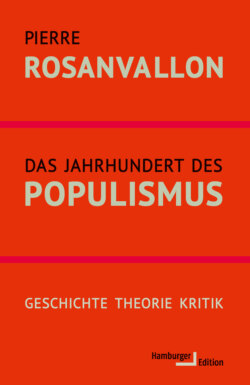Читать книгу Das Jahrhundert des Populismus - Pierre Rosanvallon - Страница 14
Sie und Wir
ОглавлениеLaclau begreift also den Populismus als Folge einer »horizontalen Äquivalenzlogik«5, die die Gesamtheit gesellschaftlicher Forderungen zusammenfasst. Diese Zusammenfassung wird durch die Einsicht ermöglicht, dass ein gemeinsamer Feind existiert, der die Trennlinie zwischen »ihnen« und »uns« zieht. Dieser Feind kann als »Kaste«, als »Oligarchie«, als »Elite« oder als »System« im Allgemeinen identifiziert werden. Seine Existenz markiert eine »innere Grenze, die das Soziale in zwei getrennte und antagonistische Lager teilt«. Eine Sicht, die im diametralen Gegensatz zu einem »liberalen« Verständnis sozialer Konflikte und Forderungen steht, demzufolge diese stets Gegenstand von Kompromissen und Schlichtungen sein können. Beim populistischen Projekt handelt es sich demnach für Laclau um eine Radikalisierung der Politik als Entstehungs- und Aktivierungsprozess einer Freund-Feind-Beziehung. Daher der zentrale Stellenwert eines Begriffs wie »Antagonismus« bei ihm, der es ermöglicht, Konflikte zu bezeichnen, für die es keine rationale und friedliche Lösung gibt. Daher auch die mit Chantal Mouffe geteilte Faszination für das Werk von Carl Schmitt, seine politische Theorie und seinen radikalen Antiliberalismus. Eben diese Faszination macht eines der intellektuellen Bindeglieder zwischen Rechts- und Linkspopulismus aus, wie die Ähnlichkeit der Analysen eines Alain de Benoist6 mit denen von Ernesto Laclau bezeugt.
Diese Benennung eines Volksfeindes beruht nicht nur auf der Feststellung eines Interessengegensatzes oder einer Machtkonkurrenz. Sie hat auch eine instinktive Dimension, sie beruht auf der Wahrnehmung einer Distanz, einer Verachtung, einer fehlenden Empathie. Die populistischen Bewegungen legen übrigens großen Wert auf die Macht der Gefühle bei der politischen Mobilisierung und der Erzeugung des Gefühls, dass sich fremde Welten gegenüberstehen und unüberwindliche Lager zwischen »ihnen« und »uns« schaffen. Es ist der Mangel an Menschlichkeit seitens der »Kaste«, der »Elite« oder der »Oligarchie«, der den Hass rechtfertigt, den man ihnen legitimerweise entgegenbringt: sie werden als Gruppen empfunden, die sich gesellschaftlich und moralisch aus der gemeinsamen Welt verabschiedet haben. Daher die Heftigkeit der Anklage gegen diejenigen, die sich auf Kosten des Volkes »die Taschen füllen«, die Stigmatisierung der »Geldzauberer«, die Schätze »raffen« und »horten« und sich auf tausenderlei Arten von ihren Mitbürger*innen entfremden. Die Figuren des Politikers, des Milliardärs und des Technokraten verschmelzen in diesen Schmähungen zu einem Bild des Abscheus.