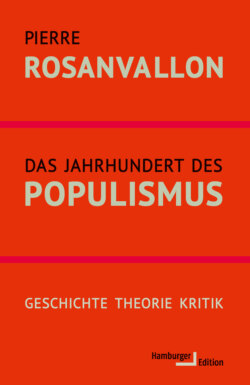Читать книгу Das Jahrhundert des Populismus - Pierre Rosanvallon - Страница 24
Die Rückkehr des politischen Willens
ОглавлениеAus protektionistischer Perspektive wird die Herrschaft des Freihandels und der ihn begleitenden Globalisierung nicht nur im Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Bilanz bewertet, die man aus ihnen ziehen könnte, ob im globalen Rahmen oder an spezifischen Punkten. Sie werden zunächst als Urheber einer Zerstörung des politischen Willens angeprangert. Denn sie gehen mit der Übertragung der Regierungsmacht auf anonyme Mechanismen einher und verabschieden so die Möglichkeit einer souveränen Bestimmung der Völker über ihr Schicksal. Sie entwerfen eine vermeintlich von »objektiven« Regeln regierte Welt, die bereits dem Gedanken an eine Alternative zur bestehenden Ordnung jede Grundlage entzieht.3 Diese Enteignung wird noch verschärft durch den Aufstieg unabhängiger Behörden, die sich überall in ihrem Gefolge ausbreiten. Für die europäischen Populismen erscheint die Europäische Union als Symbol und Labor dieser perversen Vereinnahmung der Volksmacht durch Expert*innenwissen und die unsichtbare Hand des Marktes. Sie veranschaulicht in ihren Augen auf exemplarische Weise die Einführung einer »Regierung durch Zahlen«, die an die Stelle der Ausübung des politischen Willens tritt.4
Diese Kritik bildete die Grundlage für den Erfolg des Brexit-Votums in Großbritannien von 2016, bei dem sich Boris Johnson und Nigel Farage als Vorkämpfer des »Can do« (Man kann es schaffen) durch Wiederherstellung einer aktiven (und wohltuenden) Souveränität des britischen Volkes über sein Schicksal präsentierten. Zwar befürworteten Johnson und Farage auch einen gewissen Liberalismus im Bereich des Außenhandels, doch blieb dieser ganz einer nationalistischen Sicht der Wirtschaft verpflichtet. In Frankreich wird Marine Le Pen nicht müde, auf der gleichen Basis die anonyme Macht des »göttlichen Marktes« zu kritisieren, und sieht in der Europäischen Union, der »Avantgarde der Globalisierung«, die exemplarische Illustration eines »Verzichtshorizonts«.5 Der Verantwortliche für das Wirtschaftsprogramm von Jean-Luc Mélenchon wiederum publizierte zur selben Zeit ein Werk mit dem sprechenden Titel Nous, on peut!6 und dem noch expliziteren Untertitel »Warum und wie ein Land gegenüber den Märkten, den Banken, den Krisen stets agieren kann, wie es will«. Dieses Plädoyer zugunsten des Nationalprotektionismus verstand sich somit klar und deutlich als Teil einer demokratischen Erneuerung, weit hinaus über die bloße Thematisierung der Frage unter wirtschaftspolitischen Aspekten. Es ist deshalb einer der Grundpfeiler der populistischen Sicht des politischen Willens.
Dieses demokratietheoretische Verständnis des Protektionismus ist in der populistischen Denkweise unmittelbar mit der Analyse der Immigration verknüpft. Deren Zunahme wird nämlich als ein Prozess beschrieben, der dem Land von den herrschenden Klassen, die nach billiger Arbeitskraft streben, aufgezwungen wird; ohne dass irgendeine demokratische Entscheidung ihn explizit gutgeheißen hätte.7 Es liegt also auf diesem Gebiet für die Populist*innen eine nicht akzeptable Umgehung des Volkswillens vor, als Produkt einer kapitalistischen Strategie, die zu einer Deklassierung und Schwächung der einheimischen Volksschichten geführt hat. Erweitert auf die Wiedererlangung der Kontrolle über die Migrationsströme wird das protektionistische Gebot somit auch als Teil einer Stärkung der Volkssouveränität betrachtet. Der politische Souveränitätsbegriff ist auch hier, in populistischer Sicht, absolut untrennbar vom Verständnis wirtschaftlicher und sozialer Fragen.