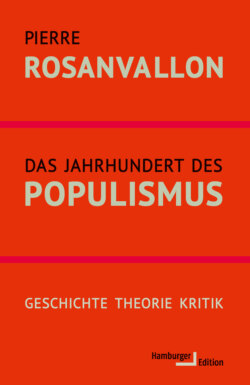Читать книгу Das Jahrhundert des Populismus - Pierre Rosanvallon - Страница 15
Die Macht eines Wortes
ОглавлениеDas Wort »Volk« erscheint auch deshalb heute besonders sinnfällig, weil es dem, was viele Bürger*innen undeutlich empfinden, eine Sprache gibt. Während die Begriffe der traditionellen Soziologie, das statistische Vokabular der sozioprofessionellen Kategorien und die Kriterien der Verwaltungsformulare ihnen einer toten Sprache anzugehören scheinen, die weit von ihrem Leben und ihren Erfahrungen entfernt ist. Die Spaltung zwischen dem »Oben« und dem »Unten« der Gesellschaft wird nämlich auch auf ganz existenzielle Weise erlebt. Die Eliten werden beschuldigt, in einer Welt zu leben, die nicht mehr weiß, was vor ihren Türen passiert. Und das Volk definiert sich spiegelbildlich als die Welt der Männer und Frauen, die in den Augen dieser Wichtigtuer namenlos sind. Die soziale Spaltung enthält somit auch eine »kognitive Distanz«, eine Kluft zwischen den »statistischen Wahrheiten«, die die Regierenden anführen, um den Zustand der Gesellschaft zu beschreiben, und den gefühlten Lebensbedingungen. Das beliebige Individuum hat nämlich nichts mit den Durchschnittsmenschen in der heutigen Gesellschaft zu tun: Es ist immer besonders.
Die positive Wiederaufnahme des Wortes »Volk« ist in diesem Kontext zu sehen. Sein neuerlicher Gebrauch verweist nicht mehr auf eine politische Abstraktion oder eine gesichtslose Menge. Gerade in seiner Unbestimmtheit scheint es sich dem konkret fassbaren Leben eines jeden zu öffnen. Es gibt einer Gesellschaft von Individuen aufgrund seiner Empfänglichkeit für Singularitäten eine kollektive Form. Und das umso mehr als die glorreiche Geschichte, die ihm eigen ist, die Stellung derer, die sich beherrscht, unsichtbar gemacht oder in der Besonderheit ihrer Umstände eingesperrt fühlen, in gewisser Weise aufwertet. Man kann so stolz in Anspruch nehmen, zum Volk zu gehören während man sich ein wenig dafür schämt, durch einschränkende Kriterien definiert zu werden (arbeitslos zu sein, vom Mindestlohn zu leben, schlecht über die Runden zu kommen, geringe Schulabschlüsse zu haben …). Das Wort ermöglicht somit gleichzeitig, einen Wutschrei zu artikulieren und einen gewissen Adel zur Schau zu stellen.
Mit dem Gebrauch dieser vorteilhaften und polarisierenden Identifikation geht auch die mögliche Rückkehr zu rhetorischen Figuren und affektiven Ausdrucksformen einher, in denen die alten revolutionären Aversionen gegen die Privilegierten wieder aufscheinen, die als nicht zur Nation gehörig betrachtet werden, sowie jene Art von Dämonisierung des Fremden, die zu Kriegszeiten oft zu beobachten war. Die moralische Disqualifizierung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle beim Zusammenwerfen aller jener zu einer Einheit, die, in den verschiedenen Bedeutungen des Wortes, als korrumpiert gelten. Das Volk bildet dazu den Kontrast: Es ist tugendhaft, hat Verständnis für die Leiden anderer und arbeitet hart für seinen Lebensunterhalt. Die Parallele zur Denkweise Robespierres ist hierbei umso auffälliger, als sich ein Jean-Luc Mélenchon ausdrücklich auf ihn berufen hat.7 Sie ist es übrigens auch unter dem Aspekt der Gleichsetzung politischer Gegner mit ausländischen Agenten, ihrer Beschreibung als Helfershelfer des internationalen Kapitalismus, eines globalisierten Multikulturalismus oder eines technokratischen Europa, das die nationale Souveränität mit Füßen tritt; der Begriff »Neoliberalismus« fasst dabei in einem Wort die politische und soziale Kultur der »Kaste« zusammen. In einem allgemeineren Sinne könnte man sagen, dass das Wort »Volk« doppelgesichtig ist wie Janus. Es knüpft an den Gedanken einer gewissen moralischen Größe an, während es zugleich die finstersten Hassgefühle rechtfertigt.8 Es konstruiert das politische Feld auf eine Weise, dass der Gegner nur ein Feind der Menschheit sein kann. Es dient dazu, dem Unglück einen Namen zu geben und zugleich den Weg zu einer gewissen Art von Wandel zu weisen.
Unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten versuchen die populistischen Bewegungen, der Beschwörung eines unauffindbar gewordenen homogenen Volkes eine fassbare Gestalt zurückzugeben, eine Referenzgröße, die zuvor nur ein »schwebender Signifikant«, ja ein »leerer Signifikant« gewesen war, gemäß den bereits zitierten Formulierungen von Ernesto Laclau. Diese Art, »ein Volk zu konstruieren«9, wirft natürlich viele Fragen auf, auf die wir in jenem Teil dieses Buches zurückkommen werden, der den Voraussetzungen einer angemessenen Kritik des Populismus gewidmet ist. Doch gilt es zu betonen, dass sie den Vorteil aufweist, den Bruch oder zumindest die Spannung zwischen dem zivilen Volk und dem sozialen Volk zu reduzieren. Denn beide fallen zusammen mit dem Verweis der Regierenden und der verschiedenen Arten von Eliten oder Oligarchien in dieselbe Kategorie, die der Kaste zum Beispiel. Die Wiederbelebung der Demokratie und die Verbesserung der Lebensbedingungen hängen also, dieser populistischen Perspektive zufolge, von der gleichzeitigen Verabschiedung dieser kleinen, einheitlichen Gruppe von Volksfeinden ab, sodass sich sozialer Kampf und politische Konfrontation überlagern.10 Eben das begründet ihre Stärke.
1Vergleiche dazu die Ausführungen in meiner Vorlesung von 2018 am Collège de France.
2Ich erlaube mir, auf mein Werk Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France zu verweisen.
3Chantal Mouffe, Für einen linken Populismus, S.16–17.
4Ernesto Laclau, »Logiques de la construction politique et identités populaires«, S.151. Dieser Text besteht aus Exzerpten von On Populist Reason und stellt eine gute Zusammenfassung seines Buches dar.
5Ebd., S.152.
6Siehe seinen Artikel »Ernesto Laclau: le seul et vrai théoricien de populisme de gauche«, Éléments, Nr. 160, Mai-Juni 2016.
7Siehe sein Gespräch mit Marcel Gauchet in: Philosophie Magazine, Nr. 124, Oktober 2018 (Gauchet hatte gerade Robespierre, l’homme qui nous divise le plus, veröffentlicht). Siehe auch sein mit Cécile Amar verfasstes De la vertu.
8Die Wahrung der eigenen Identität und Würde kann sich beispielsweise in einer Ablehnung als »fremdartig« geltender Religionen äußern (vor allem des Islam).
9Diesen Titel hat Chantal Mouffe einem gemeinsam mit der Nummer zwei von Podemos in Spanien verfassten Buch gegeben (Chantal Mouffe/Íñigo Errejón, Construir Pueblo; frz. Construire un peuple).
10Daher die geringe Aufmerksamkeit, die den Gewerkschaften seitens der populistischen Bewegungen zuteilwird.