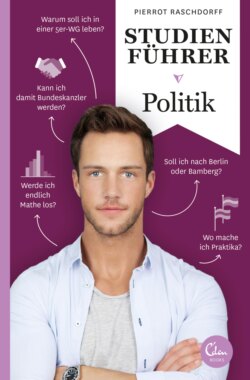Читать книгу Studienführer Politik - Pierrot Raschdorff - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 ANFORDERUNGEN AN STUDENTEN DER POLITIKWISSENSCHAFT
ОглавлениеNachdem Du nun eine erste grobe Übersicht zu den Basisinhalten des Fachs Politikwissenschaft erhalten hast, kannst Du sicherlich schon besser einschätzen, ob Du Interesse hättest, das Studium der Politikwissenschaft erfolgreich durchzuziehen und abzuschließen. Natürlich betone ich bewusst zunächst eher die Herausforderungen als die Highlights, dabei sei aber gesagt, dass jedes Studienfach seine trockenen Pflichtbereiche mit sich bringt. Politikwissenschaft macht hier keine Ausnahme – wenn Du jedoch weißt, was Du willst, und eine Ahnung hast, was auf Dich zukommt, fällt das Durchhalten in solchen Zeiten meist nicht allzu schwer.
Als weitere Orientierungshilfe können die unten stehenden Aussagen dienen, mit denen ein paar der Hauptanforderungen nochmals zusammengefasst werden sollen. Falls Du Dich mit einigen von ihnen identifizieren kannst, ist das Politikwissenschaftsstudium wahrscheinlich genau das Richtige für Dich. Ein gesundes Maß an Interesse reicht aber zunächst auch, wenn Du zumindest komplett von diesen Aussagen abgeschreckt wirst oder genervt mit den Augen rollst.
Ø»Ich bin eine Leseratte.« Du musst keinesfalls professioneller Literaturkritiker, -blogger oder Mitglied sämtlicher Buchclubs Deiner Stadt sein. Die Bereitschaft zu lesen ist jedoch Voraussetzung für das Studium jeder Sozialwissenschaft und somit gilt dies auch für das Fach Politikwissenschaft. Jedes Seminar beginnt mit der Sichtung und Ordnung vieler Artikel, Berichte oder Studien, die möglichst alle gelesen und verstanden werden sollten. Natürlich gibt es in jedem Studiengang Phasen, in denen ein Kampf gegen die eigene Bequemlichkeit tobt – die Wenigsten schaffen es, über Jahre hinweg gleichbleibend motiviert mitzuziehen. Wer aber seine Seminare möglichst erfolgreich absolvieren möchte und nicht nur darauf abzielt, seine Scheine irgendwie mit möglichst geringem Aufwand gerade eben noch so zu bestehen, muss regelmäßig und viel lesen. Im Studium stehen Dir für solche Pflichtaufgaben aber auch mehr Freiräume zur Verfügung als noch zur Schulzeit. Abends im Café, nachts allein zu Hause, vormittags in der Bibliothek oder nachmittags im Park mit gleichgesinnten Kommilitonen und einem Grill? Finde heraus, an welchem Ort und mit wem, mit welcher Geräuschkulisse und zu welchen Uhrzeiten Du Dich am wohlsten fühlst und wo Du lange und konzentriert sitzen kannst. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Café gern genommen wird, aber die Effizienz leider oftmals zu wünschen übrig lässt. Nach zwei Seiten Lektüre steht dann doch ganz gern ein Kommilitone mit einem frischen Milchkaffee vor Dir und ist eher zum Plaudern als zum gemeinsamen Lesen aufgelegt. Nach einer Zeit kennt man auch das Personal dieser Läden gut genug, um sich stundenlang zu unterhalten. Gerüchten nach soll es aber Freundeskreise gegeben haben, bei denen die gemeinsame Lektüre besser funktioniert hat. Manche Studenten suchen regelrecht nach lauten Geräuschkulissen, um sich ihren Büchern widmen zu können, ohne das Gefühl haben zu müssen, das Leben ziehe draußen an einem vorbei. Egal wie Du es anstellst – aber finde Deinen Weg, zu lesen.
Ø»Ich bringe Dinge (gern) schriftlich auf den Punkt.« Neben dem Lesen gehört es natürlich dazu, Übung darin zu bekommen, Deine Sichtweise nach wissenschaftlichen Ansprüchen zu Papier zu bringen. Das Verfassen von Arbeiten fällt besonders zu Anfang nicht immer leicht, wird aber nach und nach zur Routine. Denn als Bachelor- und später auch als Masterstudent sind Hausarbeiten ein immer wiederkehrender, zentraler Bestandteil des Studiums. Sei Dir darüber im Klaren, dass Dir schriftliche Arbeiten und Referate für Seminare scheinbar endlos, konstant, immer wieder begegnen. Dabei wirst Du auch Deinen Kommilitonen in ewigen Referatsschlaufen zuhören müssen.
Für viele Politikwissenschaftsstudenten ist dies ein Liebeskiller, versuch also, Dich darauf einzustellen, zu begeistern oder doch zumindest zu entspannen. Neben den Hausarbeiten, in denen Du auf etwa zehn bis dreißig Seiten eine zentrale Fragestellung zu beantworten beziehungsweise ein politisches Phänomen zu untersuchen hast, gehört zu vielen Seminaren die Aufgabe, Essays (von etwa zwei bis zehn Seiten) zu gelesenen Texten zu verfassen. Klar im Vorteil ist also, wer in der Schule nicht nur politisch interessiert war, sondern sich auch im Deutschunterricht positiv hervorgetan hat. Falls dies bei Dir nicht der Fall war, Du Dich aber in Rechtschreibung und Grammatik einigermaßen sicher fühlst, wirst Du während des Studiums schnell Übung im Verfassen von prägnanten, wissenschaftlichen Texten erhalten.
Klug klingende, seitenlange Schwafeleien mit extra viel Umfang machen Dich bei Profs nicht sonderlich beliebt. Anders als bei Schulklausuren geht es spätestens an der Uni nicht mehr darum, darzustellen, wie viel Du als Person weißt, und möglichst alles davon zu schreiben, sondern um sauber aufgebaute, gut und knackig argumentierte, belegbare Darstellungen der Sachlage oder Erörterung der Forschungsfrage.
Ø»Ich schaue Serien nur in Originalsprache.« Eigentlich versteht es sich fast von selbst, dass gute Englischkenntnisse heutzutage für fast alle akademischen Berufe wichtig sind. Es soll an dieser Stelle aber noch einmal betont werden, dass es in der Politikwissenschaft von besonderer Bedeutung ist, Englisch gut zu verstehen und lesen zu können. Nicht nur dadurch, dass immer mehr Wissenschaftler sich international miteinander vernetzen, viele Seminare, Symposien, Kongresse und andere Veranstaltungen auf Englisch abgehalten werden oder ganze Bereiche der Fachliteratur zu Grundsatzthemen fast nur noch auf Englisch erhältlich sind. Auch ist zu beachten, dass sich die komplexen internationalen Zusammenhänge, Bündnisse und Zwischenstaatlichen Organisationen mehrheitlich auf die Amtssprache Englisch geeinigt haben. Um sich diesen Thematiken anzunähern, ist ein flüssiger, leichter Umgang und mühelose Recherchen, Lektüre oder sogar Schreibarbeit auf Englisch nahezu unabdingbar. Zudem ermöglichen Dir Fremdsprachenkenntnisse, Medienberichte und Nachrichten zu bestimmten Themen aus anderen Perspektiven als der deutschen Sichtweise für Deine Arbeiten heranzuziehen. Falls Du aber nicht zu den Glücklichen gehörst, die ihre Englischkenntnisse während der Schulzeit im Rahmen eines USA- oder Englandaufenthalts auf Muttersprachenniveau ausbauen konnten und glanzvoll den Englischleistungskurs belegten, und das Schulenglisch und die Vokabeln aus vielen wahnsinnig komplizierten und persönlichen Gründen irgendwie zu kurz kamen, macht das nichts. Aber dann ist Mut gefragt. Halte Dich unbedingt streng an folgende, weise Devise, die Du hoffentlich noch gerade so verstehst: »If you can’t speak proper (…) English, fuck it. Speak Bad English instead. And say all the beautiful things you have to say. We all understand it, we all know it«, schrieb der schwedische Professor Micael Dahlen in seinem Blog.3 Eine Erkenntnis, die Dir zunächst die falsche Hemmung und die lähmende Scham nehmen soll. Aus Angst vor eventuellen Fehlern lieber gar nichts zu sagen, ist nämlich die schlechteste aller Varianten. Schreib Englisch. Nicht Deutsch mit Übersetzungsprogramm, sondern schreib! auf! Englisch! Sprich das, was Du für Englisch hältst, und setz Dich in so vielen Situationen wie möglich der Sprache aus (Filme, Serien, Nachrichten, Sprachtandems). Im Laufe der Zeit wird sich Dein Niveau ganz natürlich von allein verbessern. Learning by doing ist eine harte, aber effektive Devise. Am Anfang wirst Du wahrscheinlich ein wenig schwimmen, irritiert sein, wenn Du nicht jedes Wort verstehst, und rote Ohren bekommen, falls ungeschickte Sätze für Gekicher sorgen. Aber das gehört dazu und geht recht schnell vorbei, wenn Du hartnäckig bleibst. Mut zur Lücke!
Ø»Ich lese Zeitung zum Frühstück.« Wie eingangs erwähnt ist ein politisches Grundinteresse unabdingbar. Dass man sich intensiv über das politische Tagesgeschehen informiert und nicht nur gelegentlich die Tagesschau guckt, ist also eine Selbstverständlichkeit. Deshalb zählt die altehrwürdige Zeitung immer noch zur Grundausrüstung und als Daueraccessoire eines glaubwürdigen Politikwissenschaftlers. Dabei muss nicht mehr unbedingt jeden Morgen die fünf Quadratmeter große Printversion über alle Tischnachbarn ausgerollt werden, das Abo für das Tablet reicht selbstverständlich auch. Eine überregionale Zeitung, die aufmerksam (auch über die Überschriften hinaus) gelesen wird, vermittelt Hintergrundwissen. Unterschiedliche Medien spiegeln dabei verschiedene politische Grundhaltungen wieder, sodass ein und dasselbe Thema auf mehrere Arten dargestellt werden kann. Ein zusätzlicher Blick in die internationale Presse ermöglicht den bereichernden Blick von außen. Egal, für welche Zeitung(en) Du Dich auf Dauer begeistern kannst, wirst Du Dich in jedem Fall mehr informieren müssen, als es Dein Facebook-Newsfeed mit den Headlines von Spiegel Online zu leisten vermag.
Vor dem Hintergrund, dass ich Dich bereits darüber aufgeklärt habe, dass fachspezifische Spezialisierungen im Sinne Deiner Interessen gewünscht sind, ist die regelmäßige Konsultation von wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu Deinen Herzensthemen ein nicht zu unterschätzendes Plus. Zum einen bieten sie Dir konstante Weiterbildung, Einblicke in die Aktualität Deines Fachgebietes und die Lektüre wissenschaftlich anerkannter Arbeiten, sie werden Dir auch als wertvolle Ressource bei Haus- und Abschlussarbeiten dienen.
Hier ein kleiner Überblick bekannter Zeitungen und ihrer Ausrichtung:
·Die Süddeutsche Zeitung (SZ)
Eine gemäßigt links ausgerichtete Tageszeitung aus München. Sie ist die größte überregionale Zeitung in Deutschland, somit kommt ihr eine besondere Rolle in der hiesigen Medienlandschaft zu.
www.sueddeutsche.de
·Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.)
Sie ist das konservativere Gegenstück zur SZ und verfügt über eines der größten Korrespondentennetzwerke der Welt. Die F.A.Z. gilt als Traditionszeitung, die in der Vergangenheit bereits viele wichtige Debatten anstoßen konnte.
www.faz.net
·Die ZEIT
Als Wochenzeitung erscheint die umfangreiche ZEIT jeden Donnerstag. Das in Hamburg ansässige Blatt ist links-liberal eingestellt und für die hohe journalistische Qualität seiner Beiträge bekannt, weshalb deutlich mehr Raum als nur die Dauer eines einzigen Frühstücks für die Lektüre eingeräumt werden sollte. Durch ihre Ausführlichkeit und ihren wöchentlichen Rhythmus scheint die ZEIT jedoch den derzeitigen Bedürfnissen der Interessierten entgegenzukommen: Sie ist eine der wenigen Printmedien, welche in den vergangenen Jahren trotz der wachsenden Konkurrenz durch das Internet seine Auflage weiter erhöhen konnte.
www.zeit.de
·Die tageszeitung (taz)
Sie ist aus Studenten-WG-Küchen, in denen Politikwissenschaftler ihre Mahlzeiten einnehmen, nicht wegzudenken: Eine linke Tageszeitung aus Berlin, die den besonderen Ruf hat, schwierige Sachverhalte pointiert und humorvoll zu vermitteln. Ihre eindeutig linke, teils freche und provokante Berichterstattung ist sicherlich eine Geschmacksfrage und polarisiert häufig. Nicht abzustreiten ist jedoch, dass die taz häufig Themen aufgreift, die bei anderen Medien unter den Tisch fallen.
www.taz.de
·The Economist
Eine englischsprachige Wochenzeitschrift mit internationaler Ausrichtung ist The Economist aus London. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt auf Wirtschaft (wie der Name suggeriert), Politik und Finanzen. Sie wird von deutschen Medien in der internationalen Berichterstattung gern als Referenzmedium genutzt und zitiert, sodass Artikel aus dieser Zeitschrift auch gern von Professoren in politikwissenschaftliche Seminare eingebracht werden.
www.economist.com
Weitere interessante Printmedien wären auch: Neue Zürcher Zeitung, Der Freitag, Foreign Affairs, Le Monde diplomatique, Der Spiegel oder die New York Times. Selbstredend ist diese Aufzählung nicht vollständig.
Ø»Ich bin ein Teamplayer.« Einzelkämpfer haben im Studium (und das bezieht sich eigentlich auf fast alle Studiengänge) die schlechteren Chancen. Es geht bei Weitem nicht nur darum, sich gegenseitig Seminarinhalte zu kopieren oder sich das einzige Exemplar eines beliebten Buches in der Bibliothek gegenseitig zuschieben zu können. Gruppenarbeit ist eine zentrale und gängige – nein, nennen wir das Kind beim Namen: permanent wiederholte, unvermeidliche – Arbeitsmethode fast aller Fächer und jeder sollte sich schnell damit anfreunden. Dabei gilt es theoretisch, Dein Wissen mit dem Deiner Kommilitonen sinnvoll zu teilen und zu ergänzen. In der Schule musste man sein Wissen meist allein präsentieren und sich dabei noch Sorgen machen, nicht als Streber abgestempelt zu werden. Im Studium entsteht durch die ständige Gruppenarbeit eine andere Dynamik, bei der durch den Austausch neue Einsichten gewonnen werden können und nicht die Streber, sondern eher die Drückeberger sich langfristig unbeliebt machen. Da im Studium – im Gegensatz zur Schulzeit – die meisten Studenten freiwillig und aus Interesse in ihrem Fachbereich gelandet sind, ist jedoch auch die Bereitschaft und die Atmosphäre der Gruppenarbeit eine positivere, fruchtbarere.
Ø»Ich habe Geduld und Toleranz für den Umgang mit Idioten.« Wenn Du davon ausgegangen bist, Dich an der Uni in einem Pulk ähnlich motivierter, politikinteressierter und freundlicher Kommilitonen wiederzufinden, die alle intelligent, informiert und diskussionsfreudig sind – sei gewarnt. Es hängt ein wenig von den Zulassungsbedingungen an der Uni ab, letztendlich ist es aber erstaunlich, mit wie vielen Verirrten und Verwirrten Du gerade im Grundstudium an Unis ohne Numerus clausus noch rechnen musst. Keiner weiß, was die alle dort wollen, aber es gibt sie. Vielen ist es schnuppe, was passiert, welches Wissen man sich für ein Seminar hätte aneignen können oder welche Note Eure gemeinsame Gruppenarbeit erreichen wird. Auch politisches Geschehen lockt längst nicht alle hinter dem Ofen hervor. Trotzdem machen viele auch bei vollkommener Ahnungslosigkeit oder Gleichgültigkeit den Mund niemals zu, oft ist das Thema mehr oder weniger rhetorisch geschickt verpackt darauf beschränkt, wie schlecht Deutschland doch eigentlich ist. Je nachdem, an welcher Uni Du mit welcher Motivation gelandet bist und wie passioniert, informiert und schlagfertig Du Deine Themen verfolgst, kann es sein, dass Du im Grundstudium in manchen Momenten den Eindruck erhältst, es sei die erklärte Lebensaufgabe einiger Mitstudierenden, Dich in den Wahnsinn zu treiben.
Es ist von Vorteil, wenn Du ein gewisses Maß an Gelassenheit für solche Situationen mitbringst. Bleib in allen Auseinandersetzungen sachlich, versuche Dir alle noch so schlecht informierten, plumpen Meinungen anzuhören. Achte bei Gruppenarbeit auf die Erledigung Deines eigenen Teils und versuche, Anregungen und Initiative für den guten, differenzierten Gesamteindruck zu geben. Mehr kannst Du nicht machen, Du wirst niemanden ändern und so manchen Rhetoriker kann man kaum mit vernünftigen Argumenten erreichen.
Die trockenen Lernphasen eines Studiums haben nun plötzlich auch eine ruhmreiche Glanzfunktion: Sie filtern einige dieser Kandidaten im Laufe der Zeit ganz von allein heraus. In höheren Semestern und jenseits des Bachelors verbleiben zumeist dann nur diejenigen, die tatsächlich ein politisches Interesse haben, nicht ganz faktenresistent und diskussionsfähig sind – auch und gerade, wenn man nicht immer einer Meinung sein kann, ist eine gute Diskussionskultur später ein Hauptgewinn. Namasté.
Ø»Ich diskutiere gern, auch ohne eine Flasche Wein.« Seminare in der Politikwissenschaft erinnern nicht selten an große Diskussionsrunden. Die vorher gelesenen Texte werden in ihre Einzelteile zerlegt und dies gern von allen Teilnehmern des Seminars gleichzeitig unter heftigen Diskussionen und Protesten. Hier gilt es, nicht zu schüchtern zu sein. Sich konstruktiv zu beteiligen und den eigenen Standpunkt gut überlegt mit strukturierten Argumenten zu verteidigen, ist Teil der Auseinandersetzung mit Politik. Deine Aussagen und Begründungsketten für die Gruppe zu eröffnen, kann Dir letztendlich nur zugutekommen, da sie entweder den Gesprächsverlauf konstruktiv in Deinem Sinne voranbringen oder aber Deine eigenen Gedanken durch Kritik auf den Prüfstand stellen. Lebendige Diskussionen sind der Optimalfall und werden maßgeblich zur allgemeinen Stimmung während Deines Studiums beitragen. Ein nüchterner Kopf ist dabei durchaus hilfreich, nicht nur weil das Diskussionsniveau über Stammtischparolen hinausgehen sollte.
2 Quelle: Bernauer, Thomas et al., Einführung in die Politikwissenschaft, S. 32.
3 Quelle: https://www.facebook.com/micaeldahlen/posts/556609711042233 (abgerufen 14. August 2015)