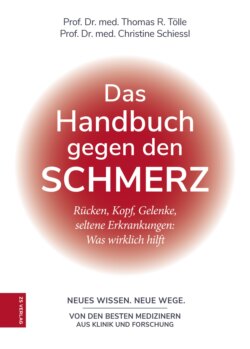Читать книгу Das Handbuch gegen den Schmerz - Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Thomas R. Tölle - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Warum tut es nicht immer nur dort weh, wo die Schmerzursache liegt?
ОглавлениеWenn ein Gewebe verletzt wurde, erhöht sich die Empfindlichkeit aller Schmerzfühler (Nozizeptoren) in der Umgebung. Denn verletztes Gewebe setzt sogenannte Schmerzvermittler (Schmerzmediatoren) frei. Das sind chemische Substanzen wie Histamin oder Serotonin, die die Reizschwelle der Schmerzfühler herabsetzen. Aus diesem Grund schmerzt eine kleine Verletzung oft stark und großflächig. Wenn man sich in den Finger schneidet, tut nicht nur die Stelle rund um den Schnitt weh, sondern oft der ganze Finger. Mediziner nennen das Sensibilisierung – auch das nicht betroffene Gewebe im Umfeld wird sensibel und schmerzt.
Außerdem gibt es das sogenannte Konvergenzphänomen: Das Wort Konvergenz aus dem Lateinischen bedeutet „Zusammenlaufen“. In der Schmerzmedizin heißt das, dass Schmerzen aus zwei verschiedenen Bereichen über die gleiche Schmerzbahn an das Gehirn geleitet werden. Das Gehirn kann dann nicht zuordnen, in welchem der beiden Bereiche, die an die Schmerzbahn angeschlossen sind, die Schmerzquelle tatsächlich sitzt und nimmt den Schmerz an beiden Stellen wahr. Deshalb tut beispielsweise auch die linke Schulter bei einem Herzinfarkt weh. Die Schmerzbahnen von Herz und Schulter laufen im Rückenmark zusammen und melden Schmerz an das Gehirn. Obwohl eigentlich nur die Schmerzfühler im Herzen Alarm schlagen, weil die Herzzellen durch den Infarkt nicht mehr mit Sauerstoff versorgt sind und absterben, kann das Gehirn die Schmerzen nicht genau zuordnen und empfindet Schmerzen in Herz und Schulter.
Das sensorische System beurteilt die Art des Schmerzes („Ist er drückend? Ist er scharf stechend? Wo tut es weh?“).
Das kognitive System bewertet seine Gefahr, indem es ihn mit vergangenen Schmerzerfahrungen abgleicht. Wenn man sich beispielsweise in den Finger geschnitten hat, gleicht das Gehirn den Schmerz ab („Tut es mehr weh als beim letzten Mal, als ich mich geschnitten habe?“) und erfasst die Situation („Großer, tiefer Schnitt – Verletzung könnte also gravierender sein.“).
Das emotionale System beurteilt den Schmerz auf der Gefühlsebene („Warum bin ich immer so ungeschickt? Bei meinem Pech wird sich die Wunde entzünden, es wird sicher wieder Komplikationen geben.“ Ein Anderer beurteilt den Schmerz ganz anders: „Ach, auch wenn es jetzt stark blutet, ist ja nur ein Kratzer, das wird schon!“).
Alle drei Systeme nehmen Einfluss darauf, in welcher Intensität der Schmerzreiz empfunden wird. Gerade das emotionale System hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss! Bei jemandem, der sich wegen der Schnittverletzung keine großen Sorgen macht, wird das emotionale System den eingehenden Schmerzreiz nicht verstärken. Der Schmerz wird weniger intensiv wahrgenommen als beispielsweise von einer Person, bei der dieses System Alarm schlägt, da sie schon einmal nach einer Schnittverletzung eine lebensgefährliche Blutvergiftung bekommen hat. Die eigene Einstellung und der Gemütszustand nehmen also Einfluss auf das Schmerzempfinden. Und das nicht nur bezogen auf die aktuelle Situation, sondern auch auf den allgemeinen Gemütszustand. Sind Sie gestresst oder traurig, empfinden Sie Schmerzen viel stärker, als wenn Sie glücklich sind. Schmerz ist also immer auch abhängig von der Gesamtsituation, in der sich der Patient befindet. Das ist insofern interessant, weil sich hier eine Möglichkeit bietet, aktiv in den Schmerzprozess einzugreifen: Wenn es ein Schmerzpatient schafft, seine Lebenssituation und seine psychische Verfassung zu verbessern, kann das den Schmerz reduzieren! Diese Erkenntnis ist ein wesentlicher Teil der heutigen, modernen Schmerztherapie.