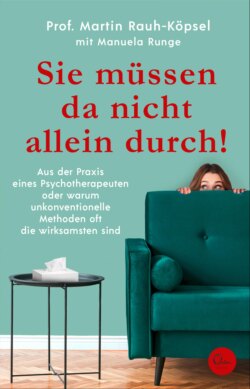Читать книгу Sie müssen da nicht allein durch! - Prof. Martin Rauh-Köpsel - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mein Aufgebot vor ihrer Tür
ОглавлениеSuizidgefährdete KlientInnen sind oft eine besondere Herausforderung für PsychotherapeutInnen, da wir eine gewisse Verantwortung für sie tragen, unsere Eingreifmöglichkeiten gleichzeitig jedoch begrenzt sind. Wir können sie ja nicht rund um die Uhr betreuen.
Antje M., eine 55-jährige Köchin und Mutter von fünf Kindern, war seit Beginn der Therapie latent suizidal. Nach dem Auszug des letzten Kindes hatte sie sich mit fünfzig Jahren vom Kindsvater getrennt, um endlich frei von allen Zwängen zu sein und ihre Träume wahr werden zu lassen, wie sie mir im ersten Gespräch erzählte. Sie war rundlich mit rosigen, glatten Wangen und trug ihr blondes Haar meist zu einem kleinen Dutt hochgebunden. Auf ihren Pullovern glitzerte über dem üppigen Busen stets irgendein Satz oder Wort. Sie wirkte auf mich wie ein fröhlicher, unternehmungslustiger Mensch, der im Leben allerdings zu kurz gekommen war.
»Ich hab mir nie was gegönnt«, sagte sie vorwurfsvoll. »Erst hatten wir wegen der Kinder sowieso kein Geld, und als die raus waren, habe ich mich mit meinem Mann zu Tode gelangweilt, da er wegen eines Rückenleidens Frührentner war und immer nur vor der Glotze hockte. Groß reisen wollte er nicht, zum Tanzkurs, was seinem Rücken gutgetan hätte, auch nicht. Nur in den Garten ließ er sich bewegen, aber dazu hatte ich irgendwann keine Lust und auch keine Kraft mehr. Zu viel Arbeit. Ich dachte, ich könnte einfach noch mal von vorne anfangen, frei sein und machen, was mir gefällt. Hatte sogar einige Treffen mit Männern aus dem Internet. War aber irgendwie anstrengend. Die meisten um die siebzig, als müssten die Weiber für sie grundsätzlich zwanzig Jahre jünger sein. Auf Krankenschwester hatte ich keine Lust, und mit den paar Kerlen in meinem Alter lief es nicht. Ja, und irgendwann haben die Nerven nicht mehr mitgespielt, wurde mir in der Küche alles zu viel, diese ständige Hektik immer …«
Keine ihrer Vorstellungen eines neuen Lebens hatte sich für Frau M. erfüllt. Obendrein verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand drastisch, und sie bildete zahlreiche psychosomatische Symptome aus. Sie litt unter chronischer Gastritis, hörte permanent ein Fiepen im Ohr, hatte diffuse Schmerzen in den Muskeln, gegen die nur noch starke Schmerztabletten halfen. Wenn Konflikte im Kollegenkreis auftraten, zitterten ihre Beine so stark, dass sie sich setzen musste – in einer Küche, in der alles Hand in Hand läuft und einer hektischen Choreografie folgt, ein Unding. Außerdem schlief Frau M. sehr schlecht. Deshalb lief bereits ein Antrag auf Frühberentung, als sie in die Therapie kam. Die zu erwartende Bewilligung war allerdings keine Aussicht auf Befreiung für meine Klientin, sondern ließ das Leben in ihren Augen sinnlos erscheinen.
»Wenn ich nicht mal mehr koche, was bin ich denn dann noch?«
Ihre sozialen Kontakte hatten sich auf ein Minimum reduziert, und nicht einmal die Kinder kümmerten sich um sie.
»Die melden sich nur, wenn sie selbst Hilfe brauchen und ich auf die Enkel aufpassen soll oder so«, sagte Frau M. verbittert und kaute eine Weile lang auf ihrer Unterlippe herum. Es sei ihr alles einfach zu viel geworden. Selbst ihre erste eigene Wohnung, in die sie nach der Scheidung gezogen war, ließ sie zunehmend verlottern. »Meinen Haushalt habe ich längst nicht mehr im Griff«, gab sie resigniert zu. »So, wie’s da manchmal aussieht … das hätt’s in der Küche nicht gegeben.«
»Und wenn Sie eines Ihrer Kinder bitten, mal vorbeizukommen und Sie zu unterstützen?«, fragte ich.
»Nee, lassen Sie mal.« Sie winkte ab. »So weitt kommt es noch, dass ich um Hilfe bitte. Auf so ’ne Idee muss man schon selbst kommen.«
Wie früher ihr Mann saß nun Frau M. tagsüber stundenlang vor dem Fernseher und verschuldete sich durch Einkäufe im Werbefernsehen. Obwohl sich viele äußere Strukturen geändert hatten, war ihr Unglück das gleiche geblieben. Die Antidepressiva, die sie einnahm, wirkten nur marginal, und ihre körperlichen Symptome blieben. Obendrein nahm sie dramatisch zu, was ihren Frust verstärkte.
Ich richtete daher meine Arbeit auf ihre innere Welt. Ich sah, wie sie sich über jeden Termin bei mir freute, meine ungeteilte Aufmerksamkeit genoss und zumindest in der Therapiestunde ihre Augen manchmal leuchteten oder wir sogar gemeinsam lachten. Das tat ihr gut und stiftete eine große Vertrauensbasis.
Trotzdem wich ihre Suizidalität nicht, was mich zunehmend beunruhigte. Nach einigen Stunden brachte ich Antje M. dazu, einen schriftlichen Suizidvertrag abzuschließen. Er sah vor, dass sie unbedingt ein Gespräch mit mir führen müsse, bevor sie sich das Leben nahm.
»Das verspreche ich zusätzlich auf die Hand«, sagte sie und grinste mich an.
Natürlich hoffte ich, dass es nie dazu kommen würde. Manchmal reicht allein schon so ein Vertrag, damit Patienten ihre Selbsttötungsabsichten nicht wahr machen.
Doch eines Tages erhielt ich abends um halb zehn eine SMS von Frau M.: Lieber Herr Rauh-Köpsel, nun ist es so weit. Ich sehe endgültig keinen Sinn mehr in meinem Leben. Danke für all Ihr Bemühen. Es waren die schönsten Stunden in den letzten Monaten für mich. Ich mache Schluss.
Ich war höchst alarmiert. Als Erstes versuchte ich, sie anzurufen. Sie ging nicht ran. Auch auf SMS reagierte sie nicht. Es war also ernst. Sollte ich zu ihr fahren? Sie wohnte am anderen Ende der Stadt. Das könnte zu lange dauern. Außerdem wäre es eine Form der Zuwendung, die dazu führen könnte, dass Frau M. meine Fürsorge zukünftig manipulativ abriefe. Daher rief ich erstmals in meinem Leben die Polizei an, las die SMS vor und bat darum, eine Streife bei Frau M. vorbeizuschicken, die versuchen sollte, äußerst behutsam mit ihr Kontakt aufzunehmen.
Mein Herz klopfte schnell, und ich spürte Schweiß auf meinen Handflächen. Hatte ich die richtigen Schritte eingeleitet? Für einen Suizid, der nicht absehbar ist, werden wir Therapeuten juristisch nicht belangt. Sonst würde sich niemand mehr trauen, schwere Fälle anzunehmen. Jedoch gehört es zu unseren Pflichten, die Suizidalität unserer Klienten zu erwägen, beispielsweise ob es nur einzelne Gedanken sind, die schnell wieder weggehen. Oder ob jemand konkrete Absichten und vorbereitende Schritte vollzieht. Spätestens dann handelt es sich um akute Selbstgefährdung, die uns in die Pflicht ruft, mithilfe des Sozialpsychiatrischen Dienstes oder der Polizei einzugreifen.
Eine halbe Stunde später klingelte das Telefon. Ein Psychiater war dran. »Ich bin in der Wohnung Ihrer Klientin.«
»Wie sieht es aus?«
»Alles gut«, beruhigte mich der Mann. »Ich wollte mit Ihnen besprechen, ob ich nicht abrücken soll, denn ich kann – jedenfalls im Moment – keine Suizidalität feststellen. Aber vielleicht reden Sie mal selbst mit ihr.«
Ich hörte ein Lachen im Hintergrund. Dann Antje M.s merkwürdig unbeschwert klingende Stimme, die sofort lossprudelte: »Hallo, Herr Rauh-Köpsel. Na, da war ja was los bei mir! Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen, alle standen vor meiner Tür. Neun Leute! Und ich hab erst gar nichts gehört. Die wollten schon die Tür aufbrechen …«
»Hatten Sie Schlaftabletten genommen?«
»Nee«, lachte sie. »Nachdem die SMS an Sie raus war, habe ich mir Ohropax ins Ohr gesteckt und bin ins Bett gegangen.«
»Wie –?«, unterbrach ich sie fassungslos. »Sie schreiben mir, dass Sie mit allem Schluss machen wollen und gehen dann gemütlich ins Bett?!«
»Na ja, ich war schon ganz schön verzweifelt gestern Abend …«
»Na, Sie sind ja ’ne Marke!« Ich stieß ein erleichtertes Lachen aus.
Dann war wieder der Psychiater am Hörer. »Machen Sie sich keine Sorgen, Frau M. ist wirklich okay.«
»Ja, das scheint mir auch so.« Die ganze Aufregung war mir sehr peinlich, und ich entschuldigte mich, dass ich ein solches Aufkommen ausgelöst hatte.
»Alles in Ordnung«, meinte der Psychiater. »Ich habe mir die SMS an Sie von der Polizei vorlesen lassen. Sie haben korrekt gehandelt. Und lieber einmal zu viel Alarm geschlagen, als einmal zu wenig. Also, gute Nacht!«
»Ja, gute Nacht. Und danke.« Erleichtert legte ich mich schlafen.
Zwei Tage später erschien Antje M. zu ihrem regulären Termin bei mir. Ich wusste nicht, was mir bevorstand, denn ich konnte mir vorstellen, dass ihr das Großaufgebot im Nachhinein gegenüber der Nachbarschaft ebenfalls peinlich gewesen war und unser enges Vertrauensverhältnis durch die Aktion Schaden genommen hatte. Dementsprechend unruhig sortierte ich meine Unterlagen, während ich darauf wartete, dass Frau M. eintrat.
Es kam verblüffend anders. Strahlend rauschte sie zur Tür hinein, warf sich in den Sessel und dankte mir lachend für das »tolle Aufgebot«, das ich für sie hatte vorfahren lassen. »Alle haben sich Sorgen um mich gemacht«, erzählte sie begeistert.
Nach diesem Ereignis lief die zuvor so schleppende Therapie plötzlich wie geschmiert. Erneut musste ich die Erfahrung machen, dass Menschen, die sich in der Regel sehr viel kümmern, zwischendurch Erfahrungen brauchen, selbst umsorgt zu werden, damit sie ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen können. Es ist wie eine Tankstelle, die wir nur wahrnehmen, wenn wir Benzin brauchen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ab und zu auch die Zapfsäule aufgefüllt werden muss.