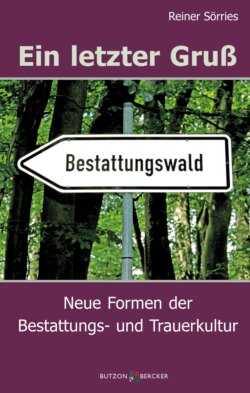Читать книгу Ein letzter Gruß - Reiner Sörries - Страница 14
Geschlechtersensibler Umgang mit Pflegebedürftigen und Sterbenden
ОглавлениеDie von England ausgehende und seit Mitte der 1980er-Jahre auch in Deutschland aufkommende Hospizbewegung hatte es zwar anfangs nicht leicht, denn man argwöhnte, die stationären Hospize seien so etwas wie Sterbekliniken, doch sie hat sich durchgesetzt und gilt heute als eine der bedeutendsten Errungenschaften moderner Lebens- und Sterbeweise. Man hatte organisatorisch und medizinisch einen Weg gefunden, der Menschen in der letzten Lebensphase ein Leben in Würde und Selbstbestimmung ermöglichen soll. Zwar ist das Angebot von Hospizen noch nicht in der wünschenswerten Weise flächendeckend gewährleistet, doch als notwendiger Standard anerkannt.
Ist die Hospizbewegung inzwischen den Kinderschuhen entwachsen, so stellen sich ihr neue Fragen. Gestellt wurden sie im Juni 2009 auf der Tagung „Gender in der Betreuung und Pflege alter Frauen und Männer“, die vom Institut für Palliative Care und OrganisationsEthik der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt in Wien organisiert wurde. Erstmals traten in diesem Umfang die differenzierten Bedürfnisse von zu Pflegenden und Sterbenden in Bezug auf Geschlecht, Alter und sexueller Orientierung in den Mittelpunkt. Beschrieben wurde das Tagungsthema mit folgenden Worten: „Die Betreuung und Pflege alter Menschen mit Unterstützungsbedarf bis an ihr Lebensende gewinnt als gesellschaftliche Herausforderung an Bedeutung. Gleichzeitig kann beobachtet werden, dass diese Herausforderung in unterschiedlichen Rollen – bezogen auf Geschlechterverhältnisse – bearbeitet und gelebt werden. Im Rahmen der Tagung Gender-Care gehen wir daher folgenden Fragen nach: Was bedeutet Gender für die Bedürfnislagen von alten Frauen und Männern mit Unterstützungsbedarf?“ Die Beiträge der Tagung wurden anschließend von Elisabeth Reitinger, einer der Organisatorinnen, und Sigrid Beyer publiziert, und der 2010 erschienene Tagungsband kann inzwischen als Standardwerk dieser Fragestellungen gelten.33
Eigentlich bleibt nur das Erstaunen darüber, dass nicht früher erkannt wurde, dass Frauen und Männer, junge und alte Menschen, Hetero- und Homosexuelle unterschiedliche Beziehungen zu ihrem Körper und zu ihrer Seele, zu ihren Gefühlen entwickeln bzw. mit ihrer Biografie und Sozialisation entwickelt haben. Aber das gehört eben zur Moderne, dass die Zuweisung bestimmter Geschlechterrollen nicht mehr frag- und klaglos hingenommen wird, sondern einer Erkenntnis von der Verschiedenheit der Menschen weicht. Dann werden Fragen relevant, wer z. B. in welchem Zustand von wem berührt werden will und unter welchen Voraussetzungen. Der eigene Körper wird von Männern und Frauen unterschiedlich erlebt, Gleiches gilt für eine durch die sexuelle Orientierung geprägte Wahrnehmung des Körpers. Und man kann das fortsetzen, indem man nach der mentalen Einstellung fragt, die durch Religion und Weltanschauung geprägt sein kann. Ein gesprochenes Gebet kann für den einen eine Entlastung sein, für die andere eine Zumutung. Unterschiedliche Krankheitsbilder bis hin zu Depression und Demenz spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle.
Bezieht man solche Kategorien in die Pflege alter, multimorbider und sterbender Menschen ein, so stellt dies an die Pflegekräfte erhöhte Anforderungen hinsichtlich Wissen, Ausbildung und Einfühlungsvermögen. Bemerkenswert an der genannten Tagung war, dass sie die geschlechterbedingte Rollenfrage auf die Pflegenden, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und Angehörigen ausdehnte. So sei das Rollenverständnis der Frau zu hinterfragen, wonach sie schon aufgrund ihres Frauseins prädestiniert sei für die Pflege, dafür aber wenig Anerkennung findet und eine schlechte Bezahlung erhält. Erst recht gelte dies für den hohen Anteil an Migrantinnen im Pflegesektor, die aufgrund ihres Status ohnehin Benachteiligungen ausgesetzt sind. So mündete die Tagung in die Forderung nach einem Diversity Management, das den Bedürfnissen aller Beteiligten nachkommt.