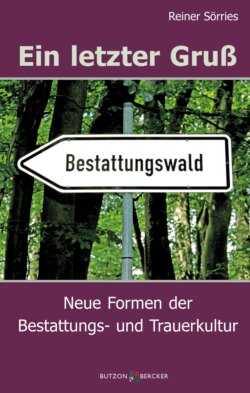Читать книгу Ein letzter Gruß - Reiner Sörries - Страница 9
Bestattung in Frauenhänden
ОглавлениеEs sollen eigene, negative Erfahrungen gewesen sein, die Ajana Holz bei Sterbefällen erlebt hatte. Sie hatte dabei wenig Hilfe und Unterstützung erfahren, und dies veranlasste sie, mit ihrer damaligen Freundin und Lebenspartnerin Brigitte 1999 das Bestattungsinstitut „Die Barke“ zu gründen. Insbesondere schien es ihr seinerzeit kaum möglich, Bestattungen gemäß ihrer lesbisch-feministischen Vorstellungen durchzuführen. Sie erinnerte sich an die alten Traditionen der Totenfrauen und Leichenwäscherinnen, die über Generationen hinweg die Totenfürsorge betrieben hatten. Ihr wurde gleichzeitig die besondere Aufgabe der Frau am Lebensbeginn bewusst, und so übertrug sie diese Kompetenz auf das Lebensende. Ajana Holz, die in Erwägung gezogen hatte, Hebamme zu werden, versteht sich nun als Seelen-Hebamme am Lebensende. Heute betreibt sie mit ihrer Lebensgefährtin Merle von Bredow das Bestattungsinstitut „Die Barke“ mit dem Grundsatz, „den würdevollen und sanften Umgang mit den Toten wieder in Frauenhände zu nehmen“.16 Beide Frauen sind 1964 bzw. 1967 geboren und gehören somit, wenn man so will, der jüngeren Generation an, als sie anfingen, sich der Betreuung von Kindern, Frauen und Menschen in Krisensituationen zu widmen. Sie können ebenfalls beide auf eine schamanische Ausbildung verweisen, womit sie die Geistigkeit ihres Tuns betonen, das Vorrang besitzt vor den üblichen handwerklichen und organisatorischen Tätigkeiten des Bestatters. In ihrer täglichen Praxis bestatten sie Menschen beiderlei Geschlechts, aber sie machen keinen Hehl aus ihrer Einstellung, dass Frauen und auch Kinder besonderer Sorgfalt bedürfen: „Es ist uns ein Herzensanliegen, vor allem Frauen und Kindern nach ihrem Tod einen geschützten Raum, unseren ganzen Respekt und unsere liebevolle Fürsorge zu geben, bis sie der Erde oder dem Feuer übergeben werden!“ Sie verstehen sich als „Anwältinnen“ für die Würde der Toten und für das Recht der Menschen auf ihren ureigenen Abschied und wollen mit ihrer Arbeit eine Brücke zwischen Leben und Tod bauen, die für sie untrennbar zusammengehören. Frauen, so sagen sie, können das von Natur aus besser, denn wie die Geburts-Hebammen am Lebensbeginn die Neugeborenen empfangen, so empfangen wir am Lebensende die Toten und begleiten sie und die Abschied nehmenden Lebenden in diesem Übergang.17
Derselben Generation gehört Claudia Marschner an, die auf Umwegen zum Bestattungsgewerbe kam, ihre (negativen) Erfahrungen sammelte und schließlich 1992 ihr eigenes Institut gründete, um – wie sie sagt – alles anders zu machen. Mit ihren bunten Särgen, der Beisetzung der Rocker in ihrer dunklen Motorradkluft und rosa Särgen für Lesben eroberte sie die Aufmerksamkeit der Medien und prägte die Vorstellung von dem, was man eine alternative Bestatterin nennt. Sie huldigt der Überzeugung, dass jeder Mensch in seiner Verschiedenheit die ihm angemessene Bestattung verdient. Man mag einräumen, dass manches auch wie pures Marketing klingt, aber sie wäre nicht erfolgreich, wenn es nicht eine Klientel gäbe, die ihre Verschiedenheit auch im Bestattungsfall leben möchte. Zugleich sei zugegeben, dass hier ein Nischenprodukt angeboten wird, weil sich die Mehrheit der Bevölkerung immer noch den traditionellen Formen verpflichtet fühlt. Aber wie die Bestatterinnen der „Barke“ kann Claudia Marschner im hart ausgefochtenen Konkurrenzkampf nur bestehen, weil sich eine wachsende Zahl von Menschen ihrer Eigenart bewusst wird. Man kann gar nicht sagen, dass sie eine Tür aufgestoßen haben, vielmehr war der Druck auf diesen neuen Raum bereits so gestiegen, dass sie die Türe einfach öffnen mussten.
Dafür bot Berlin, wo Claudia Marschner tätig ist, das ideale Umfeld: eine Großstadt mit ihrer lebhaften Kultur und einer kreativen AIDS-Szene, die offen oder sogar begierig war auf Neues. Eine Bestattung in Frauenhänden bietet unter ähnlichen Vorzeichen Claudia Bartholdi in der Großstadt Hamburg an und verweist ebenfalls auf die ursprünglichen Zusammenhänge von Geburt und Tod: „Schon immer haben Frauen Geburt und Tod begleitet. Ihr Wissen unterstützt die einfühlsame und fürsorgliche Begleitung der notwendigen Handlungen! Auch wir besinnen uns wieder auf die Tradition der Totenwäscherinnen und übernehmen die Abschiednahme und Totenwache in familiären Räumen.“ Milieu und Szene sind offenbar der Nährboden für das frei werdende Bewusstsein einer Individualität, die sich andernorts noch zurückhält. „Die Barke“ hingegen, mit Firmensitz in Schwäbisch Hall und daher eher in einem konservativen Umfeld beheimatet, bietet ihre Dienste bewusst bundesweit an. Daraus ist zu schließen, dass das Pflänzlein einer alternativen Bestattungskultur erst vorsichtig keimt, aber der Weg in die Zukunft ist gewiesen. Sie hat inzwischen auch mittelgroße Städte wie etwa Aachen erreicht, wo Regina Borgmann und Christa Dohmen-Lünemann seit 2007 das Bestattungsinstitut „InMemoriam“ betreiben, und man könnte die Reihe der Frauen fortsetzen, die ihre eigenen Wege gehen.
Drei Dinge sind ihnen gemeinsam: die Rückbesinnung auf die weibliche Tradition der Totenfürsorge, das Bewusstsein vom Gleichklang von Geburt und Tod und, damit verbunden, ihre Weisheit, dass der Tod ein Übergang ist in eine andere Welt. Ihre Dienstleistungen mögen sich in der Praxis vielleicht gar nicht so sehr von denen ihrer männlichen Kollegen unterscheiden, doch vermitteln sie ihren Kunden ein anderes Gefühl. Sie sprechen es nicht in erster Linie an, aber sie bedienen eben auch den Wunsch einer Frau, von einer Frau bestattet zu werden. Ein anderes Körperbewusstsein und eine damit verbundene Scham, die auch den leblosen Leichnam noch für schützenwert hält.
Von den genannten Pionierinnen abgesehen haben sich mittlerweile viele Frauen aufgemacht, die Bestattung bewusst aus Frauenhänden anzubieten. Aber selbst, wo ihnen der Weg in die Selbstständigkeit nicht gelingt, sind sie doch mittlerweile als Mitarbeiterinnen in männergeführten Bestattungsunternehmen sehr willkommen. Neben ihrem Organisationstalent wird ihnen eine besondere Einfühlsamkeit zuerkannt, und die Frauen gehen diesen Schritt vermehrt. Der Bestatterberuf ist seit 2003 Ausbildungsberuf, und bereits 2010 waren von 467 Personen in der Ausbildung zur Bestattungsfachkraft 239 Frauen. Eine steigende Zahl von Bestattungsunternehmern findet es gut, wenn Angehörige wählen können, ob sie von einem Mann oder einer Frau betreut werden wollen. Das gilt für die Vorderbühne, wo es um Beratung und Absprachen geht, aber ebenso für die Hinterbühne, wo die Verstorbenen denen, die sie einsargen und zurechtmachen, hilflos ausgeliefert sind.
Dabei herrscht unter den Frauen eine bewusste Reflexion ihrer Praxis, die allerdings bis heute kaum theoretisch unterfüttert ist. Selbst Erni Kutter, Diplom-Sozialpädagogin und Vorkämpferin für eine weibliche Trauerkultur, die versucht, in das Phänomen der Frauentrauer tiefer einzudringen, verweist letztlich nur auf das „uralte Frauenwissen“, von dem Impulse für die „Entstehung einer neuen Sterbe- und Gedenkkultur“18 ausgehen. Sie verweist auf die traditionelle Beziehung der Frauen zur Kranken- und Totenfürsorge, auf altes schamanisches Wissen ebenso wie auf spirituell-magische Hintergründe der mittelalterlichen Beginen. Aus meiner Sicht macht sie deutlich, dass es sich hier um Gefühle handelt, die den Ausschlag geben, wenn Frauen, die sich ihrer Verschiedenheit bewusst werden, sich bei Geschlechtsgenossinnen besser aufgehoben wissen.
Die weiblichen Bestatterinnen kommen jedoch nicht nur einem erwachenden Bedürfnis nach der Betreuung der Frauen durch Frauen entgegen, sondern sie nehmen Einfluss auf die Bestattungskultur an sich, denn immer mehr Männer orientieren sich an den weiblichen Idealen und befleißigen sich derselben Sensibilität. Viele Vertreter der neuen Bestattergeneration sind Quereinsteiger/innen und kommen aus unterschiedlichsten Berufen; sie haben sich aufgrund eigener Erfahrungen – gelungenen wie weniger gelungenen Abschieden von nahestehenden Menschen – an einem bestimmten Punkt ihrer jeweiligen Biografie entschieden, ein eigenes Bestattungsinstitut zu gründen. So heißt es auf der Website des „BestatterInnen Netzwerk“19, sie seien ein bundesweiter Kreis inhabergeführter Bestattungsunternehmen, die sich einem gemeinsam erarbeiteten Leitbild20 verpflichtet haben. Vielem darin fühlen sich „normale“ Bestatter/innen ebenso verpflichtet, aber ein besonderer Gedanke ist schon, dass sich die alternativen Bestatter/innen als Wegbegleiter in der kostbaren Zeit zwischen Tod und Bestattung für die Toten und ihre Angehörigen verstehen. Kostbare Zeit ist hier der Schlüsselbegriff, mit dem sie der durch den Tod belasteten Zeit eine neue Qualität verleihen. Und sie verstehen die Toten nicht als Objekte ihres Tuns, sondern als schutzbedürftige Menschen und Teil des Beziehungsgeflechtes, innerhalb dessen es eines Interessenausgleichs zwischen Toten, Angehörigen und Institutionen bedarf.