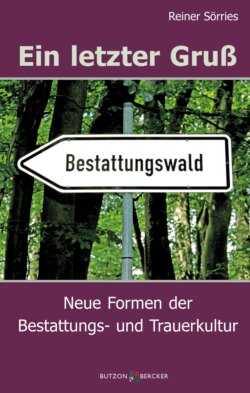Читать книгу Ein letzter Gruß - Reiner Sörries - Страница 5
Vorwort
ОглавлениеJeder trauert anders – diese Stereotype scheint heute die Diskussion um eine angemessene und zeitgemäße Bestattungs- und Trauerkultur zu beherrschen. Richtig daran ist zunächst, dass über diese ehemaligen Tabuthemen seit etwa zehn bis zwanzig Jahren ein lebhafter Diskurs herrscht, wie es ihn zu kaum einer Epoche der Menschheitsgeschichte in ähnlicher Weise gegeben hat. Wie man bestattet und trauert, war durch Tradition und Religion vorgegeben, weshalb es wenig Anlass gab, darüber zu diskutieren.
Das hat sich erst im 20. Jahrhundert geändert, als man begann, die Trauer wissenschaftlich zu erforschen. Sigmund Freud führte den Begriff der Trauerarbeit ein, die notwendig sei, um die Bindung zum geliebten Objekt völlig zu lösen. Gelänge dies nicht, etwa aufgrund bestimmter Verdrängungsmechanismen, so drohten den Trauernden Gefahren für das seelische Wohlbefinden. In den 1970er-Jahren entwickelte die Schweizer Ärztin Elisabeth Kübler-Ross das Modell einer Trauer, die immer in den gleichen Phasen verläuft. Sie hatte diese Phasen in ihren Interviews mit Sterbenden herausgearbeitet, und das Modell wurde auf Trauernde übertragen. Wenig später wurde das Phasenmodell dahingehend korrigiert, dass es nicht linear verlaufe, sondern in Wellen und Schüben; Phasen werden übersprungen oder mehrfach erlebt. Neuerdings jedoch präferieren viele Trauerberater die Tatsächlichkeit höchst unterschiedlich verlaufender Trauerprozesse, die sich nicht kategorisieren lassen. Der amerikanische Trauerforscher George Bonanno hat festgestellt, dass die Zahl jener Trauernden erstaunlich hoch ist, die selbst nach einem schweren Verlust wie dem des Ehepartners eher kurze und milde Trauersymptome entwickeln, und er spricht von Resilienz, einer hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber schlimmen Erfahrungen. Nach seinen Untersuchungen sind es 41 %, die gut mit Verlusten umgehen können.
Verändert sich die Trauer oder verändern sich die Betrachtungsweisen der Trauer? Immerhin haben die Forschungen dazu geführt, dass von vielen eine Regellosigkeit der Trauer angenommen wird. Betrachtet man jedoch nicht die psychologische Seite der Trauer, sondern ihre sichtbaren und beschreibbaren Formen, so zeigt sich ein anderes Bild. Menschen trauern keineswegs regellos, sondern orientieren sich an ihrem sozialen und emotionalen Umfeld, in das sie hineingestellt sind, und das Trauerverhalten folgt solchen gruppenspezifischen Bedingungen. Das ist nicht neu, aber es kann aus einem veränderten Blickwinkel neu wahrgenommen werden. In hundert Prozent Todesfällen können nicht hundert Prozent verschiedene Handlungs- und Verhaltensweisen festgestellt werden, sondern es gibt konkrete Szenarien, in denen sich die Trauernden bewegen. Diese Szenarien folgen den Verschiedenheiten der Menschen, durch die sie charakterisiert sind, und es wurden in den letzten beiden Jahrzehnten solche Verschiedenheiten erhoben, die den Menschen ausmachen. Nicht jeder trauert anders, sondern wir trauern im Kontext unserer Verschiedenheit, die uns von vielen unterscheidet, aber mit manchen ähnlich sein lässt. Daraus entstehen gruppenspezifischen Verhaltensweisen, derer wir uns bedienen, um die eigene Identität zu bewahren.
Um solche gruppenspezifische Verhaltensweisen soll es hier gehen, um einerseits die Veränderungen der Bestattungs- und Trauerkultur zu verstehen und andererseits die Notwendigkeit zu unterstreichen, den daraus resultierenden Bedürfnissen gerecht zu werden. Denn unser Bestattungs-, Friedhofs- und Trauerwesen ist immer noch zu eindimensional ausgerichtet, das zahlreichen Verschiedenheiten von Menschen nicht gerecht wird.
Nicht jeder trauert anders, aber jeder trauert verschieden. Während sich aber das jeder trauert anders jeder Regel zu entziehen scheint, können Verschiedenheiten benannt und differenziert werden. Somit haben wir es heute nicht mit einer individuellen Regellosigkeit, sondern mit einer geregelten, allerdings differenzierten Vielfalt zu tun. Diese wahrzunehmen heißt dann, die Veränderungen als Chance für eine zeitgemäße und menschliche Trauerkultur zu begreifen. Insofern schwimmt dieses Buch ein wenig gegen den Strom jener, die Abweichungen von der (bisher) geltenden Norm und Veränderungen als Verfall interpretieren und die so Handelnden gleichzeitig stigmatisieren.
Reiner Sörries, Kröslin im Herbst 2015