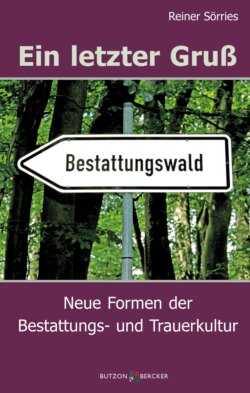Читать книгу Ein letzter Gruß - Reiner Sörries - Страница 8
III. Gender
ОглавлениеDie Verschiedenheit von Frau und Mann ist keineswegs nur eine biologische, sondern auch eine sozial konstruierte, indem dem jeweiligen Geschlecht bestimmte Verhaltensweisen nicht nur zugeschrieben, sondern auch abverlangt werden. Mit diesem Sachverhalt befasst sich nach Anfängen in den 1960er- und 1970er-Jahren in den USA auch in Deutschland seit den 1980er-Jahren die sogenannte Geschlechterforschung als eigene Disziplin, auch hierzulande als Gender Studies bezeichnet.
Das den Geschlechtern traditionell zugeordnete Trauerverhalten kann diesen Sachverhalt verdeutlichen. Auf einer Zeichnung von Rudolf Jordan, darstellend das Begräbnis des jüngsten Kindes von 1857 ist dies prototypisch dargestellt. (Abb. 1)
Während die Frau überwältigt vom Schmerz um das tote Kind in gebückter Haltung die Hände vors Gesicht geschlagen hat, bleibt der Mann aktiv, trägt den Sarg des Kindes und blickt mit offenen Augen nach vorne. Die Frau ist passiv, der Mann aktiv. Das Töchterchen hingegen übernimmt die Rolle des unverständigen Kindes, das die Situation nicht begreift und wie unbeteiligt wirkt.
Abb. 1: Rudolf Jordan, Begräbnis des jüngsten Kindes, 1857
Die Passivität der Frau und die Aktivität des Mannes im Trauerfall spiegeln sich in der Folge auch in der Konvention der Trauerkleidung. Während die Frau über Monate, bisweilen über Jahre Gefangene einer peniblen Trauermode war, beschränkte sich das Tragen von Trauerkleidung beim aktiven Mann auf kurze Zeit, die rasch dem Trauerflor am Ärmel wich, um ihm die Hände fürs Tun frei zu halten.
Diese Rollenzuschreibung an Mann und Frau im 19. Jahrhundert korrespondiert mit dem Sachverhalt, dass das Bestattungsgewerbe in dieser Zeit eine Männerdomäne geworden war. Davor war über viele Jahrhunderte die Frau jene Person, die sich als Begine, als Totenwäscherin, als Seelnonne, als Toten- oder Leichenfrau um die Bestattung der Verstorbenen kümmerte. Die neue Arbeitsteilung im 19. Jahrhundert folgte dem ökonomischen Interesse des Mannes, der als Fuhrunternehmer oder Sargtischler das gesamte Bestattungsgewerbe an sich zog, als es ihm die neue Gewerbefreiheit möglich machte.
Galten diese Rollenverteilungen im 19. Jahrhundert als gegeben und unumstößlich, so wurden sie im Laufe der Emanzipationsbewegung kritisch hinterfragt. Aber es dauerte bis in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, bis Frauen begannen, ihre Passivität ins Gegenteil zu verkehren. Schließlich wehrten sie sich nicht mehr gegen eine „Trauer als zweifelhaftem Privileg der Frauen“13, sondern erhoben darauf einen geschlechtsspezifischen Anspruch
Den Beginn des Umdenkens kann man ziemlich genau in die 1990er-Jahre datieren, als sich Soziologinnen empirisch und wissenschaftlich damit befassten. Die erste geschlechtsspezifische Untersuchung zum Verhalten von Frauen gegenüber Sterben, Tod und Trauer verfasste in Großbritannien die Biografieforscherin Sally Cline, die u. a. in leitender Position am Institut für Women’s Studies an der Cambridge University tätig war. 1997 erschien ihre Studie „Women Death and Dying“, die unter dem Titel „Frauen sterben anders“ ins Deutsche übersetzt wurde. Sie öffnete damit den Blick auf einen differenzierten Umgang mit Männern und Frauen in Pflege und Palliative care. Auch, so ihre These, besäßen Frauen eine grundsätzlich andere, eine im Vergleich zu den Männern eher innere Einstellung zum Tod. In Deutschland waren es die Paderborner Professorin Hannelore Bublitz und die Berliner Soziologin Dorothea Dornhof, die ähnliche Forschungen betrieben, zunächst aber nur in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichten.14 Als die Kulturwissenschaftlerin und Soziologin Julia Schäfer 2002 die „Perspektiven einer alternativen Trauerkultur“ beleuchtete, fand sich im Zuge dieser Studie erstmals ein Exkurs zu „Trauer und Geschlechtsspezifik“: „Mit diesem Exkurs sollen geschlechtsspezifische Unterschiede, die es hinsichtlich Tod und Trauer gibt, thematisiert werden.“15
Es ist allerdings bemerkenswert, dass beinahe zeitgleich zum Beginn akademischer Studien vergleichbare Erkenntnisse bereits Einzug in die Praxis hielten. Frauen nahmen ihre besondere Rolle wahr und beanspruchten ihren Platz im Bestattungswesen, weil sie Frauen sind.