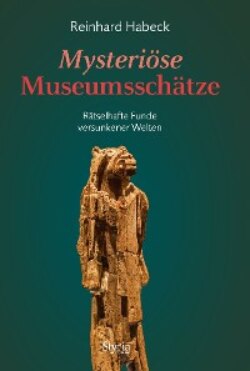Читать книгу Mysteriöse Museumsschätze - Reinhard Habeck - Страница 19
Falsche Fährten
ОглавлениеDer Sitzungsbericht über Adolf Gurlts Expertise zum angeblichen Geschoss aus dem All enthält viele Mängel. Sie sind „hausgemacht“, weil der Gelehrte seinen Kollegen nicht das originale Beweisstück vorlegte, so wie das im Auftakt des Protokolls behauptet wird. Es waren lediglich Fotografien, die für eine Prüfung zur Verfügung standen. Ob Gurlt das Eisenrelikt überhaupt jemals selbst in der Hand gehalten hat, ist fraglich. Das geht aus den Recherchen von Hubert Malthaner und Adolf Schneider hervor. Die beiden Ingenieure besuchten 1973 das Heimathaus in Vöcklabruck und gehören zu den wenigen Autoren, die den ominösen Metallklotz tatsächlich im Original gesehen haben. Ihre Reportage über „Das Geheimnis des Salzburger Würfels“ wurde 1974 in der Mai-Ausgabe der Zeitschrift „Esotera“ veröffentlicht.
Der „Eisenwürfel“ 1974 als Coverstory im Magazin „esotera“
Schon damals war bekannt, dass etliche Angaben von Adolf Gurlt nicht stimmen. Das Eisenrelikt sieht zwar wie ein geometrischer Körper aus, ist aber kein Würfel. Es entspricht vielmehr einer Trapezplatte mit aufgewölbten Seitenflächen, die etwa 50 dellenförmige Vertiefungen bedecken. Die vier schmalen Seitenflächen rund um das Objekt zeigen eine einheitliche Rinne von etwa 10 mm. Diese Eigenart im Gestein stiftete viel Verwirrung. Besonders nach der Veröffentlichung eines Artikels im französischen Wissenschaftsmagazin „Science & Vie“. In Ausgabe Nr. 516 vom September 1960 beschreibt der Autor Georges Ketman das Eisenrelikt mit den Worten „parallélépipède parfaitement régulier“ (ein „vollkommen regelmäßiger Quader“).
Etwas wirklich Regelmäßiges, quasi ohne Makel, gibt es an dem Fragment nicht. Mit der falschen Übersetzung aus dem Französischen wurde die Verwirrung weiter gesteigert. „Parallélépipède“ mutierte zu „parallel pipes“. Bald darauf erfuhren erstaunte Leser in Zeitschriften aus aller Welt, dass ein russischer Archäologe beabsichtige „nach Salzburg zu reisen, um dort parallel liegende Röhren aus poliertem Stahl zu analysieren, die tief in den Adern eines Kohlebergwerkes eingebettet liegen und auf ein Alter von 30.000 Jahren datiert sind“. Ein Musterbeispiel dafür, dass Fake News kein Phänomen des Internetzeitalters sind.
Was noch auffällt: Je nach Publikation weichen die Größenangaben des Wolfsegger Eisenstücks voneinander geringfügig ab. Das kann man innerhalb der Toleranzgrenze gelten lassen. Was aber hat es mit der immer wieder genannten Ortsangabe „Salzburg“ auf sich? Gemäß der Urquelle von Adolf Gurlt befand sich der Eisenfund im Besitz des Museums Carolino-Augusteum in der Stadt Salzburg. Das Museum existiert bis heute und wurde bis 2007 so genannt, heute heißt es „Salzburg Museum“, aber das Relikt aus Wolfsegg war dort vermutlich nie zu Gast.
Sorgte 1960 für Verwirrung: „Fake News“ im Fachmagazin „Science & Vie“
Die „Phänomene-Detektive“ Malthaner und Schneider glauben an eine Verwechslung der ähnlich klingenden Museumsnamen „Carolino“ und „Carolinum“. Belegt ist, dass das Original gemeinsam mit einer Replik aus Gips in den Jahren 1950 bis 1958 im „Museum Francisco-Carolinum“ zu Linz verwahrt wurde. Lag das Fundstück dort kurzfristig schon in früherer Zeit? Verwunderlich wäre das nicht. Im Carolinum-Palais, heute Sitz der Landesgalerie Linz, waren viele Jahrzehnte lang die naturhistorischen Schätze der Region untergebracht. In den 1960er-Jahren wurden die einzelnen Abteilungen in die „Oberösterreichischen Landesmuseen“ ausgelagert. Der Großteil der Sammlungen übersiedelte publikumswirksam ins Linzer Schloss.